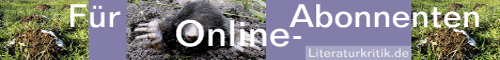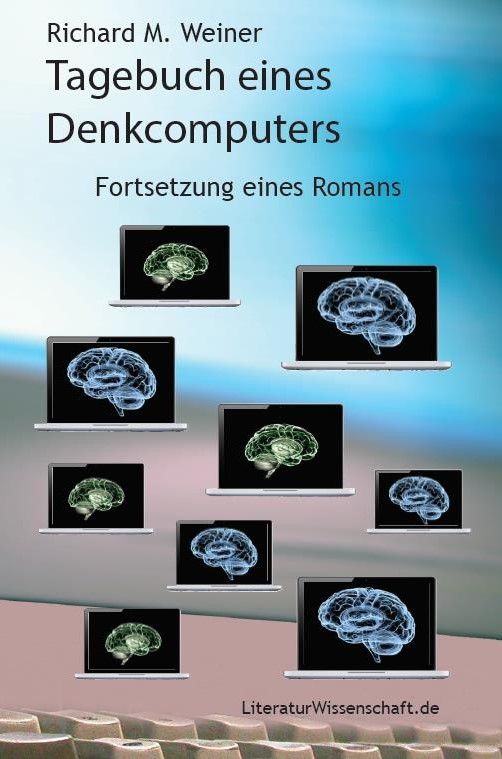Oliver Pfohlmann schrieb uns am 23.02.2017
Thema: Ein Drittel seines Selbst
Über Oliver Matuscheks Stefan Zweig-Biografie und eine Ausgabe des Briefwechsels zwischen Zweig und seiner ersten Frau Friderike
1930 bekannte Friderike Zweig ihrem Gatten, wie sehr ihr auf der Seele laste, „dass Dich kein Mensch – außer mir – wirklich kennt, und dass einmal die hohlsten, blödsinnigsten Sachen über Dich geschrieben sein werden.“ Soweit Friderike Recht behielt, trug sie dazu nicht unwesentlich selbst bei: mit verklärenden Erinnerungswerken à la Stefan Zweig. Wie ich ihn erlebte und einer Auswahl ihres Briefwechsels mit dem Dichter, deren Manipulationen erst heute sichtbar werden. Wo etwa der späte Zweig „wir“ schrieb und damit sich und seine zweite Frau Lotte Altmann meinte, tilgte Friderike die Rivalin kurzerhand, indem sie ein „ich“ setzte.
Friderike überlebte Stefan und Lotte, die 1942 im brasilianischen Exil gemeinsam den Freitod wählten, um beinahe drei Jahrzehnte. In der Rolle der selbsternannten Dichterwitwe bestimmte sie maßgeblich das Bild des weltweit berühmtesten und erfolgreichsten österreichischen Autors seiner Zeit. Zwei Titel, erschienen 2006 zum 125. Geburtstag Zweigs, ermöglichten erstmals einen detailreicheren, lebensnahen Blick auf Stefan Zweig: eine Biografie von Oliver Matuschek sowie eine um alle Fälschungen bereinigte neue Auswahl des Briefwechsels zwischen Stefan und Friderike, die Jeffrey B. Berlin und Gert Kerschbaumer besorgt haben.
Matuschek konstatiert gleich zu Beginn die Kluft zwischen der Prominenz Zweigs und der Tatsache, dass von seinem Leben nur wenig bekannt wurde: „Selbst auf gute Bekannte wirkte er verschlossen, und sogar engen Freunden blieb vieles an ihm rätselhaft.“ Was nicht zuletzt daran liegt, dass Zweig kein autobiografischer Autor war: „Dein Schrifttum ist ja nur ein Drittel Deines Selbst“, hatte ihm schon Friderike geschrieben. Der literaturtypische Exhibitionismus war Zweig fremd; seine Autobiografie Die Welt von Gestern geriet ihm zu einem Epochenpanorama, das private Lebensumstände weitgehend aussparte, einschließlich der Ehefrauen.
Den Arbeitstitel der Autobiografie, „Drei Leben“, übernimmt Matuschek jedoch von Zweig. In drei Blöcken beschreibt er kenntnisreich die „Lehr- und Wanderjahre“ Zweigs, der als Sohn eines jüdischen Textilunternehmers bis zum Ersten Weltkrieg keinerlei materielle Sorgen kannte; die Erfolgsjahre des „Erwerbs-Zweigs“ (so eine boshafte Titulierung Hofmannsthals) in Salzburg nach dem Krieg und die Jahre des Exils in England, USA und Brasilien, als der Autor zunehmend in Pessimismus und Depression versank. Dabei kann sich der Historiker und Politologe auf bislang unbekanntes Material stützen, vor allem auf die Briefe von Zweigs Bruder Alfred.
Dass Matuschek durchweg skeptische Distanz gegenüber seinen Quellen bewahrt, gefällt. Für Wiener Klatschgeschichten wie das auf Benno Geiger zurückgehende Gerücht, Zweig habe sich, armiert mit einem Attest Freuds, in Wiener Parks regelmäßig vor Frauen entblößt, hat Matuschek wenig übrig. Korrigiert werden aber auch Zweigs Selbstdarstellungen. So war er im August 1914 durchaus kein Pazifist der ersten Stunde, der er später gewesen sein wollte. Vielmehr schäumte auch Zweig zunächst, Deutschland müsse nun „mit beiden Fäusten, nach rechts und links ... zuschlagen“, und nahm in einem offenen Brief für die Dauer des Krieges Abschied von den „Freunden im Fremdland“.
Erhellend ist Matuscheks Darstellung von Zweigs Begegnung mit Gustav Mahler an Bord eines Übersee-Dampfers 1911. Der todkranke Komponist wollte niemanden mehr sehen, doch der junge Zweig erhaschte dennoch, wie er es selbst später beschrieb, voller Scheu und Ergriffenheit einen letzten Blick auf Mahlers „harte(s) Kinn“, in dem er noch die „Stoßkraft seines Willens“ erkannte. Alma Mahler erinnerte sich dagegen mit Schaudern an einen jungen Österreicher, der sensationslüstern über die Koffer linste, anstatt beim Tragen zu helfen, wie er es zunächst versprochen hatte...
Überhaupt, die Verehrungssucht Zweigs! Sein Freund Romain Rolland sprach treffend vom „Seelenjäger“ Zweig, der als „frommer Liebhaber des Genius“ wie im Fieberwahn durch Europa eilte und Handschriften zusammenraffte. Für ein Doppelblatt aus dem Faust gab Zweig ein Vermögen aus; er erwarb Mozarts Bäsle-Briefe, Autografen von Beethoven, Napoelon, Leonardo da Vinci. Am Ende sogar, wie Matuschek entdeckte, unter strengster Geheimhaltung ein Redemanuskript Hitlers, diesmal freilich in der Hoffnung, so dem Diabolischen auf die Schliche zu kommen.
Während Zweig als Bestseller-Biograf oft allzu ungehemmt seiner Empathie vertraute, hätte Matuscheks Darstellung, bei allem Materialreichtum, ein Schuss Leidenschaft gut getan; sie liest sich streckenweise so nüchtern wie eine unliebsame Auftragsarbeit. Auch reiht sie zu sehr ihr Material aneinander, anstatt ihren Gegenstand zu profilieren. Etwas näher an die „brennenden Geheimnisse“ Zweigs gelangt man da schon durch den Briefwechsel mit seiner ersten Frau.
Am 25. Juli 1912 hatte Friderike von Winternitz ihren ersten „unschicklichen“ Brief an den verehrten jungen Dichter geschrieben. Mit ihm begann eine lebenslange Freundschaft, die auch die Scheidung 1938 überdauerte. Friderike war damals noch mit ihrem ersten Mann verheiratet, Mutter zweier Töchter und schrieb, wie sie gleich bekannte, „auch“. Dass Zweig ihre Beziehung später lange Zeit verheimlichte, dürfte weniger an ihrer anfänglichen Illegitimität gelegen haben, als vielmehr an Zweigs Bedürfnis nach Unabhängigkeit.
Dieses zu respektieren wurde zunächst zu Friderikes Erfolgsrezept. Als „Lamm“, wie sie ihre Briefe unterschrieb, tolerierte sie Zweigs Liebschaften und Bordellbesuche, wurde dafür von „Stefan Pascha“ zu seinem „dauernden Oberhaserl“ ernannt, wie sie zufrieden im Tagebuch notierte. So wusste sie auch von seiner Parallelbeziehung zu einem französischen „Unterhaserl“ namens Marcelle. „Mein Brüderchen, denn nicht wahr, jetzt bist Du ganz mein Brüderchen, wenn Du diesen Brief hast und mit Deiner Freundin bist“, schrieb sie ihm stichelnd im Juli 1914 nach Paris. Nicht Friderike, der Kriegsausbruch setzte dem völkerverbindenden Dreieck ein Ende.
Zur Heirat kam es erst 1920. In den Salzburger Jahren entfremdete sich das Paar zusehends; der gefeierte Bestsellerautor flüchtete sich vor Frau und Festspieltrubel in Vortragsreisen durch ganz Europa. „Vor mir reist Werfel: wo ich lese, war er tags zuvor, und ich begegne ihm also nie, nur die gleichen Portiers bringen dem einen das Gepäck heraus und dem andern herein: ein Symbol des Betriebs!“ Seine Salzburger „Correspondenzverwalterin“ provozierte Zweig mit Hinweisen auf Hotelzimmer „mit gefährlich breitem Bett“; kein Wunder, dass Friderikes Antworten zunehmend verbitterter ausfielen.
Ende der zwanziger Jahre setzen Zweigs Altersdepressionen ein: „mir ist, als säßen die Schrauben lockerer in der Maschine: am besten wäre, sie im fünfzigsten Jahr ganz abzustellen und noch einmal den Versuch zu machen, die Welt zu erfahren, statt sie zu schildern.“ Bald darauf begannen die Jahre des Exils.
Oliver Matuschek: Stefan Zweig. Drei Leben – Eine Biografie. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 2006. 410 S., 9,95 Euro.
Stefan Zweig – Friderike Zweig: „Wenn einen Augenblick die Wolken weichen“. Briefwechsel 1912–1942. Herausgegeben von Jeffrey B. Berlin und Gert Kerschbaumer. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 2006. 440 S., 24,90 Euro.
|