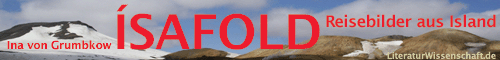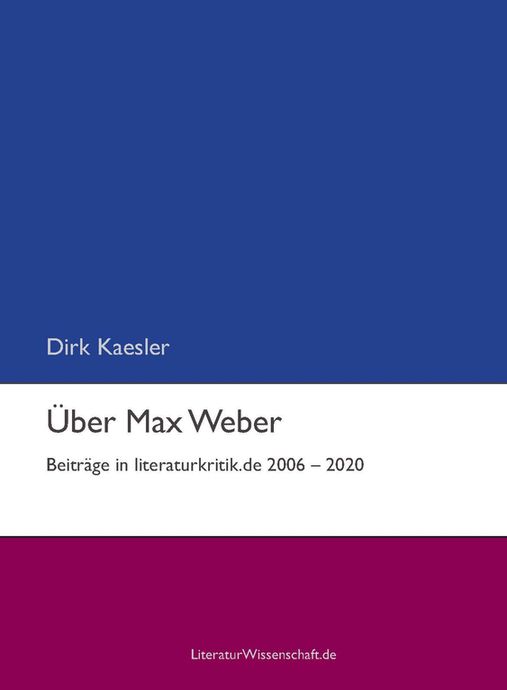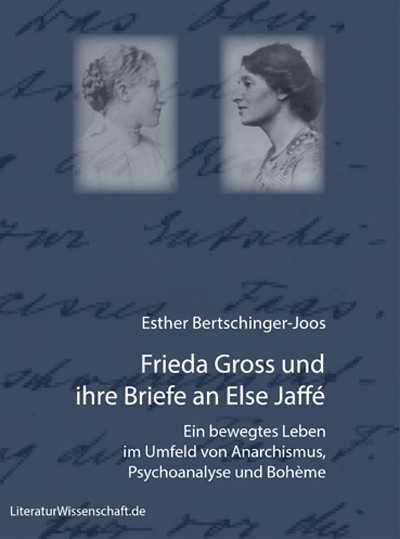Dr. Konrad Kirsch schrieb uns am 03.07.2007
Thema: Katrin A. Schneider: Die Blendung der Interpretation
Betrifft: die Rezension meiner Dissertation 'Die Masse der Bücher' in literaturkritik.de Nr. 4, April 2007
Sehr geehrte Redaktion,
"Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, ist das allemal im Buch?", musste schon Lichtenberg fragen.
Ihre Rezensentin ist offenkundig vom unbedingten Willen zum Verriss geleitet - was zur Folge hat, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe der Blendung und der mangelnden Sorgfalt auf sie selbst zurückfallen.
So erfahren Ihre Leserinnen und Leser - wenn überhaupt - nur sehr ungenügend, worum es in meiner Arbeit geht. Canetti und Intertextualität, ja - aber wie hängt beides miteinander zusammen? Hat die Inter- oder besser: Hypertextualität bei Canetti eine spezifische Funktion? Setzt er mit ihr seine Poetik um? Wie stellt sich diese Poetik dar? Lässt sich Canettis Werk über die Texte, auf die er sich bezieht, kontextualisieren - historisch, literarisch, philosophisch?
Keine dieser Fragen wird von Ihrer Rezensentin behandelt.
Statt dessen stellt sie Behauptungen auf, die sie nicht oder wenig stichhaltig belegt, und wenn sie argumentativ vorgeht, dann verfährt sie rein formalistisch, sie bläht kleine Ungenauigkeiten auf und macht ihre Kritik an einzelnen Punkten fest, die sie willkürlich herauspickt oder aus dem Zusammenhang reißt - und praktiziert damit, was sie mir vorwirft. Auf diese Weise enthält sie Ihren Leserinnen und Lesern die Konzeption des Projekts vor und entstellt seine Durchführung.
Dabei ist es gar nicht so schwer. Für Canetti geht es immer um Leben oder Tod. Der Tod ist sein größter Feind, und ihm kann man nur entrinnen, indem man sich permanent verwandelt. Das heißt, über je mehr Identitäten man verfügt, desto ferner ist man dem Tod. Der Ort, an dem diese Identitäten versammelt sind, ist die Masse. Das macht sie zu Canettis Utopie.
Er verräumlicht psychische Vorgänge und faßt umgekehrt körperliche Prozesse psychisch auf. Es gibt folglich nicht nur eine äußere Masse, sondern auch eine innere, psychische: die "Masse in uns", wie es in der BLENDUNG heißt. Aufgabe des Dichters ist es, mittels der Literatur diese innere Masse zu vergrößern und so das Lebenspotential des Lesers zu steigern.
Was für den Menschen gilt, gilt strukturell auch für Canettis Figuren: Auch in ihnen sind andere Figuren versammelt, auch sie haben eine Masse in sich, bestehend aus den Figuren der Weltliteratur. Die Konzeption seiner Figuren legt Canetti in dem Alptraum des Protagonisten der BLENDUNG offen: "Da zückt der rechte Jaguar einen Steinkeil und stößt ihn dem Opfer" - also Kien - "mitten ins Herz. [...] Entsetzlich: aus der aufgerissenen Brust springt ein Buch hervor [...] Das Opfer reißt die Brust weit, weit auseinander. Bücher, Bücher kollern hervor. Dutzende, hunderte, sie sind nicht zu zählen [...]".
Kien besteht also aus einer - Masse - von Büchern; sie machen das "Herz" von Canettis Figuren aus.
Mit diesen Büchern und ihrer Funktion beschäftigt sich der zweite Teil meiner Arbeit: die hypertextuelle Lektüre der BLENDUNG und Canettis Poetik.
Einige der dort behandelten Autoren, Stoffe und Motive sind: Platon, Rousseau, Hobbes, King Kong, Sophokles, die Bibliothek von Alexandria, Freud, Dante, Aristoteles, Giordano Bruno, Don Giovanni und der Steinerne Gast, der Totentanz, die Himmelsleiter, der Ur-Adam, Bergson und die Lebensphilosophie, der Salomonische Tempel und der Hohepriester, Shi Hoang Ti, die Chinesische Mauer und chinesische Begräbnisriten, der Erste Weltkrieg und der Volkskörper, Pinel, die Französische Revolution, Dionysos und die Frühromantik.
Mit schönem Gruß
Konrad Kirsch
|