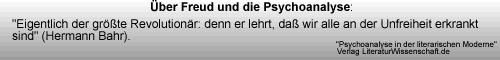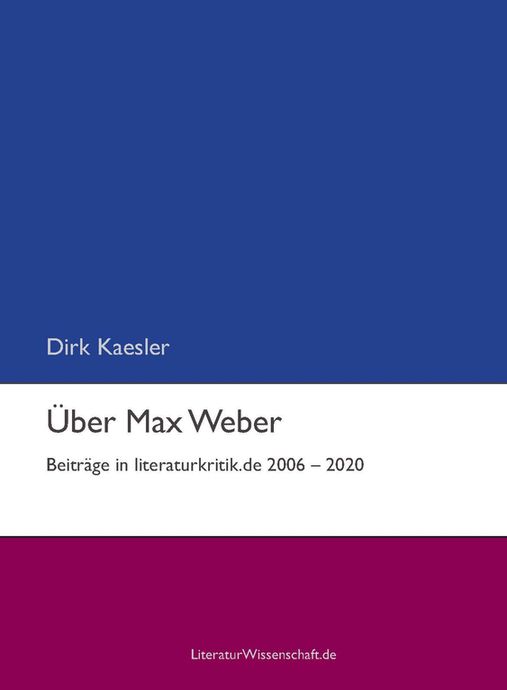Leserbriefe zur Rezension
Ein türkischer Literaturskandal in Deutschland?
Kritischer Kommentar zum Streit um Feridun Zaimoglus "Leyla" und Emine Sevgi Özdamars "Das Leben ist eine Karawanserei"
Von Norbert Mecklenburg
Mehmet Osmanoglu schrieb uns am 12.06.2006 Ich habe alle in Norbert Mecklenburgs Artikel erwähnten Streitschriften gelesen. Am meisten hat mir dieser, von Mecklenburg geschriebener gefallen. Das Märchen als Schlusssatz |
Osmanoglu Osman schrieb uns am 14.06.2006 ...Einigen scheint die unbequeme Art von Zaimoglu nicht zu gefallen. Und gerade das aber, gefällt vielen Leuten. Wir stehen hinter Zaimoglu, weil er sich nicht verbiegen lässt, wie die Keleks, Özdamars und Co., die Lügengeschichten erzählen und Randphänomene als Alltag darstellen, um nur eins zu erreichen: die Verkaufszahlen ihrer Bücher zu steigern. Aber das scheint momentan nicht zu funktionieren, weil die Menschen merken, wenn jemand Hysterie verbreiten will, um davon zu profitieren. Das würde man wohl als "geistige Prostitution" bezeichnen! |
Ayse Malatyali schrieb uns am 14.06.2006 Monika Maron schrieb in der FAZ (12.06.06) folgendes: |
Thomas Huber schrieb uns am 21.06.2006 Ich kenne und liebe die Bücher von Emine Sevgi Özdamar. Nachdem ich den sogenannten "Türkenkrieg" in den Feuilletons verfolgt habe, habe ich jetzt auch Herrn Zaimoglus Roman "Leyla" gelesen. Bei der Fülle an Übereinstimmungen in der Wahl des Sujets, der Konstruktion und weitgehend wörtlich übernommener Metaphern hätte man in der Schule sofort eine sechs wegen Abschreibens kassiert. Aber die deutsche Öffentlichkeit, besonders das deutsche Feuilleton sträubt sich mit allen Kräften, das Offensichtliche wahrzunehmen, nämlich, dass Frau Özdamars Roman "Das Leben ist eine Karawanserei" während Herrn Zaimoglus "dreimonatigem Schaffensrausches" auf dessen Knien gelegen haben muss. Wie kommt es zu dieser wundersamen kollektiven Erblindung? Die abstrusesten Erklärungsversuche werden unternommen, um wegzuleugnen, was man nicht wahrhaben will. Tanten tauchen aus dem türkischen Nebel der Vergangenheit auf, bald werden auch die Onkel kommen, ein "gemeinsamer kultureller Fundus" wird beschworen, als seien die Türken ein kleiner Eingeborenenstamm am Rande der Wüste, als hätten wir es hier mit zwei Märchenerzählern zu tun, die die gemeinsamen Geschichten und Mythen ihres Volkes von Lagerfeuer zu Lagerfeuer tragen und nicht mit einer Schriftstellerin, die einen Roman geschrieben hat und einen weiteren Schriftsteller, der ihre Geschichte einfach abgeschrieben hat. Wie kommt es zu dieser folkloristischen Verniedlichung? Herr Zaimoglu scheint ein so tiefes Bedürfnis der deutschen Öffentlichkeit zu befriedigen, dass man ihn zu einer bedrohten Art erklärt. Ein Provokateur und Bürgerschreck, der an rechten Knöpfen schraubt. Um größtmögliche Wirkung bemüht, radikalisiert und verzerrt er seine Figuren, die er aus eigener Anschauung nicht kennt. Der Vater aus "Das Leben ist eine Karawanserei" mutiert so beispielsweise zu einem fundamentalistischen Monster. Frau Özdamars sensible Innenschau der Charaktere hat hier ausgedient. Diese Gröbstzeichnung soll das öffentliche Bedürfnis nach Rache an den zu lange verzärtelten Immigranten befriedigen. Aufgrund seiner Herkunft ist Herr Zaimoglu das rechte Vehikel, um endlich die zu lange unterdrückten Ressentiments zur Ader zu lassen. Er ist bereit, jede Überzeugung für ein Stück Öffentlichkeit fahren zu lassen. Den skrupellosen Blick immer auf den eigenen Erfolg gerichtet, kostet es ihm nichts Frau Özdamar aus- und abzuschlachten. Vertreter des Feuilletons, wie Herr Hubert Spiegel sind hierbei seine willigen Vollstrecker. In seinem FAZ Artikel vom 10. Juni bezeichnet er Frau Özdamar als "Eroberin" und Herrn Zaimoglu als "Vollstrecker". Die Wortwahl erreicht Riefenstahlsche Höhen. Die nächste Plünderung wird auch schon vorbereitet, indem er das "Wohnheim" aus Frau Özdamars Roman "Die Brücke vom Goldenen Horn" zum legitimen Schauplatz für Zaimoglus geplante Fortsetzung von "Leya" erklärt. |
Maria de la Torre schrieb uns am 17.07.2006 Thema: "sich Unerlebtes wünschen" oder Zaimoglu vs. Özdamar |
Sönke Lundt schrieb uns am 19.02.2008 Der letzte Satz in Mecklenburgs "kritischer Auseinandersetzung" mit Zaimoglus Roman entlarvt den Verfasser dieser Zeilen dann doch als jemanden, der ganz offensichtlich eine - wie auch immer privat geartete - Antipathie gegen Zamoglu hegt. So etwas hat in einer sachlichen Auseinandersetzung mit einem Roman nichts, aber auch gar nichts zu suchen - auch wenn der Vorwurf gewisser literarischer Parallelen zu einem anderen Text im Raume steht. Diese vermeintliche "Pointe" hätte Mecklenburg sich besser für den Stammtisch aufgehoben ... |