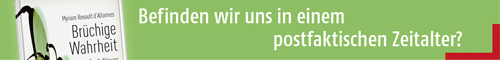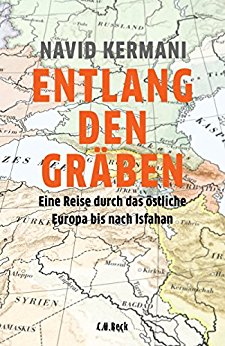Kein Weg aus der Erinnerung
Zwei Theaterstücke von Dea Loher handeln von der Rückkehr des Krieges
Von Kai Köhler
Der Krieg scheint noch fern. Ab und zu wird der Tod eines deutschen Soldaten in Afghanistan gemeldet, doch gemessen an den Verlustzahlen der beiden Weltkriege oder an der jährlichen Unfallstatistik scheint das Risiko gering. Doch kommt der Krieg unaufhaltsam ins Zentrum zurück: in Gestalt der Männer, die ihn erlebt haben und die Gewalt und ständiger Bedrohung ausgeliefert waren.
Am Anfang von Dea Lohers "Das letzte Feuer" betritt ein "Fremder", der sich als Kriegsheimkehrer entpuppen wird, ein Wohnviertel. Der Faktor von außen ist erprobtes dramatisches Mittel, die Widersprüche einer scheinbar stabilen Ordnung in Bewegung zu setzen. Hier spielt ein Zufall hinein: Der Fremde hilft einem Kind, dessen Fußball ein schadhaftes Ventil hat. Verzögerung oder Beschleunigung: Setzt diese kleine Störung die Katastrophe in Gang? Ein Auto rast vorbei, doch der erwartete Unfall bleibt aus. Das Kind läuft erst vor das Auto der Polizistin, die jenen Raser als vermeintlichen Attentäter verfolgt - in Wirklichkeit nur einen Freak, der sich, wie häufig zuvor, den Wagen seiner früheren Lehrerin, nunja, geliehen hat.
Zurück bleibt eine Gruppe von Trauernden, ein "Wir", das sich in epischer Rückschau vielstimmig des Geschehens versichert, aber auch in szenischer Vergegenwärtigung auf der Bühne agiert. Als wären Krieg und ein totes Kind nicht genug, hat Loher ihrem Personal einiges an Leid aufgebürdet: Die Eltern trauern nicht allein um ihren Sohn, sondern versorgen auch noch die an Alzheimer erkrankte Großmutter, die sich alle Augenblicke erkundigt, wann denn das Edgarchen zurückkomme und die so die Todesnachricht Mal um Mal zu formulieren zwingt. Schuldig fühlt sich der flüchtende Fahrer, dem die Justiz den Tod des Kindes anzulasten versucht und der sich in seinem Zimmer einschließt; dessen Mitbewohner und Liebhaber vereinsamt. Schuldig fühlt sich die ehrgeizige Polizistin ebenso wie die Lehrerin Karoline, krebsbedingt brustamputiert und im Verlauf der Handlung mit immer gigantischeren Brustprothesen aufwartend. Schuldig fühlt sich vor allem der vom Krieg gezeichnete Fremde, der noch am Unfalltag sich selbst bestraft und Nägel und Fleisch seiner Finger bis auf die Knochen abfeilt.
Das klingt nach geschmackvoller Provokation, nach Sensationen in "Bild"-Zeitungsart, avantgardistisch verklausuliert für gebildete Stände. Gewiss auch kann man jenen Gegenwartsdramatikern, die nach dem Vorbild des nun auch schon kaum mehr gespielten Heiner Müller eine Vorliebe für drastisch Körperliches haben, eine fragwürdige Neigung zu Blut- und Schauereffekten nicht absprechen. Es bleibt indessen eine entscheidende Frage, ob die Figuren zum Medium je vorzuzeigender Kruditäten reduziert werden, oder ob umgekehrt die Auseinandersetzung mit dem Kruden ihnen die Möglichkeit gibt, Charakter und Geschichte zu entwickeln.
Bei Loher ist letzteres der Fall. Sie führt ihre Personen miteinander und gegeneinander, gibt ihnen Entwicklungen und erlaubt ihnen Gesten liebevoller Zuwendung, die zuweilen befremdlich anmuten, die kaum je zu einem kurzen Glück und nie zum dauerhaften führen, die aber gerade als aus Leid entwickelte einen utopischen Zug bewahren. Der Tod des Kindes führt die Hinterbliebenen zu sich selbst, und das heißt: nicht unbedingt zum Angenehmeren, aber doch zum Ausbruch aus einer quälend gewordenen Gewohnheit.
Sprachlich liegt ein großer Text vor. In der Figurenrede ist zuweilen ein wenig Milieu angedeutet, doch nie so viel, dass naturalistischer Soziologismus drohte. Die Sprache ist gestisch, insofern sie Betonungen und damit ein Verhalten vorgibt - auch ein Verhalten auf der Bühne mit- und gegeneinander. Sie ist kontrolliert metaphorisch: kein expressionistischer Wildwuchs an Bildern überwuchert das Gemeinte, sondern wenige und genaue Motive strukturieren den Verlauf. Sinnfällig angedeutet werden sie zum Teil durch die Zeichnungen, über die die ehemalige Kunstlehrerin Karoline spricht: Es bleiben Sprachbilder, die den Verlauf spiegeln oder ihn vorwegnehmen.
Aber handelt es sich auch um großes Theater? Der Rezensent hat keine Aufführung gesehen und muss vermuten. Im Wechsel von epischem Bericht und szenischer Präsenz verbirgt sich ein Potential von Distanznahme und Berührung, das fruchtbar zu machen wäre. Zuweilen berührt ein grotesker Humor. Mehrfach wird ein Ineinander von Gewalt und Zärtlichkeit sinnfällig; kaum zu überbieten, auch in der Möglichkeit der szenischen Realisierung, wie der Vater des Kindes liebend seine kranke, den Enkel liebende Mutter im Bad ertränkt. Loher moralisiert nicht, sondern lässt noch der Brutalität ihre Schönheit und ihren ethischen Grund.
Das Fragwürdige aber ist, dass Geschichte und konkret der Krieg nur Anlass sind und individuelle Geschichten in Gang setzen. Die Vermittlung indessen von Geschichte und Geschichten, wenn sie überhaupt angestrebt war, gelingt nicht mehr. Darum aber wirkt der Text für die Lektüre richtig, aber für die Bühne vielleicht zu lang: weil zwar viel geschieht, jedoch nichts, was auf die Geschichte zurückwirkt. Es ist, als ob das kulturwissenschaftliche Paradigma der Erinnerung sich sein Theaterstück geschaffen hätte: Es wird nur noch erinnert. Zwar führt die Vergangenheit zu gegenwärtigen Vorgängen, doch erscheinen diese seltsam determiniert durch etwas, was seit langem über die Figuren verhängt ist.
Wie individuelle Geschichten und die große Geschichte nicht vermittelt werden können, das ist das Wichtige dieser Publikation; denn immerhin verschanzt sich Loher nicht im privatistischen Klein-Klein. Das dramaturgische Problem ist Zeichen einer gesellschaftlichen Lage, in der die große Geschichte als gestaltbare nicht ernsthaft erwogen wird. Eine solche Resignation lässt das Politische als Verhängnis erscheinen, das die Auftritte der Figuren determiniert.
Dass Geschichte als offener Verlauf, den es zu gestalten gilt, verstellt erscheint, wird noch mehr zum Problem des zweiten, motivisch verwandten Stücks, das sich in dem Band findet. "Land ohne Worte" ist, wie sich nur langsam und vermittelt herausstellt, eine Erinnerung an Afghanistan. Ein monologisierendes Ich war in "k.", Kabul vielleicht, und probiert Antworten auf die Frage, wie es dort gewesen sei. Wieder ist die erlebte Gewalt mit Bildern verknüpft; Überlegungen, wie das Ich, vielleicht eine Malerin, auf diese Frage antworten könnte, nehmen einen Großteil des Texts ein. Es ist zwar nicht obszön, auf die Kriegserfahrung mit der Frage nach dem Verhältnis von Körper und Fläche zu antworten; wer hier von Ästhetizismus redet, könnte auf Picassos "Guernica" als Muster avancierter und politisch engagierter Kunst verwiesen werden, wo eben die Verwandlung in Fläche das vom deutschen Bombenkrieg verursachte Chaos veranschaulicht.
Doch wird in "Land ohne Worte" zum Problem, dass derlei Bilder die Kriegsrealität doch nicht repräsentieren können: "ich kann die bilder nicht vergessen / bilder verstehen Sie / keine farben keine flächen nichts abstraktes / konkrete / szenen / concrete scenes". Und wenig später: "der krieg findet ja nicht im bild statt / die erfahrung die du machst / darauf kommts an / da gibts nichts zu verstehen". Daraus aber resultiert das notwendige - und als notwendig gestaltete - Scheitern eines Theatertexts, der im Modus der Erinnerung formuliert ist: denn die sprachliche Vergegenwärtigung der Erfahrung geschieht notwendig in der Sprache, und damit wird Erfahrung unweigerlich der Sinngebung unterzogen.
Es mag sein, dass dieser performative Widerspruch den Fortgang des Monologs befördert; und zugestanden ist auch, dass Loher jedes Wort wohl zu setzen versteht, in luzider Bewusstheit alles Geschwätzige vermeidet und einen wohl eher lyrisch zu nennenden Lesetext vorlegt. Doch ist erstens schwer vorzustellen, wie eine theatralische Vergegenwärtigung dem konzentrierten Text eine weitere Dimension zu verleihen vermag. Zweitens bleibt die Skepsis, ob hier nicht beträchtliche Mühe an eine Trivialität verschwendet wurde, nämlich dass die sprachliche Wiedergabe von Gewalt ihre Erfahrung niemals einzuholen vermag. Sprache ist deshalb darauf angewiesen, eine eigene Erkenntnisdimension zu schaffen, und das müsste hier, dem Anlass entsprechend, bedeuten: eine geschichtliche.
Die sprachliche Bewältigung von Gewalt war vermutlich schon Problem bei Griechenlands Perserkriegen - es ist historisch unspezifisch und reduziert die heutigen Konflikte zu bloßem Anlass. Wie das Besondere der Kriege nach 2001 theatralisch zu gestalten wäre, und zwar derart, dass nicht nur Leid und fernes Glück im Opfertum benannt würde, bleibt offen. Es ist die Frage nach dem Verhältnis von Politik und Vernunft und damit die nach einem politisch verantwortlichen Handeln, die einer gänzlich anderen Dramaturgie bedürfte. Dea Loher, indem sie kleinlichem Privatismus ausweicht und wesentliche Konflikte zum Thema macht, erzwingt diese Frage; sie erzwingt sie, das ist ihr weiteres Verdienst, auf außergewöhnlichem sprachlichem Niveau. Eine Antwort indessen vermag ihre Theaterästhetik nicht zu geben.
|
||