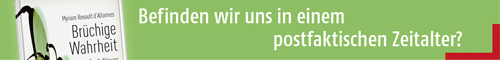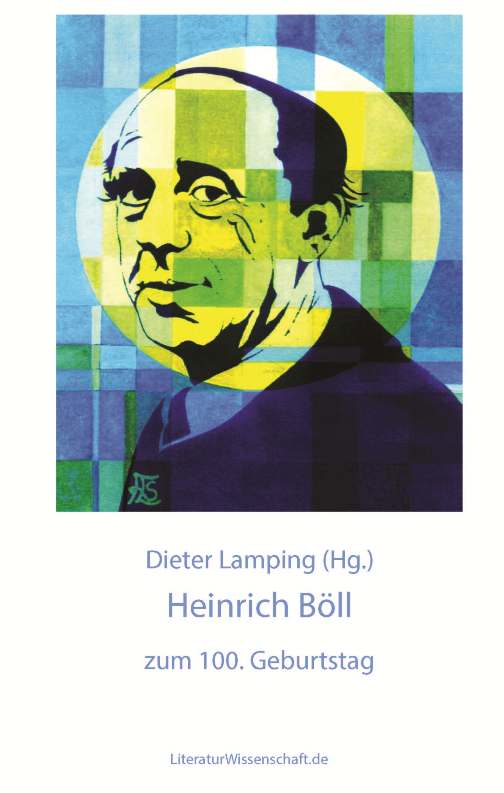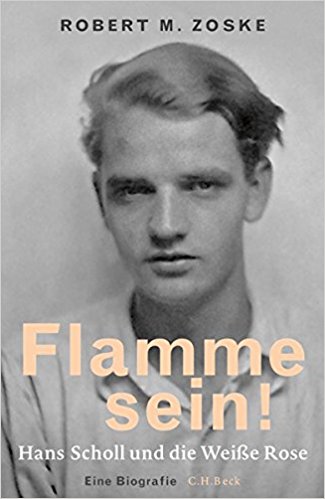Zu dieser Ausgabe
In der Juni-Ausgabe 2005 von literaturkritik.de erschienen drei Beiträge zu Jean Paul Sartres 100. Geburtstag. Albert Camus, dem die November-Ausgabe 2013 ihren Schwerpunkt mit ebenso vielen Beiträgen widmet, war acht Jahre jünger. Beide haben zusammen wie gegeneinander in den zwei Jahrzehnten nach dem Ende des 2. Weltkriegs das literarische und intellektuelle Leben geprägt wie kaum jemand sonst. Und zwar weit über Europa hinaus. Denn Paris war in der Nachkriegszeit ein Knotenpunkt internationaler Vernetzungen des literarischen Lebens, ein Zentrum auch der spanischen, lateinamerikanischen und osteuropäischen Gegenwartsliteratur. Mit engen Verflechtungen von Literatur und Philosophie hatte der Existenzialismus nach 1945 eine weltweite Ausstrahlungskraft mit unterschiedlichen Ausprägungen.
In den Intellektuellen- und Bohemekreisen der europäischen Metropolen wurde er trotz der individualistischen Selbsteinschätzung rasch zur kollektiven Mode. Man trug sie, in einem Milieu, für das sich die Grenzen zwischen Universität und Caféhäusern verflüssigten, mit dem Jargon einschlägiger Begriffe bis hin zur schwarzen Kleidung, in einer Mischung von melancholischer und anarchischer Gestimmtheit demonstrativ zur Schau. Angeregt von den im Kontext der literarischen Moderne entstandenen oder intensiv rezipierten Philosophien Sören Kierkegaards, Friedrich Nietzsches, Edmund Husserls und vor allem Martin Heideggers sowie der Psychoanalyse Sigmund Freuds, artikulierte der Existenzialismus, der schon mit dem Titel seiner maßgeblichen Zeitschrift „Les Temps Modernes“ seinen Anspruch auf Modernität erhob, eine Stimmung der Ungeborgenheit in einer unheimlichen, rätselhaften und fremden Welt, der Geworfenheit in eine absurde, das heißt widersinnige, der menschlichen Logik widerstreitende Wirklichkeit, der Konfrontation mit Tod, Scheitern und Schuld, des Ekels, der Vereinzelung und der Angst. Im Verlust tradierter Sinngebungen und Orientierungsmuster sieht das Subjekt sich zurückverwiesen auf die eigentliche Substanz des eigenen Seins: die Existenz.
Der Verlust metaphysischen und sozialen Halts, der eine Reaktion auf die beschleunigten Modernisierungsprozesse im 20. Jahrhundert war und sich mit den Desillusionierungen angesichts totalitärer Ideologien verstärkte, bedeutete dabei zugleich auch eine Befreiung von falschen, den Erfahrungen des Absurden ausweichenden Denk- und Glaubensmustern zu einer spezifisch menschlichen Würde. Sie besteht nach Camus‘ einflussreichem Essay „Der Mythos von Sisyphos“ (1943) in einer Haltung, die aus der erkannten Sinnwidrigkeit des Lebens nicht etwa die Konsequenz des Selbstmords zieht, sondern ihr ein heroisches Dennoch entgegensetzt. Sisyphos ist dazu verurteilt, unablässig einen Felsblock den Berg hinaufwälzen, von dessen Gipfel der Stein wieder hinunterrollt. Denn die Götter „hatten mit einiger Berechtigung bedacht, daß es keine fürchterlichere Strafe gibt als eine unnütze und aussichtslose Arbeit.“ In Camus‘ Version ist Sisyphos ein tragischer Held und ewiger Rebell, der der Absurdität seiner Existenz bewusst standhält, sich mit selbstbewusster Verachtung über sein Schicksal erhebt, es sich zu eigen macht und damit den Göttern enteignet. „Der Kampf gegen den Gipfel“, so endet der Essay, „vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.“
In dem 1947 erschienen Roman „Die Pest“ erscheint Sisyphos in veränderter Gestalt. Der Protagonist im Kampf gegen die Seuche, von der eine Stadt an der algerischen Küste heimgesucht wird und die dabei als Metapher für die Schrecken des 20. Jahrhunderts fungiert, ist Arzt. An die Stelle einer individualistischen, selbstbezogenen Revolte gegen das Absurde ist eine Form des Widerstands getreten, die sich mit dem Leiden der anderen solidarisiert. Das Ethos der Rebellion wird in der Metapher des Arztes zum Ethos humanen Engagements, das der wiederkehrenden „Herrschaft des Schreckens“ trotzt. Der Roman, der weltweite Resonanz fand, stilisiert sich am Ende selbst zum „Zeugnis“ dessen, was alle jene bewundernswerten „Menschen vollbringen müssen, die trotz ihrer inneren Zerrissenheit gegen die Herrschaft des Schreckens und seine unermüdliche Waffe ankämpfen, die Heimsuchungen nicht anerkennen wollen, keine Heiligen sein können und sich dennoch bemühen, Ärzte zu sein.“
Die existenzialistische Philosophie des Absurden inspirierte in den 50er Jahren das „Absurde Theater“, das, anders als die Stücke von Camus oder Sartre, aus der Negation tradierter Sinnorientierungen die formalen Konsequenzen zog – oft mit Effekten grotesker Komik. Das Warten auf fehlende Sinngebung wird zu einem charakteristischen Kennzeichen. In dem 1953 in Paris uraufgeführten Stück „Warten auf Godot“, das zu einem der größten Theatererfolge der Nachkriegszeit wurde, unternahm der irische, in englischer und französischer Sprache schreibende Autor Samuel Beckett, der sich 1937 in Frankreich niedergelassen hatte, den paradoxen Versuch, die Statik des vergeblichen Wartens und der Langeweile zu dramatisieren. Hatte Camus den vergeblich wiederholten Anstrengungen seines Sisyphos noch heroischen Ernst zugeschrieben, so setzt Becketts Stück gleich zu Beginn vergleichbare Bemühungen in clowneske Belanglosigkeit um. Die wiederholten Versuchen des Landstreichers Wladimir, sich die Schuhe auszuziehen, enden in dem Eingeständnis, mit dem der Dialog beginnt und zugleich schon ein Resümee des ganzen Textes ausgesprochen ist: „Nichts zu machen.“
Mit dem absurden Theater, das in Becketts „Endspiel“ (1957) seine wohl radikalste Ausformung findet, kippt der tragische und erhabene Ton des Existenzialismus ins Tragikomische um. Unter dem Einfluss Kafkas und Becketts entstanden die schwarzen „Komödien der Bedrohung“ des englischen Dramatikers Harold Pinter. In der deutschsprachigen Literatur sind es zunächst Wolfgang Hildesheimer, der 1960 in seiner „Rede über das absurde Theater“ dieses „eine Parabel über die Fremdheit des Menschen in der Welt“ nannte, und vor allem Friedrich Dürrenmatt, später auch Thomas Bernhard, die, vom Existenzialismus geprägt, dem Absurden grotesk-komische Aspekte abgewinnen. Nicht weniger als in die französische Literatur hat sich der Existenzialismus in die deutschsprachige Literatur der Nachkriegszeit eingeschrieben. Konfrontationen mit persönlichen oder kollektiven Katastrophen in „Grenzsituationen“ (ein Begriff des deutschen Existenzphilosophen Karl Jaspers), zu denen vor allem Erfahrungen des alle überkommenen Sinngebungen in Frage stellenden Todes gehören, soziale Außenseiterfiguren, meist scheiternde Aufbrüche aus vertrauten, jedoch fragwürdigen Gewohn- und Sicherheiten in die freie Ungewissheit „eigentlicher“ Existenz prägten die Themen, Motive und Handlungsmuster zahlloser Werke.
Die Nachwirkungen des Existenzialismus reichen im deutschsprachigen Raum weit über die fünfziger und sechziger Jahre hinaus. Ingeborg Bachmann, die 1949 in ihrer Dissertation zur philosophischen Heidegger-Rezeption die Unzulänglichkeiten einer Philosophie der Angst kritisierte und ihr am Beispiel eines Sonetts von Baudelaire programmatisch eine Literatur der Angst entgegensetzte, erzählt in ihrem späten „Todesarten“-Zyklus von vielfältigen Angstarten. Und auch in Thomas Bernhards Werken bleiben seit seinen Romanen „Frost“ (1963) und „Das Kalkwerk“ (1970) die renitenten, doch oft scheiternden Anstrengungen der verrückten und kranken Protagonisten, sich gegenüber ichfremden, „uneigentlichen“ Rollen- und Naturzwängen selbst zu behaupten, bis hin zum opus magnum „Auslöschung“ (1986) kennzeichnend.
Im Existenzialismus vereinten sich die neuzeitlichen Autonomieansprüche des Subjekts mit Erfahrungen komplexer Abhängigkeiten und bedrohlicher Katastrophen. In den letzten Kriegs- und in den ersten Nachkriegsjahren entsprach die existenzialistische Suggestion, in jedem Augenblick neu entscheiden, in jeder Situation das Vorgegebene im Hinblick auf neue Selbstentwürfe negieren zu können, kollektiven Bedürfnissen in einer historischen Situation, in der der Krieg von vielen als übermächtige und undurchschaubare Katastrophe empfunden wurde, in der man nach einem Neuanfang suchte und bereit war, sich unabhängig von alten, fragwürdig gewordenen Sinnangeboten aktiv zu engagieren.
Ein Beitrag in dieser Ausgabe zum 100. Geburtstag von Albert Camus befasst sich mit der verblassenden Aura des Autors, mit den Widersprüchen zwischen dem medial verbreiteten Bild von ihm und seinem Werk, das mit philologischer Hartnäckigkeit weiter erschlossen wird. Ein Sammelrezension widmet sich vier neuen Camus-Biographien. Und ein dritter Beitrag zeigt am Beispiel Ingeborg Bachmanns, wie intensiv der literarische Dialog zwischen deutschsprachigen Autorinnen oder Autoren und Camus sein konnte.
Rund 100 weitere Artikel in dieser Ausgabe helfen unseren Leserinnen und Lesern hoffentlich wieder, angesichts einer unüberschaubaren und nie versiegenden Flut literarischer und kulturwissenschaftlicher Neuerscheinungen orientierende Anregungen zu erhalten, was zu lesen sich lohnt – und was nicht. Die Mühen der Redaktion, ihrer Mitarbeiter und vielleicht auch der Lesenden gleichen dabei zuweilen denen von Sisyphos. Aber stellen wir sie uns nach jeder neuen Ausgabe als glückliche Menschen vor!
Thomas Anz