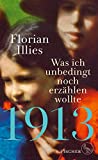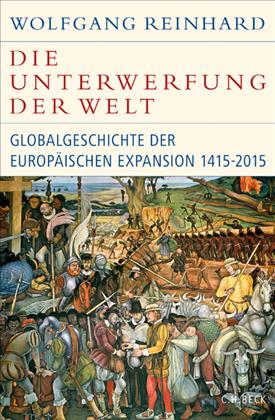Eine Bewunderung epochaler Sturzflüge
Florian Illies vermittelt Impressionen aus dem eigentümlichen Jahr 1913. Erneut.
Von Manuel Bauer
Natürlich ist wieder fast die ganze Rasselbande versammelt: Marcel Duchamps, Rainer Maria Rilke, Igor Strawinsky, Hermann Hesse, Pablo Picasso, Marcel Proust, Gottfried Benn, Franz Kafka und Felice Bauer, Alma Mahler und Oskar Kokoschka, Franz Ferdinand und der alte Kaiser, Lou Andreas-Salomé und Sigmund Freud – und viele andere mehr. Erneut durchleben sie dieses Wahnsinnsjahr, erneut überschreiten sie die Schwelle zwischen einer Welt von gestern und der Moderne, erneut folgen wir ihnen mit beklommenem Amüsement. Aber etwas ist anders – und zwar deswegen, weil eigentlich alles genauso ist wie zuvor.
Als Florian Illies, der mit Generation Golf (2000) nachgewiesen hatte, einer der versiertesten Chronisten der Gegenwart zu sein, 2012 sein Buch 1913. Der Sommer des Jahrhunderts veröffentlichte, war das ein Coup. Ein ungeheurer Bestseller, auch das, vor allem aber ein geniales Puzzle aus Splittern und Impressionen des Vorkriegsjahres, die in einem mitreißenden, doch verspielt-ironischen Ton erzählt und miteinander verwoben wurden. Leitmotive, die die scheinbar disparaten Bruchstücke aus dem kulturellen und politischen Leben zusammenhielten und ein Panorama einer historischen Konstellation entwarfen, waren unter anderem ästhetische und politische Revolutionen, Untergang, Vatermord und andere ödipale Verhältnisse, wissenschaftlicher Fortschritt und der Aberglaube, den die Zahl „13“ auslöst. Hinzu kam die immer durchschimmernde Einsicht, dass die großen Protagonist*innen der Moderne reichlich verschroben waren. Illies machte aus den kurzen Informationen, Einblicken, Anekdoten und Zitaten ein famoses Mosaik, eine Art dokumentarischen Roman des Nebeneinander, der virtuos an der Grenze von faktualistischer Kulturgeschichte und literarischer Montage tänzelt.
Lässt sich ein solcher Coup wiederholen? Kann eine innovative Idee auch als serielles Produkt überzeugen? Insbesondere dann, wenn eben nicht etwas Neues erzählt wird, das auf das Bisherige folgt, sondern noch einmal das gleiche Jahr narrativ nachvollzogen wird? Illies wagt ein Experiment: Mit 1913. Was ich unbedingt noch erzählen wollte legt er eine Fortsetzung vor, die weder Sequel noch Prequel ist. Eine Fortsetzung als Supplement dessen, was schon da war, als Schließung von Lücken, die als solche gar nicht wahrgenommen wurden, als Wiederholung des gleichen Schemas, das mit teilweise neuen, nicht selten aber auch mit bereits bekannten Geschichten gefüllt wird. Eine Fortsetzung, die zwar mehr, bei Lichte besehen jedoch wenig anderes erzählt, die dem reichhaltigen Stoff dieses bemerkenswerten Jahres kaum neue Facetten oder Leitsemantiken abgewinnen kann. Wie lässt sich von ästhetischen Aufbrüchen und Innovationen erzählen, wenn man sich im Erzählen selbst wiederholt?
Wie schon der Vorgänger folgt auch dieser Band chronologisch dem Verlauf des Jahres, weshalb es in zwölf Kapitel unterteilt ist, von Januar bis Dezember (diesmal ihrerseits auf vier Großabschnitte verteilt, von Winter über Frühling und Sommer bis Herbst). Diese strukturelle Wiederholung ist das eine Problem des Buches – ein Problem, das zugleich darauf verweist, dass es einer allzu sicheren Wette folgt: Wer das erste Buch mochte, wird dieses auch gut finden. Kein Wagnis einer Neuerung einzugehen, ist hier natürlich das Wagnis, denn wie erzählt man davon, was man schon mal erzählt hat? Dabei kommt das zweite Problem ins Spiel: Will man die Wiederholung im Großen im Kleinen, also bei den einzelnen Episoden, vermeiden, müssen Geschichten des Jahres 1913 herangezogen werden, die im ersten Buch nicht verwertet (allerdings auch nicht vermisst) werden. Selbst die geneigtesten Leser*innen können sich des Verdachtes nicht erwehren, dass nach einer Art „Best of“-Kompilation nun gleichsam „More Best of“ aus dem gleichen Zeitraum geboten wird. Weniger wohlwollend formuliert: Die Lektüre ist vom Verdacht geleitet, dass hier ein alter Zettelkasten umgestülpt und eine Resteverwertung betrieben wird, von der Unterstellung, dass dieses neue Buch aus kaschierten Parerga und Paralipomena besteht.
Leider bleibt es nicht beim bloßen Verdacht. Diverse Episoden sind eher Füllmaterial als unverzichtbar, nicht wenige sind auch, in unwesentlich abweichender Gestaltung, schon im ersten Buch verarbeitet, teils sogar mit den gleichen Formulierungen und Zitaten. Generell verhält es sich mit dem verwendeten Material trivialerweise so, dass es schwerlich ein anderes 1913 zum Vorschein bringt – die großen Strömungen des Jahres werden von diesem zweiten Buch zementiert, die vormals herausgearbeiteten Leitsemantiken werden aber nicht von neuen dominanten Motiven flankiert. In diesem Zusammenhang sind auch kompositorische Schieflagen zu bemerken: Dem April etwa sind 34 Seiten gewidmet, der März hingegen wird mit sechs Druckseiten abgehandelt – weil der Zettelkasten nicht mehr hergab?
Wenn es aber teils kaum Neues, teils manifeste Redundanzen zu verzeichnen gilt: Wieso dann überhaupt dieses Buch? Der dringliche Untertitel Was ich unbedingt noch erzählen wollte ist wenig plausibel, wenn unter dieser Überschrift auch solche Geschichten erzählt werden, die bereits erzählt wurden. Bemerkenswert ist auch, dass sich ein „Ich“ in den Vordergrund drängt, wo beim ersten Band von einem „Sommer des Jahrhunderts“ die Rede war. Die Logik der Auswahl scheint weniger im Gegenstand selbst begründet als im subjektiven Willen des Verfassers. Dieser Wille zum Erzählen schiebt sich vor die Ökonomie des Textes und die bestechende schlanke Komposition, die den Vorgängerband auszeichnete. Das ist nicht verboten, lässt aber doch die Frage virulent werden, ob dadurch intersubjektive Interessen erreicht werden – und wieso die „neuen“ Geschichten, wenn der Autor sie doch „unbedingt noch erzählen“ wollte, nicht ohnehin Aufnahme in das erste Buch fanden. Womöglich, weil es ohne das Zusatzmaterial funktionierte? Weil dieses Material dem Wertniveau des Buches nicht entsprach?
Gewiss, manche Gedanken schlagen aus dem gebotenen Erzählmaterial, und gerade aus scheinbar Abwegigem, genau die Funken, die schon im ersten Buch ein wohliges Knistern erzeugten und die, wichtiger noch, kurze Schlaglichter auf die großen Zusammenhänge eines epochalen Einschnittes werfen können. Nicht minder aber stellt sich der Effekt ein, dass sich die Geschichten im Anekdotischen erschöpfen, ohne dass sich durch ihr Zusammenspiel mit anderen Impressionen ein Erkenntnismehrwert ergäbe. Die wiederholten Wiederholungen tun ihr Übriges: Über das „Watschenkonzert“ etwa erfährt man nichts Neues, und die Beziehungskonflikte zwischen Kafka und seiner Verlobten, Hesse und seiner Frau oder zwischen Freud und C. G. Jung sind – auf der konkreten Handlungs- ebenso wie auf der Symbolebene – schlichtweg auserzählt.
Aus all diesen Mäkeleien ergibt sich eine andere Frage: Ist ein Buch, das für sich betrachtet durchaus geistreich, kurzweilig und unterhaltsam wäre, als misslungen zu bezeichnen, weil es sich im Ruhm eines erfolgreichen Vorgängers sonnt, selbst aber keine zusätzlichen Schlaglichter werfen kann? Weil es mithin nicht für sich betrachtet werden kann? Da das Buch von der Beachtung dieses Vorgängers zehrt und von dessen symbolischem Kapital eine Art Kredit bekommt, der eine Bestseller-Garantie ist, muss es sich auch an den Maßstäben messen lassen, die es durch diese Anlehnung selbst evoziert. In gewisser Weise muss daher der Akt der Lektüre ein doppelter sein: Zum einen liest man die Fortsetzung von 1913. Der Sommer des Jahrhunderts, zum anderen aber 1913. Was ich unbedingt noch erzählen wollte. Sieht man das Buch im Kontext des Vorgängers und der Marktmechanismen, die eine solche Fortsetzung begleiten, fällt das Urteil ungnädig aus.
Als isoliertes Phänomen (wohlwissend, dass man sich dafür gewissermaßen literarkritische Scheuklappen anlegen muss) ist das Buch keineswegs langweilig, belanglos oder misslungen. Sollte also eine Lektürehaltung möglich oder erwünscht sein, die zumindest temporär ausblendet, dass das Buch an seinem Vorgänger zu messen ist, dann ist festzustellen, dass 1913 als ein – um einen Untertitel von Hans Ulrich Gumbrechts kulturwissenschaftlicher Studie 1926 auszuleihen – „Jahr am Rand der Zeit“ erscheint. Illies versammelt allerlei Eindrücke und Kuriositäten, die unter anderem aufblitzen lassen, dass 1913 das „Abheben vom Boden“ als „ein radikaler, fundamentaler Akt der Moderne“ zelebriert wurde. Ein Akt der Moderne freilich, der seine dialektische Kehrseite in sich trug, sodass als Motto des Jahres „Sturzflug als wesentlicher Fortschritt“ benannt wird. Vielleicht müssen wir uns Ikarus als die heimliche Symbolfigur des Jahres 1913 vorstellen.
Illies ist immer auf der Suche nach zündenden Pointen und nach symbolträchtigen Ereignissen. Unter anderem berichtet er von einem Personenzug, der auf einer noch geöffneten Drehbrücke unterwegs war und gerade noch bremsen konnte: „Die Lokomotive, schwebend über dem Abgrund – das ungestüm Vorwärtsstürmende auf schwankendem Boden, das surreale Verkeiltsein zischen sicherem Gleis und sicherem Tod einer fortschrittsgläubigen und technikgläubigen Gegenwart: das ist das Bild des Jahres 1913.“ Genau dieses bedrohliche Schweben ist es, wodurch in diesem von Illies durchleuchteten Jahr „die Vergangenheit und die Gegenwart und die Zukunft unauflöslich miteinander verschränkt“ wurde. Der große Fall nach dem Schwebezustand indes sollte bald folgen.
Mehr als andere aber ist 1913. Was ich unbedingt noch erzählen wollte wieder ein Buch über Kunst und Literatur. Zustimmend zitiert Illies Paul Klees Aussage, das Jahr 1913 sei „eine einzige Liebeserklärung an die Kunst“, zudem sei es „das erste Jahr der Gegenwart“. Die Aufarbeitung einer scheinbar fernen Vergangenheit steht mithin im Dienste der Gegenwartsdiagnostik. So betrachtet, ist es umso beklemmender, wie hellsichtig etwa der Dichter Alfred Lichtenstein die sich anbahnende Katastrophe benennt, wenn er in einem Gedicht den kommenden „Sterbesturm“ und „das große Morden“ beschwört – ebenso beklemmend wie die diametral entgegengesetzte Prophezeiung aus Norman Angells Buch The Great Illusion, das Illies im Vorgängerband süffisant zitiert und dem zufolge „das Zeitalter der Globalisierung Weltkriege unmöglich mache, da alle Länder längst wirtschaftlich zu eng miteinander verknüpft seien“.
Das Buch endet mit der Symbolfigur der Zäsur, die das folgende Jahr bringen sollte, mit Erzherzog Franz Ferdinand, der „hofft, dass die Geburt seines Kindes ein gutes Omen für das neue Jahr 1914 werden möge“. Illies evoziert dadurch, ohne ihn zu erwähnen, einen späteren Buchtitel eines seiner Protagonisten: Freuds Das Unbehagen in der Kultur – schließlich können wir die Impressionen aus dem vorwiegend kulturellen Leben des Jahres 1913 ob unseres Wissens um das Kommende bei aller heiteren Schrulligkeit nicht anders als mit Unbehagen lesen. So behaglich es uns der Autor in den 1913-Büchern auch eingerichtet hat: Beide sind (trotz nicht zu leugnenden Unterschieden der literarischen Qualität) in gleichem Maße Dokumente des Unbehagens, da die katastrophalen Folgen des faszinierenden Schwebezustandes immer allzu bewusst sind.
|
||