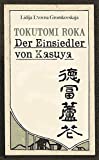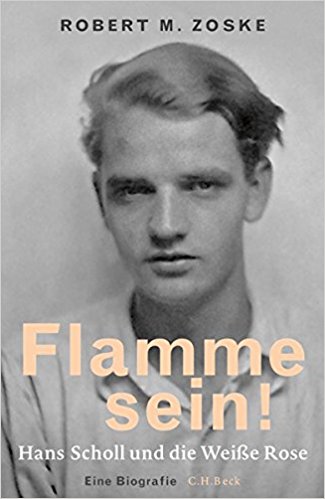Wie er fühlte, was er las
Eine russische Annäherung an den japanischen Schriftsteller Tokutomi Roka
Von Lisette Gebhardt
Der Band Tokutomi Roka. Der Einsiedler von Kasuya stellt einen anspruchsvollen Vermittlungsversuch dar: Er behandelt den im 21. Jahrhundert schon fast jede Beachtung entbehrenden japanischen Schriftsteller Tokutomi Kenjirô (1868-1927), genannt Roka, der mit seiner Lebensspanne und seinem Schaffen für die japanischen Epochen Meiji (1868-1912) und Taishô (1912-1926) steht. Komplex gestaltet sich die Vermittlung auch deshalb, weil die von dem promovierten Strahlenbiologen Peter Raff, Arzt und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens (OAG), ins Deutsche übersetzte Biographie des Autors von der russischen Japanologin Lidija Gromkovskaja (1933-1994) stammt; sie wurde als Teil der Reihe „Schriftsteller und Gelehrte des Ostens“ (Pisateli i učenye vostoka) im Jahr 1983 verfasst, was die Publikation ihrerseits als zeitgeschichtlichen Beitrag zu einer – so noch wenig wahrgenommenen – internationalen japanbezogenen Literaturwissenschaft und ihrer verschiedenen Forschungskulturen kennzeichnet.
Biographismus und Emographie
In der zeitgenössischen Japanologie, die aus strategischen Gründen meist der anglophonen identitätspolitischen Werkexegese anhängt, ist der biographistische Ansatz mit seinem positivistischen Paradigma, das von einer Prägung literarischer Texte durch biologische, soziale und historische Faktoren ausgeht, kaum mehr die bevorzugte Methode. Im Falle des „vergessenen“ Roka erweist er sich als zweckdienlich. Vor aktuellen Tendenzen, Wissenschaft in „leichte“ Formate zu pressen und sie einer als Kunden verstandenen Schar zu umwerbender Wissenskonsumenten in Gestalt unterhaltsamer Häppchen anzutragen, muss die mit persönlichen Daten, Details und Dramen angereicherte Biographie im dezent bibliophilen Retrogewand geradezu das Mittel der Wahl sein. Insofern wäre dem „Einsiedler von Kasuya“ die verdiente Wiederbelebung zuteil geworden.
Roka zeigt sich hier als durchaus sanguinischer Charaktertyp, getrieben von heftigen Gefühlen, bedrückt durch von ihm als einschränkend empfundenen Umständen, meist unzufrieden, unleidlich, schwierig. Der fünf Jahre ältere, von der ursprünglich in Kumamoto beheimateten Familie Tokutomi in der Rolle des künftigen Sippenführers stets bestärkte Bruder Sohô (1863-1957), erfolgreicher Gründer der Verlagsgruppe Min′yûsha, Journalist, reformerischer Denker, Historiker, später eher konservativ eingestellt und Mitglied des Japanischen Reichstags, bleibt lebenslang ein Rivale im schöpferischen und im politischen Bereich. Sohô gibt im Verlag den Ton an, Roka darf vorerst nur Korrektor sein. Er hadert mit seinem Schicksal: „Ich bin zugeschüttet mit der laufenden Tagesarbeit in der Redaktion. Wenn ich niemals mehr die blauen Berge und Gewässer sehen kann, vertrockne ich und werde stumpfsinnig.“
Leidenschaft hatte Roka zunächst für das schöne Mädchen Hisae entwickelt, die aber nicht seine Braut wird und – wie viele junge Frauen in der Ära der Kameliendame – früh stirbt. Der traurige Verehrer begibt sich auf Reisen. Gromkovskaja kommentiert: „Was hatte ihn zu seinem Vagabundenleben getrieben? Verzweiflung? Natürlich. Und er wollte sich zudem von Hisae losmachen, von der Liebe zu ihr, von seiner Sinnestäuschung. Ihr erhabenes romantisches Bild konnte man nur dadurch zerstören, dass man etwas Gegensätzliches tat.“ Schließlich wendet sich Roka ganz der Literatur zu. Jede Lektüreerfahrung bedeutet den Kontakt mit einem Geistesuniversum, der beflügelt und neue Ziele im Leben offenbart. Über die Begegnung mit der Literatur Turgenjews sagt er: „Ich war erschüttert. Gibt es denn irgendwo eine derart wunderbare Welt?“ Tolstoj bedeutet eine weitere tiefe „Erschütterung“. Der an der Universität Dôshisha in Kyôto ausgebildete, christlich geprägte, für Gleichberechtigung, Frieden, Freiheit und Demokratie eintretende Roka durchlebt in den verschiedenen Lebensphasen einschlägige Sinn- und Glaubenskrisen. Dabei zeigt er sich als Weltbürger. Er unternimmt 1906 eine Reise, die in erster Linie dem Besuch bei Tolstoj gilt: Mit dem Schiff fährt er von Yokohama nach Port Said, Jaffa, um weiter über Jerusalem und Konstantinopel nach Odessa zu gelangen. Am 30. Juni kommt er bei dem verehrten Tolstoj an, was den Zurückgekehrten zu religiösen Theorien anregt und ihn motiviert, die Lebensweise eines Landmanns zu führen, freilich mit mäßigem Erfolg, auch in diesem Punkt seinem Vorbild – als „ästhetisierendes Bäuerlein“ – sehr ähnlich.
Rokas Welt
Ein besonderes Sendungsbewusstsein erfüllte viele der zeitgenössischen Publizisten, vor allem, wenn sie wie Roka an christlichen Universitäten studiert hatten. Seine Botschaft wurde jedenfalls rezipiert und man suchte den Erfolgsautor gerne zu Hause auf. Die Verfasserin der Biographie erklärt an dieser Stelle: „Die Pilgerreise zu Tolstoj, der Entschluss, sich auf dem Lande niederzulassen, all dies steigerte noch die Popularität Rokas, und die Besucher gaben sich bei ihm die Türklinke in die Hand. Die Jugend kam zum Lebenslehrer, die Journalisten auf der Suche nach Sensationen.“
Roka hatte sich durch die Weltliteratur und das damals auschlaggebende Schrifttum gelesen, zu Fragen der Zeit und zu Größen wie Tolstoj einführende Texte publiziert. Mit drei Romanen wurde er selbst als Schöpfer von Bestsellern, ja als Modeautor berühmt: Hototogisu (1899; Der Kuckuck) war sein erster Erfolg. Ferner schrieb er Shizen to jinsei (1900; Die Natur und das Leben des Menschen), die Erzählung Kaijin (1900; Schutt und Asche), Junrei kikô (1906; Notizen einer Pilgerreise), die Naturbetrachtungen Mimizu no tawakoto (1913; Dummes Regenwurmgeschwätz), den Roman Kuroi me to chairo no me (1914; Schwarze Augen und braune Augen), Shi no kage ni (1917; Im Schatten des Todes), Shinshun (1918; Neuer Frühling), die Biographie seiner Tante, Takezaki Nobuko (1923), die Bände Nihon kara Nihon e (1920; Von Japan nach Japan) und Fuji (1925-1928; der letzte Band erschien posthum); Der Berg Fuji (in Koautorschaft mit Tokutomi Aiko) sowie den für die damalige Situation im Zeichen der von zahlreichen engagierten Denkern als ungerecht beurteilten Hinrichtung des Sozialisten Kôtoku Shûsui (1871-1911) und elf seiner Gesinnungsgenossen ebenso repräsentativen wie einzigartigen Essay Muhonron (1910; Über die Rebellion). Seine politischen Ansichten, die den Imperialismus Japans ablehnten, fand er während eines Korea-Aufenthalts nachdrücklich bestätigt, was im Oktober 1913 auf dem Bahnhof Seoul zu einem Bruch mit dem Bruder führte: „Alles, was er in Korea sah, legte sich ihm wie ein Stein auf die Seele.“
In seinem Schreiben verfolgte Roka den damals gängigen Stil der Wahrhaftigkeit bzw. des aufrichtigen Selbstbekenntnisses, der sich aus der japanischen Romantik, dem japanischen Naturalismus und dem inspirierenden Beichtmodus der christlichen Praxis in spezifischer Form entwickelt hatte. Das Schicksal des Individuums und seiner Konflikte mit den Normen der Gesellschaft bildete das Thema der nicht selten melodramatisch angelegten Romane. In Schwarze Augen und braune Augen (1918) manifestiert sich der autobiographische Zug der damaligen Prosa – in einem Ausmaß, das sogar eine ernsthafte seelische Krise der Frau Rokas hervorrief, beschwor der Autor mit diesem Werk noch einmal seine frühe Liebe Yamamoto Hisae. Die russische Japanologin hält zu dieser Episode fest: „Für das Buch […] zahlte Aiko einen hohen Preis. Nach einem Nervenzusammenbruch verbrachte sie vier Monate im Krankenhaus. Man fürchtete um ihr Leben, und Roka, der sich an allem schuldig fühlte, betete inbrünstig um die Genesung seiner Frau [….].“ Wenig später, unternimmt er mit ihr eine Weltreise, die im Buch Von Japan nach Japan dokumentiert wurde. Nur sechs Jahre danach stirbt der Dichter im Alter von 59 Jahren an einem Herzinfarkt. Mit dem Bruder, der an sein Krankenlager eilt, konnte er sich noch versöhnen.
Sechs Kapitel, sechzig Jahre
Gromkovskaja berichtet vom Leben des Dichters in sechs Kapiteln. Ihre Bestandsaufnahme zu Roka geht davon aus, dass die Kenntnis der Biographie, der Erlebnisse, Einflüsse sowie der Produktionsumstände der Werke und der politischen Gemengelage den Zugang zu einem Werk ermöglicht, das an die ideengeschichtlichen Signaturen der Dekaden um 1900 gebunden ist. Die Weltanschauung bzw. die Ambition, eine eigene zu formulieren, die man zum Besten der Nation erdacht hatte und an Schüler weitergeben konnte, beschäftigte viele Gebildete in Japans Moderne. Politische und „spirituelle“ Phasen lösten einander ab; die Intellektuellen dachten das eine Mal erstaunlich konservativ, das andere Mal wieder sehr progressiv. Traditionsüberwindung und der Wille, bisherige politische und gesellschaftliche Strukturen zu verändern, waren eine wichtige Triebfeder für die jungen Generationen der Meiji-Ära. Dazu reichte die fiktionale Literatur Handlungsanweisungen an, ebenso die Schriften populärer Denker wie Emerson (1803-1882) und Carlyle (1795-1881). Mit letzterem fanden sich die Ambitionen der Ära formuliert im Bild des „Helden“, der um Wissen und Erkenntnis rang, sprichwörtlich unter Einsatz seines Lebens, wenn man prototypische Figuren der Zeit betrachtet, etwa den Philosophiestudenten und Poeten Fujimura Misao (1886-1903). Der Held konnte Prophet und Priester sein, Dichter und Schriftsteller. Den Rang des vates strebte unter anderen Aspiranten auch Kitamura Tôkoku (1868-1894) an, ein Kind der Zeit wie Roka.
Wer also wissen will, wie sich ein Schriftstellerleben in der Meiji-Ära gestaltete, wird von Gromkovskaja zufriedenstellend unterrichtet. Ihr Ziel war das anschauliche Bild eines Menschen, der die Modernisierung Japans zur Sache seiner geistigen Betätigung machte. Die Verfasserin gesteht ein, der Bedeutung der russischen Literatur für Roka stärkere Aufmerksamkeit gewidmet zu haben, und hebt an manchen Stellen sogar einen gewissen Gleichklang des japanischen und des russischen literarischen Sentiments hervor. Dazu konstatiert sie freimütig: „Gerne räumen wir ein, dass man die Dinge auch anders sehen kann“ – eine philologische Geste, deren Großzügigkeit man wertschätzen sollte.
Die russische Verfasserin betont schon mit dem Titel, den sie für die Biographie wählt, den inneren Abstand Rokas zu den Geschehnissen seiner Zeit, zu den Staatsgeschäften, in die Sohô involviert war. Auf dem Buchcover von Der Einsiedler von Kasuya ist zudem zu lesen, dass es einzig Roka war, der den Mut hatte, sich öffentlich gegen die zwölf Todesurteile zu stellen, die die japanische Regierung im Zuge der sogenannten Hochverratsaffäre (taigyaku jiken), der Verschwörung zur Ermordung Kaiser Meijis von 1910, erließ. Nicht alleine aufgrund dieser Zusammenhänge, die die vorliegende Einführung zum Autor beleuchtet, bleibt eine Relektüre Tokutomi Rokas wünschenswert. Nach erneutem Studium der Texte wäre eine Biographie, die den gegenwärtigen state of the art repräsentiert, in der Tat eine Aufgabe für die Japanologie unserer Tage. Dass die Arbeit an den interessanten literaturwissenschaftlichen Primär- und Sekundärquellen in diesem Fall von einem Mediziner geleistet wurde, mag seinerseits als Signum der Zeit gelten.
|
||