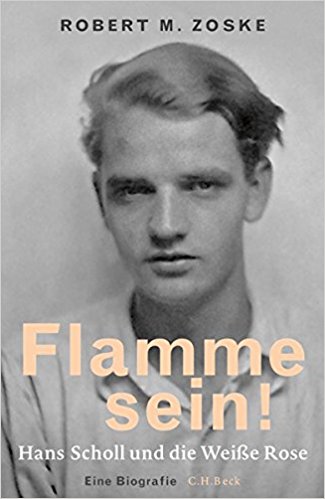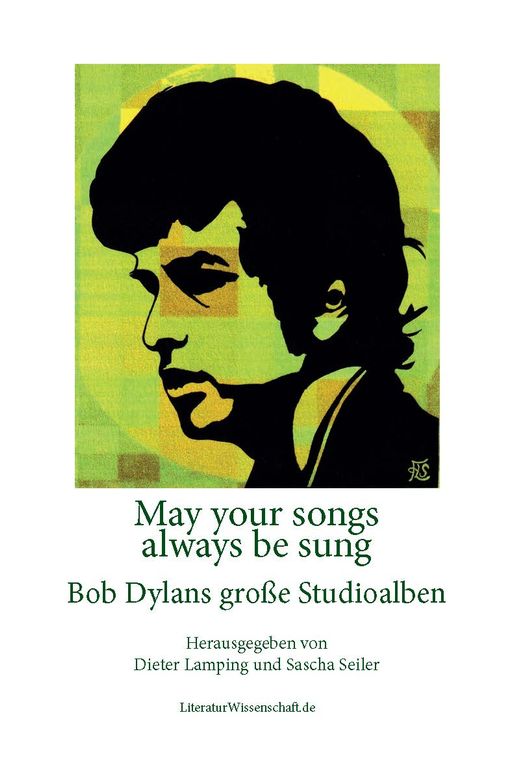Das große Staunen
Wie man die Wunder im Kleinen entdeckt, erkundet Alphonse Karr in „Reise um meinen Garten“
Von Matthias Hennig
Das Vorbild aller Gärten ist der Zaubergarten, das Vorbild aller Zaubergärten ist das Paradies. Die Gärtnerei, wie jeder der einfachen Berufe, hat kultischen Hintergrund. (Ernst Jünger)
Blumig trägt das Buch seinen Einband zu Markte. Einen Einband, um den sich Kamelien, Jasmin, Azaleen und purpurrote Wachsglocken in zweidimensionaler Plattheit ranken. Zur großen Garten-Plauderstunde sollen sie einladen. Zum Flanieren und Schauen. Zum Blüten-in-die-Hand-Nehmen, zum Blättern, zum Schmunzeln. Doch etwas durch die Blume will der Autor damit nicht sagen. Im Gegenteil: Blätter nimmt er nur vor den Mund, um daran zu riechen oder Insekten darauf zu beobachten. Einen ganzen Tag im Garten auf dem Bauch liegend, den anderen auf dem Rücken. Mit Muße reist Alphonse Karr in seinen Garten, mit Muße wachsen ihm die originellsten Einsichten, die Muße diktiert sie erkenntnisreif in seine Finger. Ein ganz und gar leichtes und tiefes Buch gelingt ihm dabei.
Alphonse Karr (sein Nachname verrät die deutsche Abkunft) tritt mit seiner Reise um meinen Garten (1845) in die Fußstapfen von Xavier de Maistres Voyage autour de ma chambre (1794) oder Montesquieus Briefroman Lettres Persanes (1721). Wozu in die Ferne reisen, wenn der Mikrokosmos des Eigenen so viel staunenswerter ist? Wenn man statt fernen Inseln das große Rad der ganzen Welt auch vor der eigenen Haustür entdecken kann? Unter diesen Vorzeichen reist Karr in seinen eigenen Garten, ein ganzes Jahr lang, Natur und Mensch stets in unterhaltsame Geschichten einbindend. Vom Geißblatt bis zum Veilchen, von der Zypresse bis zur Erle, vom Frosch bis zum Zaunkönig, vom Gallinsekt bis zum Menschen.
Dann braucht es weder Schiffszwieback und Fernrohr, noch monatelange Reisestrapazen auf einem großen Ozean, wenn der eigene Garten, mit Vesperbrot und Mikroskop bewaffnet, zum Ozean und Dschungel werden kann. Wozu ein irregeleiteter Anhänger der fixen Idee sein, es gebe menschliche Menschenfresser in exotisch-fernen Ländern, nur nicht bei uns? Wenn man nur ein paar Schritte tun muss, um ‚Anthropophagen‘ dabei zuzusehen, wie sie sich auf das menschliche Fleisch stürzen und ihr blutiges Mahl halten?
In diesem Moment bin ich umgeben von einem Völkerstamm wirklicher Anthropophagen, die, in Anbetracht ihrer Größe, den Menschen nicht in einer Mahlzeit verspeisen, sich aber dennoch gierig an seinem Blut gütlich tun; ich bin mitten unter ihnen, und ich bleibe da, ich beobachte sie, ich studiere ihre Sitten; ich opfere mich für die Belehrung der anderen Menschen auf!
Schon mit dem kleinen Wörtchen ‚wirklich‘ entlarvt Karr en passant eine fixe Idee der Kolonialzeit. Einen Angsttrick, der die phantasmatische Idee von blutrünstigen ‚Wilden‘ schürt und dabei allein den Zweck hat, die Europäer als kultiviertere Menschen moralisch über vermeintlich menschenfressende Völkerstämme zu erheben. Jene Europäer, die handfeste Ausbeutung und Unterwerfung unter dem Deckmäntelchen des Studiums fremder „Sitten“ verstecken – zum Zwecke der „Belehrung“ des heimischen Publikums. Der wiederum die „Belehrung“ der unterworfenen Völker folgte – erst mit Waffengewalt und Versklavung, später mit Lehrerstock und Zwangsassimilation. Die phantasmatische Idee von menschenfressenden Völkerstämmen ist nichts weiter als ein aufgeblasener ‚Elefant‘ – ein ‚Elefant‘, den Karr zur Mücke macht. Kann diese doch schließlich mit Fug und Recht beanspruchen, Menschen zu verspeisen.
Als Pflanzen- und Tierbeschauer ist Karr ein Lustseher und Lusthörer, ein Naturflaneur und Genussriecher, der von sich selbst verkündet: „Ich bin der gleichzeitig sesshafte und herumwandernde Reisende“. In seinem Buch ist es nicht der Forschungsreisende, der Expeditionen unternimmt; vielmehr ist es die Natur, die reist: im Wechsel der Jahreszeiten, in der Verpuppung und in der Verwandlung, im Fressen und Gefressenwerden. Als Hobbygärtner, Botaniker und Entomologe ist Karr nie Dilettant – ganz im Gegensatz zu den Bouvards und Pécuchets seiner Zeit. Flaubert dürfte sich bei ihm auch die Idee zum Wörterbuch seiner schicken Ideen und Gemeinplätze abgeschaut haben (Gustave Flaubert: Dictionnaire des idées recues, 1913), wenn sie nicht dem intellektuellen Klima Frankreichs und dem Zeitgeist entstammt. Denn auch wenn Karr lässig mit Fachwissen zu jonglieren weiß, mikroskopiert und wohlsortierte Fachlexika zu erkennungsdienstlichen Zwecken verwendet: nie werden seine Geschichten zur hölzernen Wissenschaft, die klassifiziert und schubladisiert.
Ansonsten wird Klartext geredet, aber nicht grob, sondern fein, appetitlich und zu einer wohlschmeckenden Infusion abgerundet. Die große Garten-Plauderstunde ist kein laues Palaver mit altbackenen Gemeinplätzchen beim Kaffeekranz (Ach, diese Trockenheit in diesem Jahr! Sind Ihre Apfelblüten auch erfroren? Haben Sie schon mein selbstgemachtes Quittengelee probiert?). Nein, geistreiche Unterhaltung! Mit Verve und Eleganz werden gegnerische Schwachstellen so schonungslos offengelegt, dass man ihr kein Wort davon übel nimmt. Karrs Spott ist nie ätzend; seine Satire nicht verbissen; sein Florett treffend, aber nicht ehrabschneidend. Auf geht‘s: die Menschenfresser warten schon im heimischen Garten! Lesen Sie dieses augenöffnende Buch, das lange genug auf seine Übersetzung ins Deutsche warten musste!
|
||