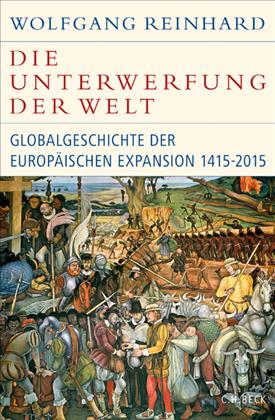Zwischen ideologischer Bevormundung und literarischem Eigensinn
Sebastian Weirauch bringt eine Anthologie von Abschlussarbeiten der Absolventen des Leipziger „Instituts für Literatur“ aus den Jahren 1955 bis 1993 heraus
Von Rainer Rönsch
In der Anthologie Experimentierfeld Schreibschule (Wallstein Verlag) stellt Herausgeber Dr. Sebastian Weirauch erstmals literarische Abschlussarbeiten der Autoren des DDR-Literaturinstituts „Johannes R. Becher“ von dessen Gründung 1955 bis zur Abwicklung 1993 vor und kommentiert sie.
Das „Institut für Literatur“ in Leipzig wurde 1955 auf Beschluss der SED gegründet, um „die ideologische und künstlerische Ausbildung der Schriftsteller zu fördern“. 1958 erhielt es Hochschulstatus, ein Jahr später den Namen des Dichters und ersten DDR-Kulturministers Johannes R. Becher (1891–1958). Interessanterweise bezweifelte Becher, dass man literarische Kompetenz erlernen könne. Bis zu seinem Ende im Jahre 1993 – das durch Proteste erzwungene Fortleben ab 1995 unter neuen gesellschaftlichen Bedingungen steht auf einem anderen Blatt – war das Literaturinstitut Leipzig die einzige Ausbildungsstätte für Autoren im deutschsprachigen Raum. In den drei Studienrichtungen Lyrik, Prosa und Dramatik wurden hier rund 1.000 Studenten ausgebildet, unter ihnen viele heute prominente Schriftsteller.
Angesichts der Absolventenzahl leuchtet ein, dass für die Anthologie eine Auswahl unter den Abschlussarbeiten zu treffen war. Alle Texte wurden mit Zustimmung der Autoren aufgenommen, manche auf deren Wunsch nur zum Teil. Die Arbeiten einiger namhafter Absolventen fehlen aus unterschiedlichen Gründen.
Herausgeber Dr. Sebastian Weirauch ist als Wissenschaftler für die Erschließung des Textarchivs des Instituts zuständig. Er stellte bei der Auswahl der literarischen Abschlussarbeiten die Vielfalt der Formen und Themen heraus, auch um dem Vorurteil zu begegnen, am Institut wären „am Busen der Partei“ hauptsächlich dogmatische Texte oder langweilige Geschichten aus der „sozialistischen Produktion“ entstanden.
Zugleich stehen die Arbeiten exemplarisch für die gesellschaftliche und literarische Entwicklung von der Institutsgründung 1958 bis zur Abwicklung 1993. Der Band ist in fünf Sektionen unterteilt, von den 1950ern bis zu den 1990ern. Summarisch lässt sich zur Entwicklungslinie sagen, dass auf Texte aus der Aufbauphase die Ankunftsliteratur und der Neue Subjektivismus folgen, sodann der Eskapismus mit mythischen und fantastischen Ansätzen und schließlich die Abkehr von ideologischer Gängelei durch den Pluralismus experimenteller Schreibweisen. Die von Weirauch gewählten Beispiele belegen, wie die Schreibenden ab den Sechzigern zunehmend zu ästhetischer Autonomie finden.
Jede der fünf Sektionen wird mit einem Zitat aus einer Abschlussarbeit charakterisiert; die Quellenangaben hierzu findet man im Kommentar. Die Texte und ihre Kommentierung ergeben eine faszinierende Gesamtschau auf den literarischen Ertrag des Instituts.
Zugleich finden sich für alle Zeitabschnitte überraschende Erkenntnisse. Beispielhaft sei das für die 50er-Jahre gewählte Zitat genannt: „Der Marxismus beschäftigt nur unsere Hirne.“ Da dürfte sich so mancher ehemalige DDR-Bürger fragen, ob diese Aussage damals eine Chance auf Veröffentlichung hatte. Denn die Lehre von Marx, laut Lenin angeblich „allmächtig, weil sie wahr ist“, sollte nach dem Willen der Partei im Kampf um die Herzen und Hirne der Menschen siegen. Das Zitat stammt aus dem Gedicht Portrait Walter G., das 1959 beim Mitteldeutschen Verlag Halle in der Gedichtsammlung Guten Morgen, Vaterlandsverräter von Karl-Heinz Jakobs erschien. Das lyrische Ich bekennt, dass wie der Marxismus auch die Arbeit und die Liebe nicht bis zu seinem Herzen vordringen, weil das Gefühlsleben durch die Last der Vergangenheit blockiert ist. In der DDR war Jakobs vor allem als Autor des verfilmten Bestsellerromans Beschreibung eines Sommers (1961) und später durch seinen Protest gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann bekannt.
Diese Anthologie mit ihrem umfangreichen wissenschaftlichen Apparat ist eine Fundgrube für jeden, der wissen möchte, welche Freiräume am Institut trotz ideologischer Bevormundung bestanden oder geschaffen wurden. In der noch zu schreibenden Geschichte des Literatur-Instituts wird die Rolle der Lehrkräfte in diesem Prozess, auch als Mentoren einzelner Schriftsteller, zu bewerten sein.
Das Versprechen des Titels Experimentierfeld Schreibschule wird vom Herausgeber eingelöst. Er liefert die kundige und faire Bewertung eines problematischen Experiments, das im Kommentar als „Spannungsfeld von regelpoetischer Normierung und künstlerischem Eigensinn“ definiert wird.
Den Texten und ihren Autoren widerfährt Gerechtigkeit ohne Aufwertung oder Abwertung. Letztere haben Ostdeutsche auch im literarischem Bereich erfahren müssen – man denke an den Umgang mit Stefan Heym und Christa Wolf. Die differenzierte Beurteilung der bis zu 65 Jahre alten Texte durch einen Wissenschaftler der Generation, für die die staatliche Einheit Deutschlands selbstverständlich ist, stimmt optimistisch für die künftige Bewertung des Anteils der DDR-Autoren an der deutschen Literaturgeschichte.
Die Lektüre der Anthologie führt zu Einsichten, die sich einer einseitigen Beurteilung entgegenstellen. Das Institut für Literatur „Johannes R. Becher“ war offenbar weder „Kaderschmiede der SED“ noch „Schule der Dissidenten“, sondern ein in sich widersprüchlicher, produktiver Organismus. Die Veröffentlichung richtet sich nicht nur an Wissenschaftler, sondern an das breite Publikum. Ihr ist zu wünschen, dass sie von vielen Lehrern für Deutsch und Geschichte zu Rate gezogen wird. Auch von älteren Pädagogen in den östlichen Gefilden, wo aufgrund einseitiger Ausbildung mancherorts ein verzerrtes Bild von der DDR-Literatur vermittelt wird.
|
||