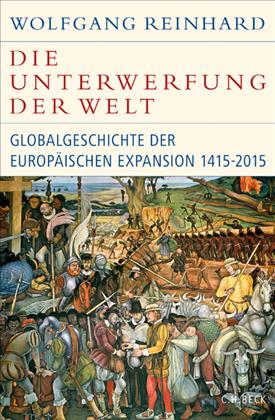Wenn Frauen erwachen!
Johanna Wybrands Untersuchung „Der weibliche Aufbruch um 1900“ bietet Erhellendes zur Generationalität als Erzählparadigma von Autorinnen der Jahrhundertwende
Von Rolf Löchel
Als die Erste Frauenbewegung gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch hierzulande erstarkte, schlug sich das in den Erzählungen, Novellen und Romanen etlicher Literatinnen nieder. Unter ihnen nicht wenige, die sich zugleich einen Namen als Protagonistinnen der Bewegung gemacht hatten wie etwa Hedwig Dohm, die bereits seit einigen Jahrzehnten aufsehenerregende Essays gegen pastorale und andere AntifeministInnen publizierte und in der Frauenemanzipationsbewegung „eine der größten Umwälzungen der Weltgeschichte“ erkannte. Nicht anders war es in Werken von Schriftstellerinnen wie Gabriele Reuter, die mit den Zielen der Bewegung zumindest sympathisierten. Hinzu kamen emanzipatorische und antiemanzipatorische Romane von Literatinnen, die der Frauenbewegung mal mehr, mal weniger oder auch gar nicht nahestanden. Helene Böhlaus Roman Halbtier etwa lässt sich durchaus feministisch interpretieren, allerdings distanzierte sich die Verfasserin im Vorwort zu einer der zahlreichen Auflagen selbst explizit von der Frauenbewegung. Franziska zu Reventlow rang zwar ihr Leben lang um ein emanzipiertes Leben, das sie weitab jeglicher Konvention führte, und ging mit den Münchner Feministinnen Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann zum Baden an die Isar oder besuchte sie zuhause. In ihren Essays schlug Reventlow jedoch dezidiert antifeministische Töne an. Lou Andreas-Salomé wiederum wurde von Hedwig Dohm den AntifeministInnen zugeschlagen. Und dies durchaus mit guten Gründen. All diese Autorinnen sind auch heute noch nicht vergessen und zumindest einige ihrer Schriften noch immer im Buchhandel erhältlich.
Anders liegen die Dinge im Falle von Leonie Meyerhof, die nicht nur in ihrem bedauerlicherweise heute ganz unbekannten Roman Töchter der Zeit die Emanzipationsbestrebungen ihrer Geschlechtsgenossinnen thematisierte. Daher ist es umso begrüßenswerter, dass Johanna Wybrands in ihrer Studie Der weibliche Aufbruch um 1900 nicht nur Werke bekannter Autorinnen untersucht, sondern auch Meyerhofs zu Unrecht vergessenen Roman.
Im Zentrum von Wybrands Arbeit steht „Generationalität als Erzählparadigma“ in den literarischen Werken der genannten Schriftstellerinnen. Ausgehend von der These, „dass mit den Imaginationen weiblicher Jugend einerseits generationelle Semantiken im Erzähltext verhandelt werden, das Erzählen als Reflexionsfigur des fiktionalisierten Aufbrechens der Frau andererseits mitstrukturiert“ wird, arbeitet Wybrands heraus, ob und wie die Autorinnen den „Generationsbegriff“ als „Instrument“ heranziehen, „[m]it dem die eigene lebensweltliche wie literarhistorische Umbruchssituation als konfliktueller Wechsel von Tradition zu Innovation erfasst werden kann“. Dabei versteht sie den gesellschaftlichen Entstehungskontext der Quellentexte „nicht nur als ‚Hintergrund’“, sondern fasst das „partikulare[.] Verhältnis zwischen Kontext, Kultur und Macht als ineinander verschränkte Matrix“.
In den untersuchten Werken findet die „identitätsstiftende Funktion der Generation“ ihren literarischen Ausdruck sowohl in „intergenerationellen Auseinandersetzung[en]“ zwischen Töchtern und Müttern wie auch in der „intragenerationellen Kommunikation gleichaltriger Frauenfiguren“ der jüngeren Generation. Nicht selten handelt es sich bei diesen gleichaltrigen Protagonistinnen um Schwesternpaare. So etwa im Falle von Hedwig Dohms Roman Christa Ruland, Leonie Meyhofers Töchter der Zeit, Böhlaus Halbtier und Lou Andreas-Salomés Ma. An ihrem Beispiel beleuchtet Wybrands, „wie Autorinnen um 1900 auf das Spiel mit Gegensätzlichkeit und Ähnlichkeit, biologischer ‚Schwesternschaft’ und ethischer ‚Schwesterlichkeit’ zurückgreifen, um Fragen nach Möglichkeiten und Hemmnissen weiblicher Identitätsbildung zu thematisieren“.
Auf welche Weise und mit welchen Mitteln die Schriftstellerinnen „den weiblichen Aufbruch“ zu Beginn der Moderne als „Generationenerfahrung“ darstellen, analysiert Wybrands anhand von Reuters Aus guter Familie und Ilse Frapans Wir Frauen haben kein Vaterland, in dem die Protagonistin im Zuge ihres Emazipationsunternehmens in eine „fremde Stadt“ zieht. Am Beispiel von Franziska zu Reventlows Ellen Olestjerne, Helene Böhlaus Halbtier und an Gabriele Reuters Novelle Gunhild Kersten zeigt die Literaturwissenschaftlerin auf, „wie die Literatur von Autorinnen um 1900 den Konflikt um weibliche Subjektwerdung inhaltlich zuspitzt, indem sie die Jugendphase als Lebensabschnitt imaginiert, der für die ‚höheren Töchter’ nicht länger die Akzeptanz der bestehenden Geschlechtsrollenidentität bedeutet“.
Im Mittelpunkt der Untersuchung aber steht Hedwig Dohms aus den Romanen Schicksale einer Seele, Sibilla Dalmar und Christa Ruland bestehende Trilogie Drei Generationen, kann Wybrands an ihnen doch „paradigmatisch“ zeigen, „wie gerade der spielerische Umgang mit ‚weiblich’ konnotierten Erzählweisen Brüche und Kontinuitäten weiblichen Erzählens respektive weiblicher Autorschaft evoziert“ und Dohms drei Romane dabei zugleich „erstarrte literaturgeschichtliche Traditionslinien “ unterlaufen. Die Trilogie umfasst eine erzählte Zeit von nicht weniger als 70 Jahren und kann somit „ein großes Diskursfeld eröffne[n]“.
Während Schicksale einer Seele „die paradoxe Sprechsituation der Frau als problematisches Verhältnis von Sprechen und Nachsprechen, Schreiben und Abschreiben mehrfach und auf unterschiedlichen Ebenen“ reflektiert, kann die Protagonistin des zweiten Romans ihre Situation als Frau in einer patriarchalen Gesellschaft zwar bereits „klar erkennen“, ohne diesen „Übergangsstatus“ jedoch schon „für die Veränderung der eigenen Lebenssituation nutzen“ zu können. In beiden Romanen führt der „Generationenkonflikt“ zwischen Mutter und Tochter noch nicht zur Emanzipation letzterer, sondern endet vielmehr in der „Tradierung des weiblichen Lebensentwurfs“. Wie Wybrands herausarbeitet, macht Dohm das „auch metatextuell in der Wahl des Erzählsettings“ deutlich. „Aus heutiger Sicht revolutionär“ sei allerdings die „Erkenntnis“ der Protagonistin des zweiten Romans, „dass ein gesellschaftlich konstruierter Geschlechtscharakter als ‚natürliche Bestimmung’ der Frau konzipiert wird“. Damit präfiguriere Dohm „die rund hundert Jahre später entstehende dekonstruktivistische Geschlechterforschung“. Der die Trilogie abschließende Roman Christa Ruland schließlich inszeniere „den weiblichen Aufbruch in die Moderne als generationsspezifische Herausforderung aus weiblicher Perspektive“. Dabei wechsele die anders als in den beiden vorherigen Romanen nunmehr „auktoriale Erzählinstanz“ ihre „Fokalisierung immer wieder auf verschiedene Figuren“ und bediene sich nicht selten einer „ironisch-distanzierte[n] Tonlage“. Zwischengeschaltete „Brief- und Tagebuchpassagen, zitierte Aufsätze und eine Vielzahl von intertextuellen Verweisen“ dynamisierten die Erzählung. Die titelstiftende Heldin des Romans ist es denn auch, die es als erste der Dohmschen Frauenfiguren wagt, den Weg der Emanzipation zu beschreiten.
Wurde Dohms Roman von der Münchner Gesellschaft als Schlüsselroman gelesen, in dem sich mancher und manche wiederzufinden und allzu negativ dargestellt glaubte (Dohms Tochter Hedwig Pringsheim hatte darunter nicht wenig zu leiden), so wird Reventlows Ellen Olestjerne noch immer allzu oft autobiographi(sti)sch interpretiert. Wybrands befleißigt sich dieser weitverbreiteten und letztlich misogynen Lesart der Werke von Schriftstellerinnen keineswegs, auch „missverst[eht]“ sie den Erstling der Autorin „nicht als Zeugnis einer Selbstrechtfertigung und Selbststilisierung“ Reventlows oder gar als deren „Versuch, den eigenen unkonventionellen Lebensweg zu legitimieren“. Vielmehr interpretiert sie den „Entwicklungsweg der Titelheldin als intergenerationell ausgefochtenen Kampf um Selbstbestimmung“, bei dem es sich um eine „Strategie“ der Schriftstellerin handele, mit der sie „wesentliche antibürgerliche Markenzeichen konturiert“.
Ein Vergleich mit Dohms Romanen lässt zudem einen gravierenden Unterschied im Verständnis weiblicher Emanzipation der beiden Schriftstellerinnen erkennen. Während Dohms Trilogie die Frauenfeindlichkeit der „geforderte[n] Rückbesinnung der Frau auf [ihre] biologische Reproduktionsfähigkeit“ als der „originär ‚weibliche[n]’ Schaffenskraft“ erkennt und kritisiert, „präsentier[t]“ Reventlow „alleinerziehende[.] Mutterschaft“ als „eigenwilligen Emanzipationsentwurf“. Nicht zu Unrecht moniert Wybrands „Reventlows durchaus naive Haltung“, die offen lasse, „wie die alleinerziehende Mutterschaft finanziert werden soll“.
Einen eigenen Abschnitt widmet die Literaturwissenschaftlerin den „[f]iktionalisierte[n] Aufbrüche[n] der jungen Frauengeneration in der Kunst um 1900“. Ellen Olestjerne, Halbtier und Gunhild Kersten stellen hier das Quellenmaterial. An ihnen geht Wybrands zunächst der Frage nach, „welche Anlässe die Texte kreieren, um das kreative Ausdrucksbegehren der Protagonistinnen auszulösen“. Anschließend nimmt sie das „Dilemma weiblichen Kunstschaffens“ in den Blick, das von Reventlow, Böhlau und Reuter anhand einer Malerin, einer Bildhauerin und einer Sängerin thematisiert wird. Zuletzt geht die Autorin dem „emanzipativen Moment der Künstlerinnentexte“ nach und kommt zu dem Schluss dass „die Figurationen“ der drei Künstlerinnen „eine enorme Sprengkraft“ entwickeln.
Anhand der von ihr beleuchteten Werke wirft Wybrands einen in vielfacher Hinsicht erhellenden Blick auf die Rolle der Generationalität in Romanen über zeitgenössische Emanzipationsbestrebung von Autorinnen der vorletzten Jahrhundertwende. Zugleich zeugt ihre Untersuchung von einer eingehenden Kenntnis der einschlägigen Sekundärliteratur. Was zu monieren bleibt, sind einige eher marginale Punkte inhaltlicher wie formaler Art. Ihre Feststellung, dass im 19. Jahrhundert „für bürgerliche Männer und Frauen weiterhin Ehe, Familie und Elternschaft als Lebensziel [gelten]“, lässt etwa den entscheidenden Unterschied außer acht, dass Männern durchaus noch andere Lebensziele zugestanden wurden, merkt sie später doch selbst an, dass sich Männer ab 1800 „immer mehr mit ihrem Beruf identifizierten“. Otto Weininger als „heute stark umstrittenen österreichischen Philosophen“ vorzustellen, ist zumindest irreführend, wenn nicht verharmlosend. Wer würde denn heute noch für sein Hauptwerk, das unsäglich misogyne und antisemitische Machwerk Geschlecht und Charakter streiten wollen? Bedauerlicher Weise hätten zudem einzelne Passagen des vorliegenden Bandes eines eingehenderen Korrektorats bedurft. So endet ein Satz auch schon mal im Nichts: „Böhlau wählt in Halbtier eine andere, nicht minder drastische Auflösung für das Abhängigkeitsverhältnis, in das sie Isolde mit dem hochverehrten Künstler.“
|
||