So rau wie poetisch ist Ocean Vuongs Debütroman „Auf Erden sind wir kurz grandios“, in dem ein junger Ich-Erzähler einen Brief an seine Mutter schreibt, der vom Aufwachsen in den USA, dem Vietnamkrieg und dem Entdecken der eigenen Homosexualität erzählt.
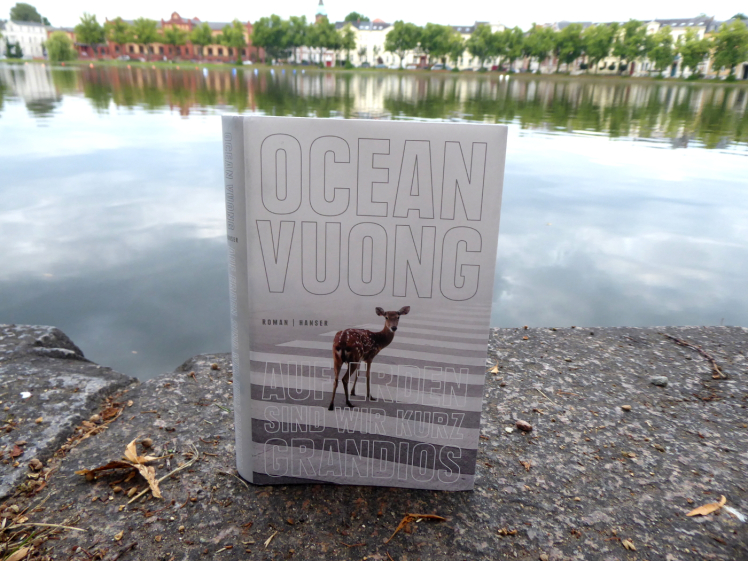
„Es heißt, dass nichts ohne Grund passiert – aber ich kann dir nicht sagen, warum die Toten Lebenden immer zahlenmäßig überlegen sind.“
Seit jeher ist man in den USA auf der Suche nach dem Great American Novel, einem Roman, der die amerikanische Gesellschaft, Politik, Kultur, Gegenwart und Vergangenheit, kurz, die amerikanische Seele in Worten einfängt. „Der große Gatsby“, „Fegefeuer der Eitelkeiten“, „Wer die Nachtigall stört“ gehören zu den Werken, die als Great American Novel bezeichnet werden. Einer könnte sie vom Throne stoßen oder zumindest künftig im gleichen Atemzuge genannt werden: Ocean Vuong mit „Auf Erden sind wir kurz grandios“. Ausgerechnet ein gebürtig vietnamesischer Autor, ein junger obendrein (Vuong ist Jahrgang 1988) hat einen der wichtigsten US-amerikanischen Romane der letzten Jahre vorgelegt.
Auf Erden sind wir kurz grandios hat eine klare Adressatin: Ma, die Mutter des Ich-Erzählers mit dem Rufnamen Little Dog, wird wiederholt angesprochen. Das ist die erste Paradoxie in einem Roman voller Widersprüche: Seiner Mutter ist dieser Text auf gleich doppelte Weise nicht zugänglich – sie spricht kein Englisch und sie kann nicht lesen. Genau das ermöglicht dem Erzähler, schonungslos offen zu schreiben.
„Weil Unterwerfung, wie mir bald klar wurde, auch eine Form von Macht war.“
Little Dog lebt mit Mutter und Großmutter in Hartford, Connecticut, etwa zwei Stunden nördlich von New York, wohin es ihn später verschlagen wird, die Befreiung. Sie stammen aus Vietnam und führen das entbehrungsreiche Leben von Einwander*innen in den USA. Ihre Herkunft spielt eine besondere Rolle: Nicht nur, weil Mutter und Großmutter nicht in der Lage sind, sich in die US-amerikanische Gesellschaft zu integrieren, der Vietnamkrieg prägt diese Kleinfamilie aufs Tiefste. Mutter wie Großmutter sind traumatisiert vom Krieg. Während die Großmutter durch ihre Posttraumatische Belastungsstörung eine Schizophrenie entwickelt hat, gibt die Mutter die erlebte Gewalt an ihren Sohn weiter, dessen Leben auf mehrfache Art von Brutalität geprägt ist. Nicht nur durch die harte Hand seiner Mutter, sondern in der täglichen Erfahrung als queerer vietnamesischer Junge, der in einer kleinen, ärmlichen Stadt aufwächst. Doch während die Diskriminierung im Roman nur unterschwellig mitschwingt, hat Sex mit seinem Freund immer auch die Elemente Gewalt, Macht und Unterwerfung. Ja, sogar Little Dogs gesamte Herkunft entspringt der Gewalt: Der Vater seiner Mutter, so erfahren wir im Laufe des Romans, ist ein namenloser GI – ohne den Vietnamkrieg hätte Little Dog also nie existiert.
Das sagt Ocean Vuong auch in seinem Gedichtband, der drei Jahre vor „Auf Erden sind wir kurz grandios“ erschien: „no bombs = no family = no me.“ Es ist kein Geheimnis, dass Vuong seine eigene Geschichte in dem Roman verarbeitet hat. Und diese Geschichte erzählt nicht nur von der Entwurzelung einer Familie auf der Suche nach ein wenig Glück, das sie etwa in Blumen am Straßenrand findet, das aber nie darüber hinausgeht, sondern auch vom Schicksal Hartfords als Sinnbild für die ganzen USA. Little Dog lernt im Verlaufe des Romans Trevor kennen, die erste große Liebe. Trevor ist weiß, aber kaum privilegierter als Little Dog. Er wächst in einem Trailer Park auf mit einem Vater, der ihn misshandelt, bevor dieser nach drei Bier in Tränen ausbricht. Außerdem ist Trevor heroinabhängig, nachdem ihm mit 15 ein opioides Schmerzmittel verschrieben wurde.
„Ma, unsere Muttersprache zu sprechen heißt, nur teilweise auf Vietnamesisch zu sprechen, aber ganz auf Krieg.“
All dieser Schmerz und die Rauheit des Lebens zeigt sich auch in Vuongs Sprache – die zugleich aber poetisch und zerbrechlich ist. Dem Lyriker (und seiner Übersetzerin Anne-Kristin Mittag) gelingt, ein selten so gelesenes Spannungsfeld zwischen Brutalität und Poesie sowohl sprachlich als auch inhaltlich zu kreieren. Er traut sich, seine Seele in diese Seiten zu brechen, wird dabei manchmal überbordend und driftet ins Pathos ab (wie schon der Titel zeigt), um sich schnell wieder zu fangen und wahnsinnig zart und lyrisch, mit außergewöhnlichen Bildern zu formulieren – Sprache ist Vuongs Selbstermächtigung, sein Mittel, um aus dem, was zerbrochen ist, etwas Ganzes zu schaffen. „Auf Erden sind wir kurz grandios“ ist ein intensiver, lyrischer Roman, der auf einzigartige Weise diese kurze Zeit zwischen Kindheit und Erwachsenenalter festhält, in der man kurz grandios ist.
Ocean Vuong – Auf Erden sind wir kurz grandios
Aus dem Englischen von Anne-Kristin Mittag
Hanser, München
Juni 2019, 235 Seiten