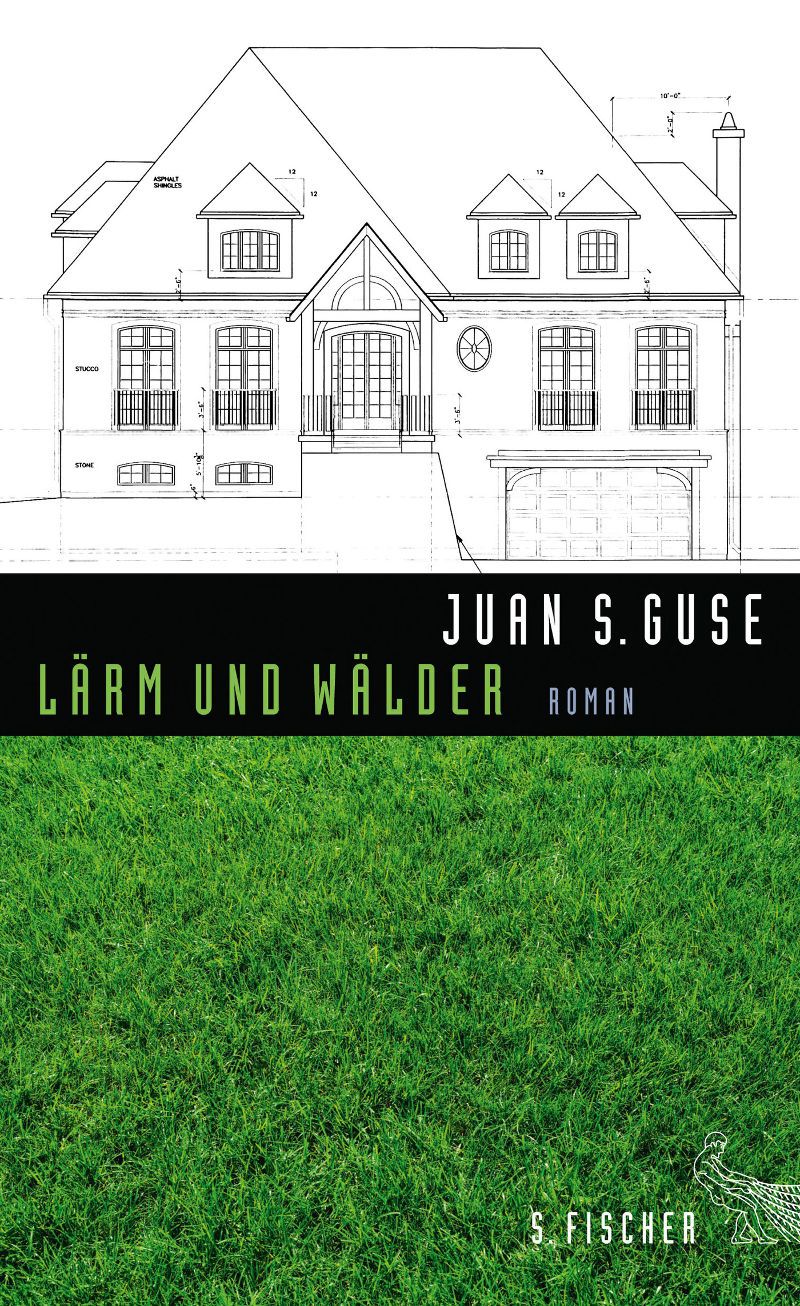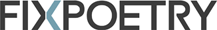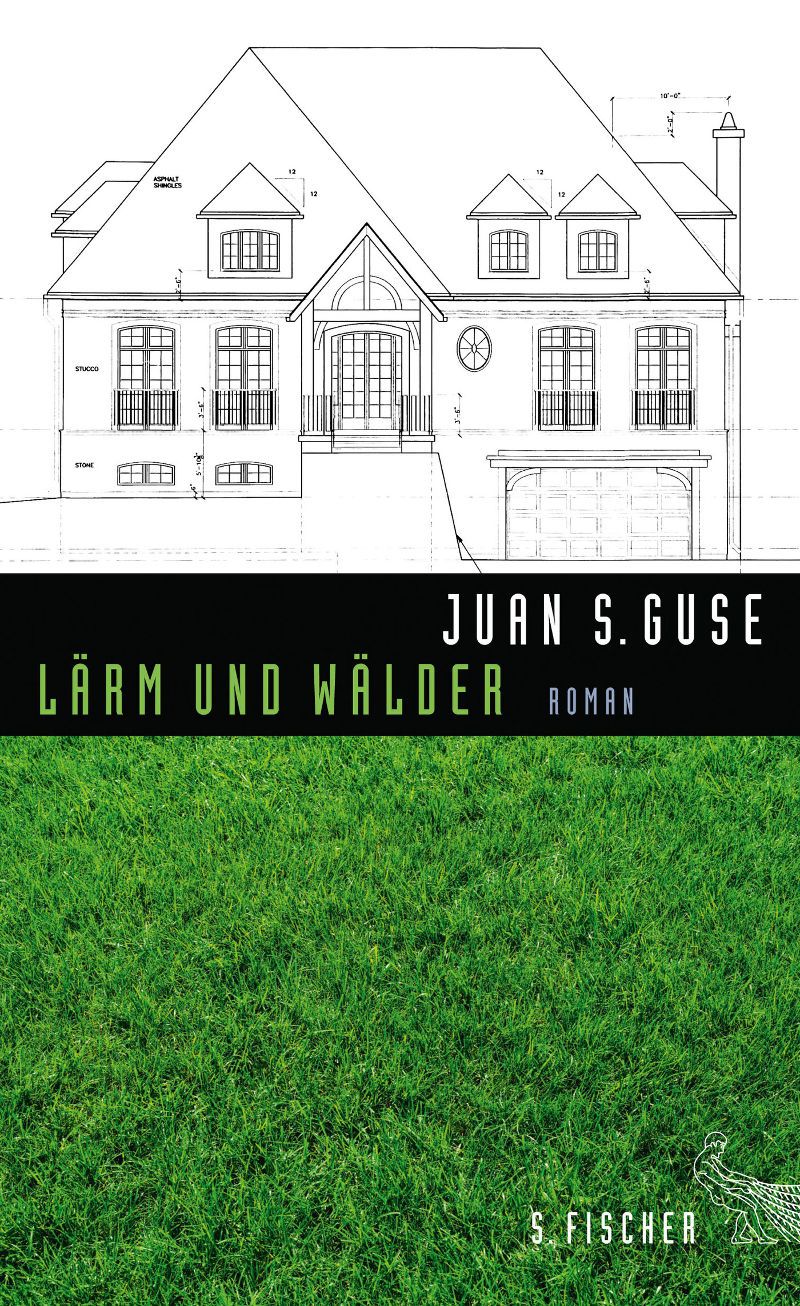
Was dem Kleinbürger die Gartenkolonie, ist dem Paranoiker der Familienbunker: Ein Rückzugsort für die ganze Familie, abgeschieden und sicher.
Sicherheit wird in Juan S. Guses Debüt Lärm und Wälder groß geschrieben: In der Gated Community Nordelta kontrollieren Sicherheitskräfte die täglichen Abläufe, eine Notfallhotline gibt es auch. Familienvater Hector wird trotzdem das Gefühl nicht los, dass ein gewaltsamer Angriff bewaffneter Plünderer kurz bevorsteht – und sorgt vor: Zusammen mit seinem Freund Alvaro, der als Sicherheitsmann Informationen über die Lage außerhalb des Zauns aus erster Hand liefert, wird er zum doomsday prepper, bereitet sich also auf den jüngsten Tag vor, legt Vorräte an, und zum Geburtstag des jüngsten Sohnes, ja, da kann es doch schon einmal ein dampfbetriebener Kühlschrank sein. Ist doch nützlich!
Pelusa kostet das den letzten Nerv: Ohnehin schon mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert, von denen vor allem der missgebildete Henny ein unheimliches Verhalten an den Tag legt, wird sie von Hectors Endzeitstimmung nur noch nervöser gemacht.
Als dann wirklich die Lage zu eskalieren droht, ist es auch mit dem Familienfrieden vorbei. Hector verkriecht sich im Bunker, und Pelusa flieht mit den Kindern zu ihrer Schwester.
Was sich in dieser kurzen Zusammenfassung wie ein aus den Fugen geratenes Familiendrama liest, ist in Juan S. Guses Roman in eine sehr kunstvoll erzählte Geschichte vom Verlust innerer und äußerer Sicherheiten eingebettet: Die Menschen in dieser klaustrophobisch eng anmutenden Welt, die in einem nicht näher benannten südamerikanischen Land liegt, klammern sich an grimmige Endzeitphantasien oder christliche Erlösungsgedanken, während ihre Kinder, allen voran Henny, mit Glasauge und Armstumpf schon äußerlich ein Outcast, auf sich allein gestellt sind.
Mit einem fast kaltblütig genauen Blick beschreibt Guse erst kleine, dann immer größer werdende Bedrohungslagen. Die größte Aufladung erreicht diese Sprache aber gerade in den statischen Szenen, die zwischen den eigentlich Ereignissen liegen – Szenen wie dieser:
Sie richtet sich auf, versucht, die ganze Klarheit des Moments aufzunehmen, die heiße Luft des Tages und das, was er birgt, während sie über den Zaun hinweg den Pooljungen mit großer Gelassenheit das Becken der Nachbarn ausbürsten sieht. Gleich wird er bei ihnen klingeln. Anita wird sich zusammenreißen müssen und er, der Pooljunge, wird Chlortabletten aus seinem Beutel hervorholen, den Boden des Beckens mit seiner Maschine absaugen, die Wände bürsten, einen Termin für kommende Woche ausmachen, sein Trinkgeld bekommen und weitergehen zum nächsten Haus.
Erst allmählich schiebt sich zwischen die Ereignisse, die vorerst in der Gated Community spielen, ein zeitlich früher angelegter Handlungsstrang, der Pelusas Vorgeschichte in einer einsamen Hütte irgendwo in den Anden genauer beleuchtet. Zusammen mit ihrem Mann ist sie aus der Zivilisation geflüchtet, aber auch hier, in der Pampa, schleicht sich das Gefühl der Bedrohung ein: Man hört von frei herumlaufenden Kriminellen, Überfällen und Einbrüchen. Ein geheimnisvoller Trappistenmönch, der Pelusa und ihren Mann um Aufnahme bittet, bringt die Zweierkonstellation durch seine Anwesenheit durcheinander – und auch hier steht am Ende eine Flucht, ein Bruch in der nur scheinbaren Ordnung aller Dinge.
Ein wenig ratlos macht Juan S. Guses Buch nach dem Lesen: So unvermittelt die Handlung einsetzte, hört sie auch wieder auf, im Gedächtnis bleiben dagegen viele Bilder von bizzarer Schönheit, die an Klassiker der lateinamerikanischen Literatur erinnern; und am Ende sind es immer wieder die Tiere, die den Menschen naherücken, in gewaltsamem Konflikt oder stummer Drohung:
Als ich aufstehe, sind die Hunde da. Ihr Lärm klingt wie Rufe. Ich gehe zu ihnen, trete aus dem Haus auf die Straße. Es sind Tausende. Sie freuen sich über mich, formen einen Strudel, stellen sich auf ihre kräftigen Hinterbeine, fletschen ihre Zähne. Sie sind unzählig, reichen bis zum See hinunter, sitzen im Gestrüpp, in den Ästen der Bäume, auf unserem Dach, auf den Stromleitungen. Es ist warm und ich streichle ihre Kopfhaut, massiere ihre Unterkiefer und die Hunde, sie springen mich freudig an. Sie bellen.
Juan S. Guse: Lärm und Wälder. S. Fischer, 320 Seiten, 19,99 €
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...