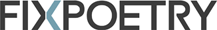Garnette Cadogan über Dimensionen des Spazierengehens in Kingston, New Orleans und New York.
Es sind nur drei kurze Sprünge, die vom Aufwachsen in der Hauptstadt Jamaikas über das Ankommen in New Orleans bis nach New York führen. Doch Ganette Cadogan beschreibt in seinem Essay „Ein Schwarzer geht durch die Stadt“, auf Englisch erstmals im Freeman’s Magazine erschienen und in der deutschen Übersetzung ein Auszug aus dem von Anneke Lubkowitz herausgegebenen Sammelband Psychogeografie, sehr genau, wie sich an diesen Orten der so alltägliche Vorgang des Spazierengehens grundlegend für ihn verändert hat: In Kingston ist es die Flucht vor dem gewalttätigen Stiefvater, die ihn bis spätnachts die Straßen seiner Heimatstadt erkunden lässt; auch wenn er dabei in gefährlichen Vierteln verkehrt, vor denen ihn seine Freunde warnen, lässt er sich nicht beirren. Als er dann, inzwischen Student, in New Orleans seine nächtlichen Streifzüge fortsetzen will, stellt er fest, dass nun er selbst, ein Schwarzer, als potenzielle Bedrohung wahrgenommen wird. Diese Erfahrung kulminiert in New York, wo er aus einem nichtigen Grund von einer Polizeistreife brutal festgenommen wird; eine Szene, die sofort Bilder der rassistischen Polizeiwillkür, die gerade wieder durch die Medien gehen, ins Gedächtnis ruft.
Was Ganette Cadogans Essay bemerkenswert macht, ist die Schilderung der Anpassungsmechanismen, die er abhängig von seiner Umgebung entwickelt: In Kingston sind diese noch eher spielerischer Natur („Manchmal tat ich sogar, als wäre ich verrückt, und redete an besonders gefährlichen Stellen wirres Zeug vor mich hin, etwa an einem Regenkanal, an dem sich Diebe versteckt hielten. Der dumm daher brabbelnde Junge in Schuluniform wurde von den Beutegreifern einfach ignoriert oder ausgelacht“); in den USA, wo Cadogan als Schwarzer plötzlich in einer exponierten Rolle ist, nimmt der Anpassungsdruck repressive Ausmaße an – er wird zur Überlebensstrategie, die den gesamten Tagesablauf bestimmt: „Wenn ich aus der Dusche kam, galt mein erster Gedanke den Cops und der Frage, mit welchem Outfit ich am ehesten Ruhe vor ihnen hätte. Bewährt hatten sich: Helles Oxford-Hemd. Sweater mit V-Ausschnitt. Khakihose. Chukka-Stiefel. Pullover oder T-Shirt mit dem Emblem der Uni. Wenn ich durch die Stadt ging, wurde oft meine Identität hinterfragt, und ich hatte klare Antworten darauf gefunden.“
Es ist eben ein großer Unterschied, und das so arbeitet Cadogan beeindruckend heraus, ob man sich eine Identität selbst gibt – wie er es in Kingston tun konnte – oder als Schwarzer von vornherein eine Rolle zugewiesen bekommt, mit der man sich arrangieren muss, und so auch letztlich die Selbstvergessenheit des sorglosen Spaziergängers verliert. „Monotonie ist Luxus“, heißt es dazu an einer Stelle: Wo das Spazierengehen für Weiße Erholung, Freizeit oder schlicht Alltagsnormalität bedeutet, ist es bei Cadogan mit konkreten Gefahren verbunden. Woran sich auch in den zehn Jahren, die er zum Zeitpunkt, als der Essay erscheint, schon in New York lebt, nichts geändert hat.
Garnette Cadogan: Ein Schwarzer geht durch die Stadt. Matthes & Seitz eBook, ca. 20 Seiten, 1,99 €