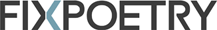Nach der Veröffentlichung von zwei Kurzgeschichten in den Magazinen Granta und The White Review brachte der britische Independent-Verlag Fitzcarraldo Editions, der mit englischen Übersetzungen von Matthias Enard, Olga Tokarczuk und, ja, auch Rainald Goetz‘ Irre ein gut sortiertes internationales Programm pflegt, 2017 den Debütband The Doll’s Alphabet der in Toronto lebenden Autorin heraus, über die nicht viel mehr bekannt ist, als dass sie einen Abschluss in Kunstgeschichte und Germanistik hat.
Irgendwo zwischen düsteren Märchen und surrealer Dystopie mit einem Schuss feinem Humor liegen die dreizehn sehr unterschiedlich langen Erzählungen in diesem Buch: Ob es die Erlebnisse einer Frau sind, die beschließt, sich die Haut abzustreifen und auf einmal eine neue Freiheit fernab der Zwänge des äußeren Erscheinungsbilds genießt („Unstitching“) oder die Geschichte einer Welt, in der eine „Gothic Society“ Streetart in Form von Styropor-Wasserspeiern und Bleiglas-Verzierungen produziert – Camilla Grudova bedient sich stets des klassischen Effekts der fantastischen Literatur, genau ein Detail der Wirklichkeit zu verändern und diese Veränderung dann konsequent zu Ende zu denken. Die Besonderheit ist die dezidiert – und vielleicht entfernt vergleichbar mit Margaret Atwood – weibliche Perspektive, die sie dabei einnimmt. Am besten zeigt sich das in der längsten Geschichte des Bandes, „Waxy“, die ein düsteres Szenario schildert, in der Frauen hart in Nähmaschinen-Fabriken arbeiten, um ihre unselbstständigen Männer zu versorgen, die in regelmäßigen Abständen rätselhafte „Prüfungen“ absolvieren müssen. Das gesamte Zusammenleben von Mann und Frau ist auf Funktionalität ausgerichtet und von Gewalt geprängt, Lebensmittel sind rationiert, Gefühle haben keinen Platz.

„Waxy“ ist auf Deutsch, übersetzt von Rebecca DeWald, unter dem Titel „Wachspüppchen“ in der aktuellen Ausgabe der Edit erschienen. Die Geschichte „Unstitching“ kann man im Original bei Lemonhound nachlesen. Eine deutsche Übersetzung von The Doll’s Alphabet ist bislang noch nicht angekündigt. Vielleicht wird ja der eine oder andere Verlag im Rahmen des Kanada-Schwerpunkts der Frankfurter Buchmesse im nächsten Jahr hellhörig?
Camilla Grudova: The Doll’s Alphabet. Fitzcarraldo Editions, 192 Seiten, ca. 12 €
Marx, aber als Zombie gedacht
Jacobin war im Gründungsjahr 2010, wie Loren Balhorn, einer der aktuellen Redakteure, es beschreibt, „ein zu jener Zeit bescheidener Versuch, sozialistische politische Vorhaben so darzustellen, dass sie für Millionen Amerikaner, die unter wirtschaftlicher Stagnation, einer erdrückenden Schuldenlast und einem allgemeinen Gefühl des politischen Unbehagens litten, verständlich und relevant sein würden.“ Damit war die Zeitschrift zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Gerade formierte sich die Occupy-Bewegung, eine von Barack Obamas Sozialpolitik enttäuschte Linke spürte neuen Auftrieb.
Eine erste Bilanz von fast zehn Jahren Jacobin zieht die nun erschienene, gleichnamige Anthologie, die als schöner Sonderdruck in der edition suhrkamp vorliegt. Sie lädt zum Vertiefen ein in Themen wie Identitätspolitik, Marx, aber als Zombie gedacht, Donald Trumps Weg zur Macht und Bernie Sanders‘ Sicht auf den demokratischen Sozialismus.
Im selben Atemzug gibt es nun aber auch die Möglichkeit, aktuelle Beiträge aus Jacobin im neu gegründeten, deutschsprachigen Online-Magazin Ada zu verfolgen, das die mitunter sehr auf die USA fokussierten Inhalte wiederum um Originalbeiträge erweitert, die auch für einen deutschsprachigen Leserkreis interessant sind – eine Kooperation, die für spannenden Einblicke sorgen könnte.
Berlin-Tipp: Die Release-Veranstaltung zur Jacobin-Anthologie findet am Freitag, den 14. September um 20 Uhr im aquarium am Südblock in der Skalitzer Straße 6 statt.
Hallo Bahia!

Eine Plattform, ein Netzwerk, ein Archiv, und im Mittelpunkt die Übersetzung von Texten: Das ist die Edition Bahia. Im Interview stellen sich Clara Sondermann, Karl Clemens Kübler und Peter Wolff aus dem Gründerteam vor.
Was ist euer Wunsch für die Edition Bahia?
Karl Clemens: Unser Projekt ist ein Webportal, auf dem Übersetzer übersetzte Texte auf Deutsch vorstellen können, um neuen Autoren aus der ganzen Welt im deutschsprachigen Raum ein zentrales Medium zu geben und ihre Texte bekannt zu machen. Bahia ist eine Website, die zum Lesen einlädt. Auszüge aus Romanen, kurze Formen und Essays sollen kurz von den Übersetzern vorgestellt und sozusagen als Promotion für den oder die noch unbekannte AutorIn zugänglich gemacht werden. So sollen interessierte Leser, Übersetzer, Autoren und im besten Fall Verlage an einem schönen Ort im Internet zusammengebracht werden. Bahia soll einen Raum schaffen, in dem Übersetzung als eigene Kunstform wahrgenommen wird.
Das heißt, es gibt so einen Raum bisher noch nicht?
Clara: Es gibt so viele Übersetzungen, die nicht gesehen werden. An denen lange gearbeitet wurde, mitunter auch im Rahmen von Werkstätten. Es ist nicht leicht, diese Texte als noch nicht etablierte Übersetzerin an Verlage zu vermitteln. Programme vom Deutschen Übersetzerfonds helfen dabei sehr. Dennoch ist es so: Wenn das so genannte „Alleinstellungsmerkmal“ eines Textes in einer Mail an die von Einsendungen überfluteten Lektorinnen nicht binnen weniger Minuten ausgemacht werden kann ist, besteht das Risiko, dass etwas Gutes in der Versenkung verschwindet. Ich möchte weder jammern noch verallgemeinern; ganz im Gegenteil habe ich gleich viel Verständnis für beide Seiten und könnte viele Gegenbeispiele anführen. Doch warum nicht einen dritten Raum schaffen, der dieser Marktspannung nicht ausgetzt ist. Es gibt sehr viel zwischen Suhrkamp-Übersetzerin ohne Nebenjobs und dem Übersetzer, der ein halbes Jahr lang ein erstes Gedicht übersetzt (und auch von den beiden möchten wir natürlich Einsendungen!).
Natürlich sind wir uns auch der Tatsache bewusst, dem unterbezahlten Übersetzen von Literatur damit nichts entgegensetzen zu können. Es ist natürlich prekär, doch wenn schon so viel Arbeit in einer Übersetzung steckt, die meist auch nicht bezahlt wurde, verdienen Text und Übersetzer doch Sichtbarkeit mit der Aussicht, am Ende von den richtigen Menschen gefunden zu werden.
Es gibt bei Bahia auch einen festen Bildteil. Wie fügt sich dieser in die Idee ein?
Peter: Was ich generell mit den Fotobeiträgen erreichen will, ist derselbe Austausch. Da man als Fotograf natürlich keinen Übersetzer braucht, könnte die Übersetzung darin liegen, dass der Fotograf nicht in seinem Umfeld ist, sondern im Ausland. Kristin ist ja z.B. Deutsche und fotografiert in Rio.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Ganze im Internet stattfinden zu lassen?
Karl Clemens: Peter Wolff und ich hatten vor längerem die Idee, gemeinsam eine Publikation zu machen. Er ist Fotograf und ich mache so Sachen mit Text. Irgendwann kamen wir darauf, dass es eigentlich schon genug Magazine gibt, die schön aussehen und auch irgendwie gute Texte bieten. Seit 2015 etwa beschäftige ich mich intensiver mit dem Thema Übersetzung und wollte dem seither eigenes Gewicht geben. Zu uns stießen dann Clara und Alex und wir kamen übereins, dass wir unseren Raum lieber im Internet aufbauen wollen.
Clara: Ich finde, es kann nicht genug schöne Magazine geben. Aber dass Bahia eine Website ist, macht es einfacher, mehr Beiträge zusammenzubringen. Und uns interessiert natürlich auch, was andere machen! Bei Treffen von Übersetzern kriegt man das schon mit, aber das ist uns zu wenig. Wir möchten mitbekommen können, woran die anderen arbeiten.
Gibt es schon ähnliche Projekte in anderen Ländern, plant ihr Kooperationen?
Karl Clemens: So weit sind wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber wir sind in jedem Fall offen für Kooperation.
Auf bahiabahia.de ist am 22. Juli das erste Material online gegangen: Eine Übersetzung von Max Czollek, der Gedichte von Adi Keissar aus dem Hebräischen übertragen hat, ein Fotobeitrag aus Rio de Janeiro von Kristin Bethge sowie die Dokumentation eines Übersetzungsprozesses zwischen Elisabeth Bauer und Nikita Safonov.
Support STILL!
Das STILL Magazin hat große Pläne: Zusätzlich zur Print-Ausgabe des Foto- und Literaturmagazins soll als nächstes eine digitale Plattform entstehen, die den Magazingedanken ins Netz trägt. Marc Holzenbecher, einer der Herausgeber von STILL, erzählt, was genau der Plan ist.
Was wird bei einem digitalen STILL Magazin anders werden? Wird es z.B. Beiträge geben, die nur digital denkbar sind?
Ja, natürlich eröffnet uns das die Möglichkeit, andere Beiträge zu publizieren als in Print. Audioformate, digitale Literatur, Bewegtbilder in der Fotografie. Aber vielmehr wird es das Magazin selbst werden, das digital gedacht wird. „We are constantly evolving our format. In the future we want to open up the structure even more, future issues—same as some works in it—may not be completed or ‚closed‘ at the time of publication. What we are looking for is a format that enables us to rearrange and continue completing issues after their release.“ Statt einer Kopie der Printausgabe in Form eines E-Books oder einer statischen PDF wird das digitale STILL ein flexibles Archiv und Labor zugleich, ein Format, das den Arbeiten vergangener Ausgaben ein Weiterleben und eine Weiterentwicklung erlaubt. Ein lebendiges, anpassungsfähiges Magazin, das—weniger endgültig als in Tinte auf Papier—auch work in progress abbilden kann.
Es ist eine STILL-Drama-Ausgabe in Planung. Soll es, wenn es nach euch geht, weitere Bücher geben?
Die Resonanz auf unser erstes Buch, an dem wir gerade arbeiten, ist herausragend. STILL Drama ist als Beginn einer Serie gedacht und sofern es uns (finanziell) möglich ist, wird es weitere Ausgaben geben!
Was habt ihr in den letzten drei Jahren über das Magazin-Machen gelernt?
Zuzuhören, wach zu sein. Gutes braucht Zeit und Geduld.
Prosanova-Prequel 3: Literaturfetisch

Am 29. Mai beginnt in Hildesheim zum vierten Mal das deutschlandweit größte Festival für junge Literatur: PROSANOVA 2014. Zur Einstimmung erscheinen an dieser Stelle in den kommenden Wochen, willkürlich, ungeordnet und streng subjektiv, Fundstücke und Eindrücke aus den vergangenen Jahren.
Wie man aus Literatur einen regelrechten Fetisch machen kann, hat die zum Prosanova-Festival 2011 erschienene 30. Ausgabe der BELLA triste gezeigt: Ein Zauberkasten, eine Wundertüte, groß wie eine Cornflakes-Packung, dem die Bezeichnung „Zeitschrift“ kaum noch gerecht wurde. Mit Fraktur von Judith Schalansky, Soundchip aus China und einem kleinen Beutel, in dem sich – übrigens nach drei Jahren kein bisschen gealtert – ein Stück Baumrinde versteckte. Die obligatorische Bildergalerie:
Die Würstchen der Wahrheit

Es gibt gewiss einige, vielleicht sogar viele Dinge, die Wolfram Lotz nicht kann. Über mangelnde Produktivität muss man sich bei ihm jedenfalls nicht beschweren. Jetzt liegt sein erstes Buch vor, und es passt sich, obwohl klein und unscheinbar, in das schon respektabel angewachsene Gesamtwerk dieses jungen Autors ein.
Verfolgt man Wolfram Lotz’ literarische Spuren der letzten Jahre zurück, fällt zuerst eine Tatsache ins Auge: Dieser Autor versteht es, völlig ungezwungen zwischen den Disziplinen hin- und herzuspringen. Eine Erzählung hier, ein Hörspiel da, dann eine Theateraufführung in Leipzig und mehrere – sämtlich aus dem Theaterbereich stammende – Preise und Stipendien. Anders gesagt: Wolfram Lotz ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein junger Autor produktiv und originell arbeiten kann, und dabei die festgefügten Konventionen des Literaturbetriebs weitestgehend links liegen lässt. Lotz schreibt, und das offenbar ohne Pause, Theaterstücke, Erzählungen, Listenpoesie, Hörspiele; ein ausklappbares, höchst heikles Bildertableau über die Verkettung wichtiger Persönlichkeiten des Kulturbetriebs, eingeheftet in die BELLA triste 31 und gestaltet von Frank Höhne (Titel: „Großer Gesang“) war wohl der bisherige Höhepunkt der Gattungs-Ausflüge. Verstreut finden sich weitere kurze Veröffentlichungen in Zeitungen oder Kleinstverlagen wie der Kölner parasitenpresse. Offenbar konnte Wolfram Lotz sich bislang erfolgreich dem Drang entziehen, einen Roman oder Erzählband zu liefern, qua natura im Reigen des Literaturbetriebs die Eintrittsbilletts in den exquisiten Club der jungen Gegenwartsliteratur. Sein erstes Buch ist stattdessen im Leipziger Kunst-, Architektur- und Theorieverlag Spector Books erschienen, hat Westentaschenformat und versammelt fünf, an verschiedenen Orten inszenierte, Monologe, also Theaterstücke für eine Person.
Call for Submissions: New German Fiction

Der Verlag Readux Books und die Literaturzeitschrift Edit haben einen Literaturwettbewerb für junge deutschsprachige Prosa ausgeschrieben. Mitmachen kann jeder unter dreißig, es winkt ein Preisgeld und Veröffentlichung. Einsendeschluss ist der 31. Mai.
Initiatorin Amanda DeMarco kommentiert dazu per Mail:
„Well, Readux ended up translating one of the winners of Edit’s 2012 essay prize (Francis Nenik) in the first round of books we published, and through that we all just figured out that we had similar interests, so hence the collaboration between Readux and Edit. I think one of the exciting things about Readux being based here is that we can have this really direct and natural connection with what we’re translating, and I’m motivated to find acquisition methods that take advantage of that and build an unmediated relationship with German writing.“
Live aus Berlin: STILL im Frühling

Wenn Donnerstagabend der neue Samstagabend ist, ist Freitagabend seit dieser Veranstaltung definitiv der neue Sonntagnachmittag: Die Reihe „lauthals“ lud das STILL Magazin zum Quasi-Best-Of nach zwei Ausgaben ein; es wurde ein entspannt verjazztes Frühlingsfest daraus.
Hätte nicht das nieselgraue Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, der Abend hätte glatt in den Vorhof des Bethanien am Mariannenplatz verlegt werden können. So scharte man sich in Plastikstühlen um eine improvisierte Bühne mit Plüschsessel, wo nacheinander Meike Blatnik, Sonja vom Brocke, Andreas Bülhoff und Niklas Bardeli ihre Leseparts absolvierten; dazwischengestreut betont lockerer Wortspiel-Jazz von „Swing of the Stoneage“.
Um es gleich vorwegzunehmen: Die Auswahl der Lesenden war, und da war sich auch am Ende das Abends das Publikum weitestgehend einig, angenehm disparat, über fehlende Abwechslung konnte sich nicht beschwert werden. Jedoch: Der hitzeflirrende spätpubertäre Jugendroman von Elvis Peeters, aus dem Meike Blatnik vortrug, fiel bei ganz genauer Betrachtung etwas aus der Reihe, konnte er doch an Komplexität und Originalität nicht so recht mit den folgenden Lesebeiträgen mithalten. Und die hatten es tatsächlich in sich: Sonja vom Brockes abstrakte Prosa, die von altägyptischen Hieroglyphen bis zu Wolfgang Priklopil beunruhigende bis verstörend bizarre Bildwelten entwarf; Andreas Bülhoff, der zwischendurch ganz auf das Vorlesen verzichtete und das Loop-Gerät voraufgezeichnete Text-Samples sprechen ließ; und schließlich Niklas Bardeli, dessen expressiver Vortrag inklusive nervösem Tic noch die banalsten Alltagsbeobachtungen mit dramatischer Wucht auflud – dafür hat sich das Kommen gelohnt.
Ein schön zusammengestelltes Fest also für den zwar einerseits noch nicht ganz eingetroffenenen Frühling, dafür aber andererseits für die Hybridität der Formen: Sowohl Blatnik als auch Brocke, Bülhoff und Bardeli entpuppten sich als Meister des Vortrags und ließen den Wunsch nach dem Nachlesen auf Papier oder in Buchform fast vergessen machen. Fair enough: Als einziges Buch war am Büchertisch ohnehin nur der klassischste Text, also Elvis Peeters‘ bei Blumenbar erschienener Roman Der Sommer, als wir unsere Röcke hoben und die Welt gegen die Wand fuhr erhältlich. Alles andere kann und sollte man sich bei anderer Gelegenheit nochmal live anhören, oder dann durchaus auch im kleineren Rahmen nachlesen, bis es mehr gibt, und zwar in den ersten beiden Ausgaben der STILL.
Zum Abschluss hier noch ein paar spontan notierte quirky Zitate der Lesenden:
- „Einen richtigen Plan hatten wir nicht, wir improvisierten wie immer“ (Elvis Peeters)
- „Fanta mit Pfiff“ (Sonja vom Brocke)
- „strafe und Strafe“ (Andreas Bülhoff)
- „Ich will dich da treffen, wo die kleinen Füchse wohnen“ (Niklas Bardeli)
„Mein Großvater war ein großer Wanderer“
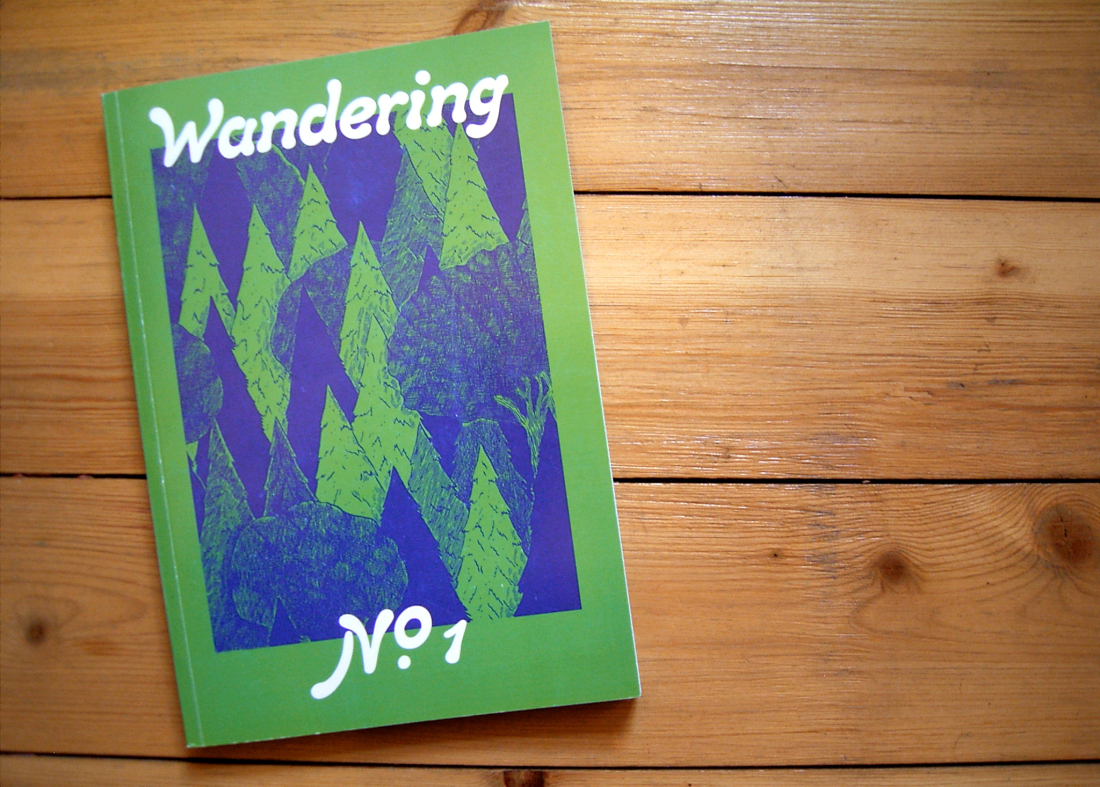
Von allen menschlichen Fortbewegungsarten ist das Wandern wohl die Interessanteste: Es findet meist in einer waldigen Gegend statt, Berge sind möglich, aber kein Muss, man setzt sich der Natur aus, bleibt aber doch auf eingetretenen Pfaden.
Anders als das Spazierengehen, Flanieren oder Bummeln bedarf eine Wanderung der gründlichen Vorbereitung, man muss die richtigen Schuhe besitzen, Proviant packen und sich auf schlechtes Wetter einstellen. Wandern ist kontrollierte Flucht aus dem Alltag, Wandern ist Kunst – und das war den Baslern Dan Solbach und Tenzing Barshee Grund genug, ein Rundschreiben zu verfassen und interessante Menschen zu Gesprächen über das Wandern einzuladen. Die Ergebnisse haben sie als Magazin herausgebracht, das den schönen Titel Wandering trägt, so ein bisschen auf Siebziger Jahre macht und schon im Januar erschienen ist.
(…) Als Kind hatte ich diese Faszination und wollte das immer machen. Auch noch als Jugendlicher. Und es ist eigentlich erst spät passiert, dass ich in die Berge gekommen bin. Mein Großvater war ein großer Wanderer. – Der hat ja ein Holzgeschäft, oder? Das bedeutet, dass er sich sowieso für den Wald interessiert haben muss (…)
Das Gute an Nachzügler-Berichten: Die nächste Ausgabe ist schon im Druck. Bis dahin gibt es Neuigkeiten auf tumblr. Das Heft gibt’s bei Motto.
Robert Walser in Südafrika
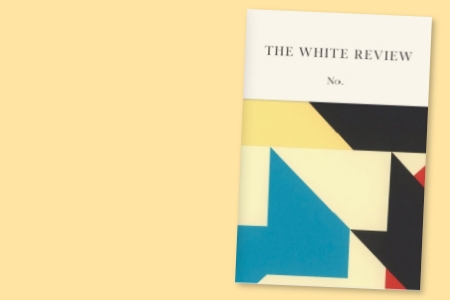
Ein Blick in die internationalen Literaturzeitschriften lohnt sich immer. Besonders empfehlenswerte Ausgaben lohnen einer genaueren Erwähnung, so etwa die fünfte Nummer der White Review aus London.
Die berichtet unter anderem über Christoph Schlingensiefs Operndorf in Ouagadougou, es gibt, als vierfarbigen Einleger gedruckt, drei neue Collagen-Gedichte von Herta Müller und einen Kurz-Essay über Robert Walsers letzten Spaziergang im Schnee – aus der Perspektive des südafrikanischen Schriftstellers Ivan Vladislavić.
In der Online-Ausgabe wurde dieser Beitrag noch um ein Interview ergänzt, bei dem schon die Fragestellungen lesenswert sind:
Your writing reveals a lot of deep reflection on the English language. Grammar, punctuation, dictionaries, crossword puzzles, lists of bird names, little known collective nouns, arcane forms, malapropisms, and the unruly polysemy of puns, all feature in your fiction at one time or another. How does this heightened awareness of language, the practice of taking your medium as your subject, help or impede you in telling the stories you want to tell?
Daneben kommt in der Papier-Ausgabe noch der amerikanische Schriftsteller Ben Marcus zu Wort, der sich am Beispiel von seinem letzten Roman The Flame Alphabet zur Zugänglichkeit von Literatur und dem Sinn des Kreativen Schreibens äußert, man kann zwei Kurzgeschichten lesen und Kunst gucken. The Daily Frown meint: Schön!