Geprägt vom liberalem Geist und mediterranem Klima hat Odessa viele Autoren hervorgebracht. Und selbstverständlich viele angezogen. Nach meinem Besuch dort begab ich mich auf Spurensuche. Und so ist eine Reihe über die Kinder und Besucher einer Stadt entstanden, die von den Einheimischen liebevoll „Mama Odessa“ genannt wird. Keine Kurz-Biographien im klassischen Sinn, die Leben und Werk würdigen. Sondern mal längere, mal kürzere Skizzen die herausstellen möchten, welchen Bezug die Porträtierten jeweils zu Odessa hatten. Eine, wie ich meine, bunte Sammlung, die manchen auch überraschen könnte.
Den Anfang haben drei in Odessa geborene Schriftsteller gemacht, die literarische Kultfiguren geschaffen haben. Isaak Babel in seinen „Geschichten aus Odessa“ den Gauner Benja Krik und das Autorenduo Ilja Ilf und Jewgeni Petrow im Kultroman „Zwölf Stühle“ den Hochstapler Ostap Bender. Es wurden einige „Großväter“ der modernen jiddischen Literatur und Autoren skizziert, die unfreiwillig in Odessa gelandet sind. Dann ging es um einige Schriftsteller, die politisch nicht genehm gewesen sind. – Heute um einst berühmte Namen, die in Vergessenheit geraten sind.
Die Lyrikerin Anna Achmatowa (1889 – 1966) wurde Mitte der 1960er als potentielle Literaturnobelpreisträgerin gehandelt. Sie ist in einem kleinen Dorf unweit von Odessa geboren. Unter schrecklichen Eindrücken entstand 1937/38 Achmatowas berühmter Gedichtzyklus „Requiem“, der in der Sowjetunion erst unter Michail Gorbatschow 1987 veröffentlicht werden konnte. Ihr erster Mann, der Dichter Nikolaj Gumiljow, wurde unter dem Verdacht der Konterrevolution 1921 erschossen. Ihr Sohn Lew verbrachte zwölf Jahre in Lagerhaft und Verbannung.
Zweifellos gehört die Achmatowa zu den berühmten und gerühmten Kindern der Stadt. An andere gebürtige Odessiten erinnert kaum noch etwas. Nach der Lyrikerin Wera Michajlovna Inber (1890 – 1972) heißt zwar in Odessa eine Straße, ihr Werk freilich ging mit den Zeitläuften unter. Geehrt wurde sie 1946 mit der höchsten Auszeichnung, die die Sowjetunion damals für herausragende Leistungen auf wissenschaftlichem, musikalischem, künstlerischem und literarischem Gebiet zu vergeben hatte, dem Stalinpreis. Übrigens für das Gedicht „Pulkovskij meridian“ (1943) und ihre Schilderungen aus dem belagerten Leningrad („Pocti tri goda“ 1946). 1946/47 wurde ihr Bericht im Rahmen von Umerziehungsmaßnahmen unter dem Titel „Fast drei Jahre. Aus einem Leningrader Tagebuch“ in großen Stückzahlen von der Sowjetischen Militäradministration in Ostberlin vertrieben. In der DDR sind Inbers Werke bis in die späten 1960er Jahre erschienen. Heute ist die Lyrikerin und Kinderbuchautorin, der keine geringere als Christa Wolf 1967 ein literarisches Porträt gewidmet hat[1], vergessen.
Ein Schicksal, das sie mit anderen, in Odessa geborenen Autoren teilt. So mit Eduard Bagritsky (1895 – 1934), einem Wegbereiter der frühen sowjetischen Lyrik („Duma ob Opanase“, 1926 erschienen). Oder dem aus Odessa stammendem jüdischen Schriftsteller und Übersetzer Wilhelm Wolfsohn (1820-1865). Der war 1837 nach Leipzig gegangen, hatte über russische Literatur promoviert und sich relativ erfolgreich für deren Verbreitung in Deutschland stark gemacht. Unter anderem hat er Werke von Gogol, Puschkin, Dostojewski, Turgenjew und Tolstoi übersetzt. Wolfsohn war eng mit Theodor Fontane befreundet. Hätte er nicht zwischen 1841 und 1861 einen regen Briefwechsel mit Fontane geführt, der 2006 in Tübingen herausgegeben wurde,[2] wäre auch er heute komplett vergessen. Kaum anders das Schicksal der Odessitin Olga Michailowna Freudenberg (1880 – 1955), die sich 1934 als erste Frau in der Geschichte Russlands habilitierte. In Erinnerung ist lediglich ihr Briefwechsel mit Boris Pasternak.[3]
Alexander Grin (1880 – 1932) alias Alexander Stepanowitsch Grinewski wurde in jenem Landstrich geboren, wohin sein Vater, der am polnischen Aufstand im Jahr 1863 teilgenommen hatte, verbannt worden war – in Sibirien. Nach Abschluss der Volksschule zog Grin 1896 nach Odessa, um als Matrose anzuheuern. Abgesehen von drei Fahrten misslang der Plan, zur See zu fahren. Das Meer allerdings sollte lebenslang sein großes Thema bleiben.
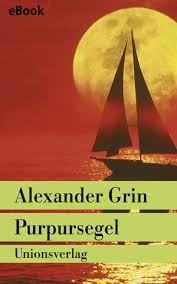 Grin schlug sich unter anderem als Vagabund, Torfstecher, Goldwäscher und Hafenarbeiter durch und landete schließlich als Bettler auf der Straße. Dieses Leben hatte ihn kreuz und quer durch Russland geführt. So unstet sollte es vorerst weitergehen. 1901 wurde er Soldat, desertierte, kam ins Gefängnis. Er hatte mit Sozialrevolutionären Kontakt, für die er sich als Agitator einsetzte, und landete abermals im Gefängnis, wo er schließlich Kurzgeschichten zu schreiben begann. Gefördert von Maxim Gorki entwickelte er sich mit seinen nach der Oktoberrevolution verfassten märchenhaften Geschichten („Das Purpursegel“ 1923, „Die funkelnde Welt“ 1923, „Der Rattenfänger“ 1924, Die goldene Kette 1925, „Wogengleiter“ 1928) zu einem populären Autor.
Grin schlug sich unter anderem als Vagabund, Torfstecher, Goldwäscher und Hafenarbeiter durch und landete schließlich als Bettler auf der Straße. Dieses Leben hatte ihn kreuz und quer durch Russland geführt. So unstet sollte es vorerst weitergehen. 1901 wurde er Soldat, desertierte, kam ins Gefängnis. Er hatte mit Sozialrevolutionären Kontakt, für die er sich als Agitator einsetzte, und landete abermals im Gefängnis, wo er schließlich Kurzgeschichten zu schreiben begann. Gefördert von Maxim Gorki entwickelte er sich mit seinen nach der Oktoberrevolution verfassten märchenhaften Geschichten („Das Purpursegel“ 1923, „Die funkelnde Welt“ 1923, „Der Rattenfänger“ 1924, Die goldene Kette 1925, „Wogengleiter“ 1928) zu einem populären Autor.
Doch schon Ende der 1920er Jahre waren seine Bücher, die sich an der Erzählkunst von Edgar Allan Poe und Robert Louis Stevenson orientierten, nicht mehr erwünscht. Man warf ihm „West-Epigonentum“ vor. Verlage nahmen keine Manuskripte mehr von ihm an. Auch die ursprünglich auf 15 Bände angelegte Werkausgabe wurde gestoppt. Einsam, krank und in großer finanzieller Not starb Alexander Grin 1932 auf der Halbinsel Krim. Rehabilitiert wurde er nach Stalins Tod.
In Russland erfreuen sich seine Bücher bis heute großer Beliebtheit. Auch in der DDR wurde sein Werk rezipiert. Im Westen hingegen wurde lediglich der 1923 entstandene, märchenhafte Roman „Purpursegel. Eine Feerie“ etwas bekannt. „Diese Erzählung ist voller Poesie und warmer Menschlichkeit, wie bis ins Innere von Sonne bestrahlt und Meeresluft umweht. Sie ist erfüllt von des Autors Lächeln – dem Lächeln, das Grin im Leben so fehlte“, urteilte der Autor Konstantin Paustowski.
Verfilmt wurde der Stoff unter der Regie von Alexander Ptuschko in der UdSSR 1961 unter dem Titel „Das Purpurrote Segel“. Heute zählt der Streifen zu den Märchenklassikern der russischen Filmgeschichte. In einer synchronisierten Fassung der DEFA-Studios kam der Film in der DDR 1962 in die Kinos und wurde ab den 1970ern auch verschiedentlich im Fernsehen gezeigt. Erstmals auf Deutsch hatte der Ostberliner Verlag der Sowjetischen Militäradministration (SWA-Verlag) den Roman 1946 herausgebracht.
 Längst verblasst ist der Ruhm von Konstantin Georgieviè Paustowski (1897 – 1968), ein Sohn ukrainischer Kosaken. Marlene Dietrich (1901 – 1992) hat für ihn geschwärmt. Beide sollen sich 1964 in Moskau begegnet sein. Die Filmdiva, so ihre Biographin Eva Gesine Baur, soll bei dem Treffen kein Wort über die Lippen gebracht haben, sondern in tiefer Verehrung vor dem Schriftsteller sogar auf die Knie gegangen sein.[4] Im darauffolgenden Jahr hatte Paustowski hervorragende Aussichten, den Literaturnobelpreis zu erhalten. Auf Druck Moskaus ging er jedoch nicht an ihn, sondern 1965 an Michail Scholochow (1905 – 1984), der wenige Jahre später des Plagiats überführt werden sollte.[5]
Längst verblasst ist der Ruhm von Konstantin Georgieviè Paustowski (1897 – 1968), ein Sohn ukrainischer Kosaken. Marlene Dietrich (1901 – 1992) hat für ihn geschwärmt. Beide sollen sich 1964 in Moskau begegnet sein. Die Filmdiva, so ihre Biographin Eva Gesine Baur, soll bei dem Treffen kein Wort über die Lippen gebracht haben, sondern in tiefer Verehrung vor dem Schriftsteller sogar auf die Knie gegangen sein.[4] Im darauffolgenden Jahr hatte Paustowski hervorragende Aussichten, den Literaturnobelpreis zu erhalten. Auf Druck Moskaus ging er jedoch nicht an ihn, sondern 1965 an Michail Scholochow (1905 – 1984), der wenige Jahre später des Plagiats überführt werden sollte.[5]
Wer Paustowskis Büchern nachstöbern möchte, muss in Antiquariaten suchen. Paustowski, dessen literarische Vorbilder Alexander Grin und die Odessiten Issak Babel, Valentin Katajew und Jurij Olescha gewesen sind, hat in den 1950/60er Jahren mit einem literarischen Großprojekt Furore gemacht: der sechsbändigen Autobiographie „Erzählungen vom Leben“, die zwischen 1946 und 1963 entstanden ist und in der „Tauwetter“-Phase als Sensation gefeiert wurde.[6] „Erinnerungen“, so Paustowski, „das sind nicht vergilbte Briefe, nicht Alter, nicht vertrocknete Blüten und Reliquien, sondern die lebendige, pulsierende volle Welt“.
Der vierte Band, „Die Zeit der großen Erwartungen“ (1958 erschienen) spielt in Odessa.[7] Anfang der 1920er Jahre arbeitete Paustowski für die dortige Zeitschrift „Morjak“ und hatte engen Kontakt zu den literarischen Größen der Stadt, mit denen er abenteuerliche Zeiten erlebt hat. Der Roman behandelt eine Phase, die von der Aufbruchsstimmung nach der Revolution, den Hoffnungen auf ein besseres Leben, aber auch von Armut, Hunger und Verzweiflung geprägt war.
Nachdem er weltweit Aufmerksamkeit bekommen hatte, konnte er weite Reisen unternehmen und machte sich auch mit Reisebeschreibungen einen Namen („Das Buch der Wanderungen“, Band 6 der Autobiographie „Erzählungen vom Leben“). Paustowski, der sich unter anderem für Babel, Bunin und Pasternak verwendete, starb 1968 in seiner Geburtsstadt Moskau.
Kenner der klassischen russischen Literatur nennen Alexander Iwanowitsch Kuprin (1870 – 1938) in einem Atemzug mit Puschkin, Tolstoi und Scholochow. In die Literaturgeschichte ist er als einer der letzten großen russischen Realisten eingegangen. Bruchteile seines umfassenden Werks wurden in der DDR gelesen, im Westen ist er bis heute nahezu unbekannt.[8]
Kuprins Mutter stammte aus einem alten verarmten Tartarengeschlecht. Sein Vater war ein kleiner Beamter, der durch seinen frühen Tod die Familie mittellos hinterließ. Kuprin kam auf eine Kadettenanstalt und war nach seiner Ausbildung lange beim Militär. 1894 quittierte er den Dienst dort und schlug sich mit zahlreichen Jobs durch. Unter anderem als Stahlgießer, Gutsverwalter, Vorsänger in einer Kirche und Mitglied in einer fahrenden Theatergruppe. 1901 fasste er den Entschluss, es mit der Schriftstellerei zu versuchen, und zog nach St. Petersburg, dem damaligen literarischen Zentrum. 1905 machte ihn sein Roman „Das Duell“ über Russland hinaus schlagartig berühmt.
Kuprin verließ nach der Oktoberrevolution Russland und emigrierte – wie damals viele Schriftsteller – nach Paris. „Mein Heimweh“, notierte er dort, „geht nicht vorüber, es stumpft nicht ab, sondern überfällt mich immer häufiger und wird immer tiefer…“ An Krebs erkrankt, kehrte er 1937 in die Heimat zurück. Wie schon bei Gorkis Heimkehr aus dem Exil 1927 wurde seine Rückkehr propagandistisch ausgeschlachtet als Triumph des Kommunismus.
Genaues weiß man zwar nicht, aber man sagt, dass Alexander Kuprin mehr als 200 Erzählungen und Romane geschrieben haben soll. Auch Odessa spielt darin immer wieder eine Rolle. In Russland in aller Munde war sein mehrbändiger Romanzyklus „Jama“ (dt. „Die Gruft“). Hier beschreibt er das Leben im Bordell einer südukrainischen Hafenstadt. Noch Jahre nach Erscheinen des ersten Bandes im Jahr 1909 sollen Studenten gegen die sozialen Missstände protestiert haben, die Kuprin in „Jama“ angeprangert hat: Nicht die Damen, sondern die Umstände, die sie dazu getrieben haben, ihre Körper zu verkaufen, und die „ehrbaren“ Besucher, die die Lage der Frauen ausnutzen.
Auf Deutsch verlegt wurde der Romanzyklus 1923 beim Interterritorialen Verlag „Renaissance“ unter dem Titel „Jama – eine Sittengeschichte“. In der Chronik des Wiener Verlages ist von 70.000 verkauften Exemplaren die Rede. In Anlehnung an Kuprins Buch erschien in der DDR der Titel „Das sündige Viertel. Sittenbilder aus dem alten Russland“ 1986 bei Rütten & Loening.
 So gut wie keine Spuren sind von Jefim Dawydowitsch Sosuljas Leben (1891 – 1941) geblieben. Er soll zwischen 1911 und 1918 in Odessa gelebt haben und dort als Journalist tätig gewesen sein. Dem Slavisten Fritz Mierau (geb. 1934), der sich als Übersetzer und Herausgeber vieler Werke aus Russland hervortat und dies noch tut, ist es zu danken, dass zu DDR-Zeiten 1981 ein Band mit Erzählungen und Porträts von Sosulja erschienen ist: „Der Mann, der allen Briefe schrieb“. In der Übersetzung von Rosemarie Tietze hat Mierau zudem den Kollektivroman „Die großen Brände“ herausgegeben, der in drei Ländern 1982 zeitgleich veröffentlicht wurde. In der BRD, der DDR und in Österreich.[9]
So gut wie keine Spuren sind von Jefim Dawydowitsch Sosuljas Leben (1891 – 1941) geblieben. Er soll zwischen 1911 und 1918 in Odessa gelebt haben und dort als Journalist tätig gewesen sein. Dem Slavisten Fritz Mierau (geb. 1934), der sich als Übersetzer und Herausgeber vieler Werke aus Russland hervortat und dies noch tut, ist es zu danken, dass zu DDR-Zeiten 1981 ein Band mit Erzählungen und Porträts von Sosulja erschienen ist: „Der Mann, der allen Briefe schrieb“. In der Übersetzung von Rosemarie Tietze hat Mierau zudem den Kollektivroman „Die großen Brände“ herausgegeben, der in drei Ländern 1982 zeitgleich veröffentlicht wurde. In der BRD, der DDR und in Österreich.[9]
Das literarische Experiment, im Kollektiv einen Roman zu verfassen, haben Jefim Sosulja und Michail Kolzow (1898 – 1940) um 1925 gemeinsam angeschoben. Auf ihre Initiative hin kamen 25 Autoren zusammen, darunter auch einige Altmeister der damaligen Literaturszene.[10] Erstveröffentlicht wurde die satirische Kolportage über ominöse Brände in einer südlichen Hafenstadt 1927 in der Moskauer Zeitschrift „Ogonjok“.
Im deutschsprachigen Raum bekannt geworden ist Sosuljas Erzählung „Die Geschichte von Ak und der Menschheit“, die kurz nach der Oktoberrevolution 1919 entstanden ist und von Kai Grehn für den SFB/ORF 2002 als Hörspiel adaptiert wurde.[11] Ein gewisser Ak versteht darin sich als Weltverbesserer. Kaum an die Macht gekommen, gründet er das „Gremium der höchsten Entschlussfreude“, dessen Aufgabe es ist, schon jene Menschen aussortieren, die der neuen Ordnung skeptisch gegenüberstehen. Die Aussortierten haben dann die Möglichkeit, das Leben innerhalb von vierundzwanzig Stunden zu verlassen. Sollte ihnen das aus eigner Kraft nicht gelingen, stehen Verwandte und Freunde, aber auch bewaffnete Sonderkommandos bereit, nachzuhelfen.
Das Gremium arbeitet sehr emsig; die Sterbeakten häufen sich. Dann aber befallen AK Zweifel: „Was sollen wir tun? Wo ist der Ausweg? Studiert man die lebenden Menschen, so kommt man zu dem Schluss, dass sie zu drei Vierteln ausgerottet werden müssen, aber wenn man die Hingemetzelten studiert, dann weiß man nicht, ob man sie nicht eher lieben und bemitleiden müsste? Eben hier gerät die Menschenfrage in die Sackgasse, in die unheilvolle Sackgasse der menschlichen Geschichte.“[12]
Anmerkungen
Einige Gedanken darüber, warum wir so wenig über die Literatur wissen, die auf dem Gebiet der heutigen Ukraine entstanden ist, habe ich hier dargelegt.
[1] Der Sinn einer neuen Sache. Vera Inber, in: Christa Wolf: Moskauer Tagebücher: Wer wir sind und wer wir waren, Berlin 2014.
[2] Theodor Fontane und Wilhelm Wolfsohn – eine interkulturelle Begegnung, hrsg. von Hanna D. von Wolzogen und Itta Shedletzky, Tübingen 2006.
[3] Boris Paternak/Olga Freudenberg: Briefwechsel 1910 – 1954. Aus dem Russischen von Rosemarie Tietze, Frankfurt a.M. 1986.
[4] Eva Gesine Baur: Einsame Klasse. Das Leben der Marlene Dietrich, München 2017
[5] Wolfgang Kasack: Die russischen Nobelpreisträger, in: LiLi. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Heft 107.
[6] Paustowskis Biographie umfasst die Bände: „Ferne Jahre“ (1946), „Unruhige Jugend“ (1954), „Beginn eines unbekannten Zeitalters“ (1956), „Die Zeit der großen Erwartungen“ (1958), „Sprung nach dem Süden (1959/60), „Buch der Wanderungen“ (1963).
[7] Konstantin Paustowski: Der Beginn eines verschwundenen Zeitalters. Aus dem Russischen von Gudrun Düwel und Georg Schwarz. / Die Zeit der großen Erwartungen. Aus dem Russischen von Georg Schwarz. Die Andere Bibliothek, Frankfurt am Main 2002.
[8] „Meistererzählungen“ von Alexander Kuprin, übersetzt von Eveline Passet und mit einem Nachwort versehen von Ilma Rakusa, sind 1989 beim Züricher Manesse Verlag erschienen. Enthaltene Erzählungen: Der Moloch, Das Nachtlager, Die Jüdin, Die Kränkung, Die mechanische Rechtspflege, Das Granatarmband, Der schwarze Blitz, Der Stern Salomos
[9] Die großen Brände. Ein Roman von 25 Autoren, Hrsg. Fritz Mierau, Berlin/Frankfurt/Wien 1982.
[10] Beteiligt waren Alexander Arossew, Isaak Babel, Feoktist Beresowski, Sergej Budanzew, Konstantin Fedin, Alexander Grin, Wera Inber, Alexander Jakowlew, Weniamin Kawerin, Michail Kolzow, Boris Lawrenjow, Leonid Leonow, Juri Libedinski, Wladimir Lidin, Nikolaj Ljaschko, Georgi Nikiforow, Lew Nikulin, Alexej Nowikow-Priboj, N.Ognjow, Michail Slonimski, A.Soritsch, Michail Soschtschenko, Jefim Sosulja, Alexej Swirski und Alexej Tolstoj.
[11] Kulturradio vom RBB hat das Hörspiel am Freitag, den 6. Oktober 2017 ab 22 Uhr im Programm.
[12] Die Erzählung kann man hier nachlesen: Fritz Mierau (Hrsg.): Kauderwelsch des Lebens. Prosa der russischen Moderne, Hamburg 2003.

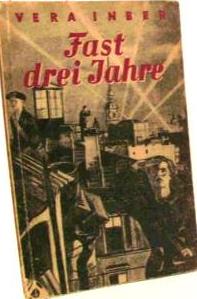

Vielen Dank für diese grossartige Zusammenstellung!
Ich wußte gar nicht daß Paustowski solch eine Verbindung zu Odessa hatte, werde gleich mal nachschauen, ob ich die „Die Zeit der großen Erwartungen“ im Regal habe…
aber eine winzige Korrektur: Mein Freund der Hörspielautor heißt „Grehn“, nicht „Greh“,
bitte korrigieren sie das ;=)
Ich freue mich schon auf weitere intensive Recherchen hier, so viele Leerstellen werden gefüllt!
danke für den Hinweis