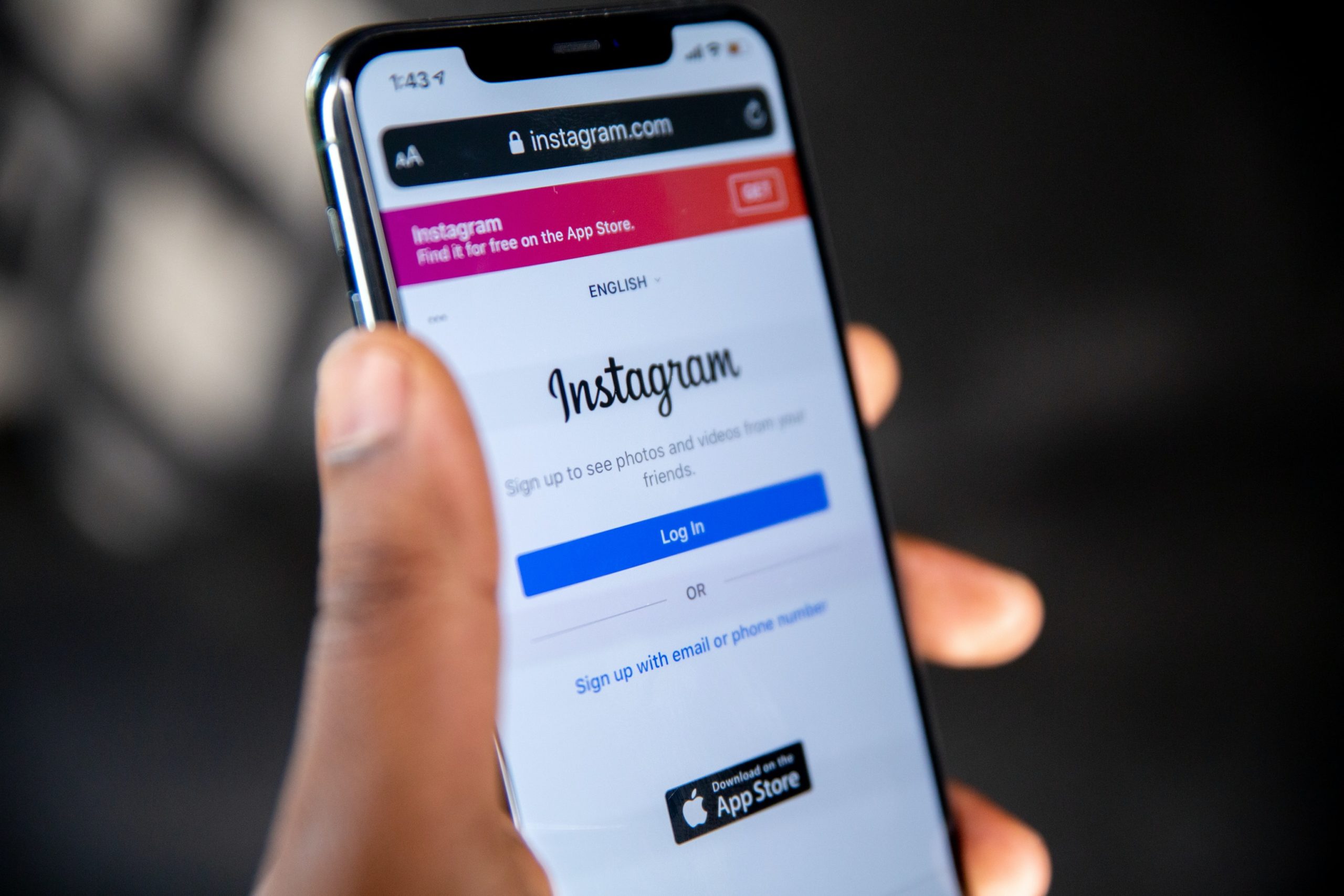Queering Literaturbetrieb
In den letzten Jahren ist ein Trend queerer Literatur auszumachen, in Übersetzung feiern Autor*innen wie Ocean Vuong, Maggie Nelson oder Edouard Louis große Erfolge. Dennoch haben queere Autor*innen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, aber auch im Literaturbetrieb, immer noch zu wenig Präsenz und Mitspracherecht. Diskriminierung, Sexismus, LGBTIQ+-Feindlichkeiten und Ignoranz gehören leider weiterhin zum Alltag. Die neue Kolumne Queering Literaturbetrieb widmet sich in kurzen Essays den Dissonanzen zwischen Literaturproduktion und Verlagswesen. Sie fragt nach dringlichen Themen und Diskursen innerhalb der Gruppe der queeren Schreibenden. Eva Tepest, Katja Anton Cronauer, Kevin Junk und Alexander Graeff haben sich als Autor*innen zusammengeschlossen, um mit dieser neuen Kolumne den aktuellen Wasserstand der queeren, deutschsprachigen Literatur auszuloten. Sie wollen mit ihren Essays individuelle Erfahrungen aus den verschiedenen Berufs- und Lebensrealitäten zusammentragen und zugleich ein größeres Bild von aktuellen Chancen, Ambivalenzen und Missständen aufzeigen.
Eine Kolumne von Alexander Graeff
Eintritt in eine neue Welt
Als ich vor 15 Jahren meine erste Erzählung veröffentlichte, war das für mich der Eintritt in eine neue, zuvor verschlossene Welt. Ich war ein Glückspilz, denn ich hatte nur vier Jahre, nachdem ich nach Berlin geflohen war, einen Verlag gefunden, der mit meinen frühen literarischen Versuchen etwas anfangen konnte.
Mein Verleger schien außerdem Interesse an meiner Person zu haben. Er lud mich auch privat ein, wie ich es damals in meiner Unsicherheit bezeichnete. Es folgten eine Reihe sakraler Lesungsveranstaltungen in schicken Mitte-Clubs und – für meine Verhältnisse – großbürgerliche Abendessen mit anschließenden Diskussionen über Gott und die Welt im Raucherzimmer.
Da ich mir mit einem Philosophiestudium zwei Jahre zuvor einen Jugendwunsch erfüllt hatte, kannte ich akademisches Sprechen bereits aus dem Studium. Was die Gäste besagter Abendessen und die anderen Autor*innen in den schicken Mitte-Clubs aber mit Sprache anstellten, faszinierte mich ebenso wie es mir unüberwindliche Barriere war. Meine eher bildungsferne, kleinbürgerliche Herkunft und mein Aufwachsen in der Provinz versuchte ich möglichst zu verstecken. Ich bemühte mich, halbwegs Hochdeutsch zu sprechen und die durch meinen Dialekt verunstaltete Grammatik zu korrigieren, bevor mir das Gepolter aus dem Mund geflogen kam. Die Empfehlung meines Verlegers, eine Sprechausbildung zu beginnen, fühlte sich anfangs zwiespältig an.
Heteronormative Verfugung
Von sichtbarer Queerness, für die Berlin in der ganzen Republik ja bekannt war und ist, konnte in diesen Kreisen nicht die Rede sein. Die Gesellschaft, in die ich eintauchte, war durch und durch heteronormativ verfugt. Die wenigen offen schwulen oder noch weniger lesbischen Autor*innen in der Peripherie stellten keinen wirklichen Bruch mit dieser Struktur dar – ganz im Gegenteil. Durch diese Gegenbeispiele fühlte sich die Mehrheit in der Norm erst bestätigt.
Ich passte weder ins heterosexuelle Bild, was andere wahrscheinlich von mir hatten, noch taugte ich als schwules Gegenbeispiel. All das Wissen von heute über die Eigenständigkeit nicht-monosexueller Orientierungen, über Bisexual Erasure, Bi+- und Pansexualität oder Polyamorie besaß ich damals noch nicht. Einmal mehr fehlten mir die Worte, um das Bild, was sich andere von mir machten, korrigieren zu können. Das betraf meine sexuelle Orientierung ebenso wie die Klasse meiner Herkunft. Allein, dass ich als Mann Schmuck trug, löste schon eigenartig verklemmte Belustigung aus, meine Tätowierungen versuchte ich, wo es ging, zu verbergen. Die Dominanz traditioneller und distinguierter Haltungen in jener jungen Berliner Literaturszene, in der ich mich fortan bewegte, änderte sich auch nicht, als ich Jahre später den größeren Literaturbetrieb kennenlernte. Auch als – nach zwei Jahren Sprechausbildung – erste Lesereisen und Präsentationen auf der Leipziger Buchmesse folgten, blieb das Berliner Umfeld unverändert. Einzige Lichtblicke für mich waren ein paar queere und sehr kollegiale Autor*innen und Verleger*innen, die ich auf der Messe kennenlernte. Beziehungskonstellationen jenseits der Ehe oder nicht-heterosexuelle Orientierungen waren im Berliner Kreis aber weder Themen unserer Gespräche noch kamen sie in der Literatur vor.
In den Siebzigerjahren geboren, war ich im Schnitt fünf bis acht Jahre älter als die anderen Autor*innen und Verleger*innen, mit denen ich in Berlin zu tun bekam. Warum ich mit Mitte 30 noch nicht verheiratet sei, wollte man wiederholt von mir wissen. Jahre später gefolgt von der Frage, warum ich mit 40 immer noch kinderlos sei. In dieser neuen Welt, die ich betreten hatte, traf ich auf Achtzigerjahrgänge, die bürgerlicher waren als meine Eltern. Dass die jungen Menschen dieses Kreises bereits mit Anfang 20 souverän über Buchmessen stolzierten, Verlage gründeten und reflektierte Bücher veröffentlichten, war natürlich ohne ihre bildungsbürgerliche Herkunft undenkbar. Es ging gar nicht so sehr um ökonomisches Kapital, das die Eltern ungern in die verrückten Projekte ihrer Kinder stecken wollten, vor allem war es das kulturelle und symbolische Kapital, was ihnen den Mut und die Sicherheit bescherte, solche großen Schritte trotz der wenigen Lebensjahre zu wagen.
Surreale Literatur
Über die Jahre arbeitete ich an meiner literarischen Stimme und widmete mich natürlich auch den ‚klassischen‘, kulturellen Beständen, die mich reizten, die ich aber immer gebrochen sehen wollte. Gleichzeitig wollte ich die herkömmliche Wahrnehmung von Welt nicht radikal ablehnen, sie doch aber herausfordern und nicht einfach nur mit meiner Literatur aktualisieren. So entwarf ich zahlreiche Parallelwelten, bürgerliche ebenso wie phantastische und utopische. Ich wollte auch problematische Figuren schaffen: brutale Väter, faschistische Großväter, unterdrückte Mütter, mythisierte Töchter, triumphierende Göttinnen, suizidale Söhne. Das war meine Art, nicht nur affirmativ mit griechischen oder ägyptischen Mythen, Literatur- und Kunstgeschichte oder Religionen umzugehen.
Als in einer Rezension meines ersten Erzählbandes Gedanken aus Schwerkraftland (2007) von surrealer Literatur gesprochen wurde, fand ich diese Wendung so treffend, dass ich sie bis heute verwende. Das war es, was ich wollte: Schreiben gegen den naiven Realismus, Schreiben gegen die problematischen (Erzähl-)Strukturen im Mythos, Schreiben gegen die Normen. Und ich musste schreiben über meine eigene Sozialisation und Herkunft, was bedeutete, über Gewalt zu schreiben, vor allem über sprachliche Gewalt und Sprachlosigkeit.
Das Private ist politisch
Ich verstand meine Literatur damals zwar als kritisch und surreal, aber immer noch nicht als politisch. Die psychosozialen Zugriffe schienen mir plausibler. Wieder war es mein Verleger, der mich auf den Gedanken brachte, dass die literarische Verarbeitung der Biografie (heute würde man es autofiktionales Schreiben nennen) auch politisches und selbstermächtigendes Potenzial habe. Das Private ist politisch. Aus anderen Kontexten kannte ich das Motto bereits. Zögerlich freundete ich mich mit dem Gedanken an, dass mein Schreiben die herkömmliche literarische Reflexion meiner Ego-Perspektive übersteigen könnte und widmete mich diesem Zugriff in meinem zweiten Buch Minkowskis Zitronen (2011).
Es dauerte noch einmal drei Jahre, dann entschied ich mich, auch jenseits des eigenen Schreibens politischer zu werden. Das bedeutete, gerade in dieser bildungsbürgerlichen, heteronormativen Welt des Literaturbetriebs soziokulturell aktiv werden zu müssen. Das war der innere Beweggrund. Es gab auch einen äußeren. Die gesellschaftspolitischen und später parlamentarischen Veränderungen in Deutschland machten die Sache dringlich, denn so viel wusste ich aus der Geschichte dieses Landes: Das Bürgertum mit seiner Tendenz, abweichende Teile des sozialen Miteinanders unsichtbar zu machen, ermöglichte erst den Aufstieg rechtsnationalistischer und faschistischer Projekte und Parteien. Es war fast so, als ob der immer dringlicher werdende Kampf gegen die politischen Unsäglichkeiten wie AfD, Demo für alle, PEGIDA & Co. in meine Literatur drängte. Nicht ich wählte diesen Kampf als Thema, er wählte mich und meine Literatur.
Anti-queere Struktur trotz des angeblichen Trends
Seit ich mich für mehr Sichtbarkeit queerer Autor*innen und Stoffe im Literaturbetrieb einsetze, hat es Gegenwind gegeben. Zu glauben, dass sich nach zehn Jahren etwas Grundlegendes geändert haben könnte, war naiv. Ein bisschen Bewegung kam in den Betrieb, Konzepte wie „Literatur als soziale Praxis“ z. B. entstanden. In den letzten Jahren wurde sogar von einem Trend queerer Literatur gesprochen. Übersetzungen von Ocean Vuong oder Edouard Louis erschienen in großen Verlagen, wurden von der Kritik gefeiert und queere Klassiker wie Eileen Myles endlich ins Deutsche übersetzt. Und doch ist die Präsenz queerer Autor*innen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur immer noch bescheiden.
Die Reaktionen einiger meiner Leser (es waren tatsächlich nur cis-männliche), die wohl dachten, ich knüpfe mit meiner Literatur und der Auseinandersetzung mit Kunstgeschichte, Mythologie und Religionen an die kulturellen Arrangements patriarchaler, familialistischer und ethnozentristischer Sinnbezüge an, waren geprägt von Verwirrung und Enttäuschung. Ich sprach und schrieb jetzt nämlich über meine eigene Literatur, wie ich sie deute. Das hatte ich mich vorher nicht getraut. Die Enttäuschungen waren groß. So groß, dass ich Schimpftiraden per Email oder anderes Getrolle auf den Social Media-Präsentationen meiner queeren Projekte, wie z. B. der Lesereihe „Schreiben gegen die Norm(en)?“, über mich ergehen lassen musste.
Die direkten Reaktionen hätte man erwarten können. Es gab aber auch subtile. Welche, die anti-queeres Potenzial unterschwellig deutlich werden lassen; welche, die strukturell begründet sind durch Institutionen, Medien, Sprache und Mentalität. Einstellungen, die so fest zementiert und naturalisiert sind, dass sie trotz oberflächlicher Offenheit gegenüber von der Norm abweichenden Positionen und Literaturen (siehe Tokenismus), scheinbar keine Reflexion, ja nicht mal Wahrnehmung möglich machen.
Kulturelle Selektionsprozesse in Deutschland
Das sind dann die Situationen, in denen ein linker Berliner Verleger, der sonst um differenzierte Sprache und sozialphilosophische Sensibilität bemüht ist, Menschen mit nicht-heteronormativer Orientierung als „Gender“ bezeichnet und auch nach mehrmaligen Nachfragen meinerseits keine Stellung dazu bezieht. Oder, wenn ein Buchhändler bei einem großen Publikumsverlag anfragt, was im Klappentext eines Spitzentitels das Wort „queer“ bedeute und warum der Verlag ein so unbekanntes Wort verwende. Dieses Verhalten ist fester Bestandteil kultureller Selektionsprozesse in Deutschland. Etwas, was feministischen, queeren, jüdischen und (post-)migrantischen Positionen kulturbedingt seit eh und je widerfährt: dass sie unsichtbar gemacht werden.
Die kulturimmanente deutsche Marginalisierung zeigt sich auch an einer Erfahrung, die eine befreundete Berliner Jurorin in der Sitzung eines renommierten Verlagspreises machte. Eine im Literaturbetrieb gut situierte Mitjurorin kommentierte das queere Buchprogramm des Berliner Querverlags mit „das will doch niemand lesen“. Meine Freundin, selbst Autorin, die queeres Engagement in der Literatur unterstützt, hatte den seit 1995 bestehenden Querverlag für den Preis vorgeschlagen. Selbst ausgeprägte und über Jahre hinweg bewährte, progressive Strukturen schützen also nicht vor der Unsichtbarmachung durch die hegemoniale Mehrheitsmeinung bestimmter literaturbetrieblicher Instanzen und mächtiger Entscheider*innen.
Was leider auch nicht schützt, ist die Zugehörigkeit zur queeren Community. Zugegeben, diese Community ist heterogen, man kann nicht unbedingt Solidarität erwarten, auch wenn sie für die politische Meinungsbildung so wichtig wäre. Wenn man aber von einem Herausgeber zu hören bekommt, dass er ungern zur „besseren Frauenbeauftragten mutieren“ wolle, nachdem man nach der Geschlechterverteilung der Autor*innen einer queeren Anthologie gefragt hat, ist einfach nur entmutigend. Was mich ebenso immer wieder verwundert, sind Strukturen, die seitens (pro-)queerer Verwerter*innen auf den einkalkulierten Ausschluss von Personen des sogenannten Milieus der unteren Mitte setzen. Wenn Buchpräsentationen – die meistens nichts weiter als Marketingveranstaltungen für das neu erschienene (queere) Buch sind – bewusst in distinguierten Locations des sogenannten sozial gehobenen Milieus veranstaltet werden, ausschließlich in englischer Sprache stattfinden und der Eintrittspreis 15 Euro beträgt.
Kultur ohne Vagheit und Variabilität ist nicht denkbar
Nach wie vor setzen sich also die Abgrenzungen vom jeweils signifikant Anderen durch. Identitäten haben zwar Konjunktur, viel zu selten werden sie aber als Ansammlung unterschiedlicher Verortungen unter anderen Verortungen betrachtet. Das gilt auch für den Literaturbetrieb. Wer einmal in einem Genre schreibt, schreibt in der Regel immer in diesem Genre. Wer verwertend tätig ist, hat es schwer, auch produzierend tätig werden zu können. Wer queer ist, kann nicht auch noch feministisch sein oder migrantisch oder aus Ostdeutschland oder jüdischen oder christlichen Glauben haben. Das sind doch viel zu viele Merkmale! Es überfordert.
So wie Verleger*innen, Lektor*innen, Buchhändler*innen und Leser*innen von allzu viel Diversität angeblich auch überfordert sein sollen: Von homosexuellen Figuren in Romanen, die eine Hauptrolle spielen oder kein Interesse an Sex haben. Oder von Erzählungen, deren narratologischer Aufbau nicht dem mythischen Prinzip der maskulinen Heldenreise entspricht, in der Bisexualität bloß ein Abenteuer ist, das durch die heldenhafte Entscheidung für Heterosexualität überwunden werden muss. Die Literatur ist auch in dieser Hinsicht kulturelles Symbol für einen alles durchdringenden Entscheidungszwang. Da wundert es nicht, dass auch jene Texte angeblich überfordern, in denen die Pronomen „sie“ und „er“ fehlen.
Das alles sind Mythen und Klischees. Kultur ohne Vagheit und Variabilität ist doch gar nicht denkbar. Menschen ohne Vagheit und Variabilität sind nicht denkbar. Dabei braucht man vor Identitäten ja keine Angst zu haben. Gefährlich werden sie nur, wenn sie sich nicht verändern, sondern starr bleiben, wenn sie nicht floaten oder strayen. Sozialwissenschaftlich gesehen sind Identitäten streunende Hunde, die ins Wasser gefallen sind und nun hierhin und dorthin treiben. Ab und zu rudern sie beherzt mit den Vorderbeinen, um starker Strömung zu begegnen oder Untiefen zu umschwimmen. Das ist die Bewegung menschlicher Identitäten im Verlauf der Biografie, der empirisch belegte Normalfall. Und doch wird in weiten Teilen immer noch am singularistischen Identitätsmythos und an anti-pluralistischen Erzählhaltungen festgehalten.
Queere Figuren und Stoffe besitzen genauso Identifikationspotenziale wie heterosexuelle Charaktere, Literatur über „weibliche Körper“ ist genauso relevant (vor allem dringlich) wie der einseitige Kanon der Literatur über „männliche Körper“. Literatur ist auch dann spannend und interessant und unterhaltsam, wenn sie sich kritisch mit sozialen Normen, gesellschaftlichen Machtgefügen, mit Klassismus, Rassismus oder Zweigeschlechtersystem auseinandersetzt, oder sich literarischen Kategorisierungen und Klassifizierungen entzieht.
Ich werde oft gefragt, was queere Literatur eigentlich genau sei. Was sie ist, interessiert mich nur zweitrangig. Was sie sein könnte, finde ich fruchtbarer für mein Denken. Queer ist für mich vor allem ein bestimmtes Denken. Und das bedeutet immer mehr als nur der Verweis auf von der Norm abweichende Geschlechter, Geschlechtsidentitäten oder sexuelle Orientierungen. Ich denke queere Literatur als zeitgemäße politische Literatur. Das könnte sie sein – ohne selbst Politik sein zu wollen oder politische Symbole statt künstlerischer Symbole zu verwenden. Queere Literatur stört den hegemonialen Symbolkanon durch die Geschichten der bisher Ungehörten, sie macht die Strukturen und sozialen Verfugungen sichtbar, sie ermöglicht kritische Unterhaltung.