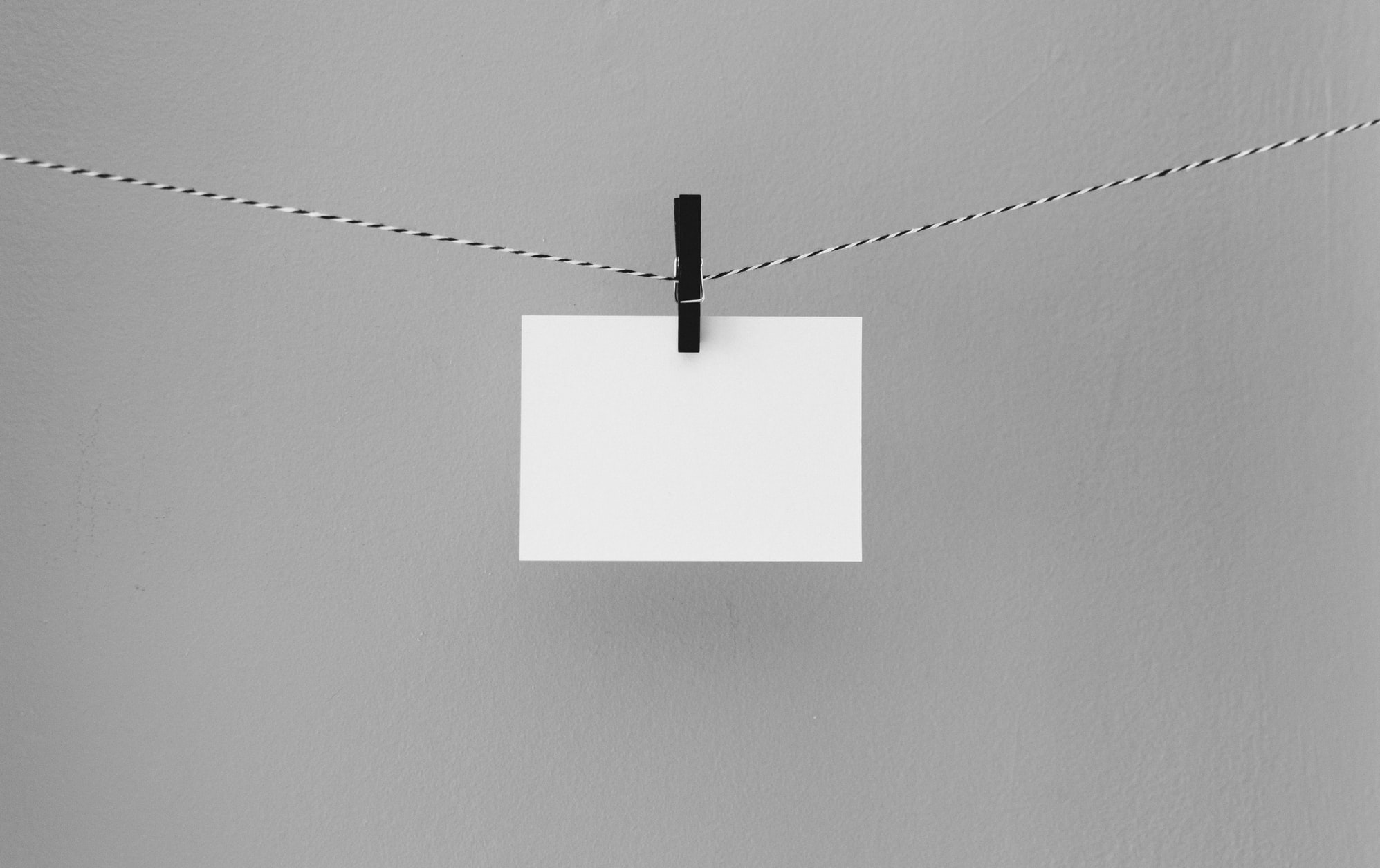Auszug aus einem Romanprojekt von Slata Roschal
5.
Es war ein goldener Ohrring mit einem kleinen Brillanten, der irgendwo im Erdgeschoss in der Mensa sein musste, ich schrieb Anzeigen, klebte sie auf Pinnwände, schrieb in einem studentischen Forum, ging zur Information, ob jemand vielleicht einen goldenen Ohrring, den Brillanten sparte ich aus, abgegeben, die Frau wunderte sich und lächelte und ich schämte mich. Und einmal ein Ring, mit einem kleinen, ungemein teuren Rubin (ich hab schon immer gesagt, kauf nichts bei den deutschen Juwelieren, bestell bitte aus dem russischen Katalog, hier, und jetzt hast du es), er wurde mir zu groß und glitt einfach vom Finger, irgendwo zwischen dem 3 und dem 4 Gleis des Ostbahnhofs, in der Nähe des Getränkeautomaten, dort, wo abends Mäuse herausgelaufen kommen, nach Krümeln, vielleicht auch Ringen suchen, und sie in ihren Vorratskammern unterhalb des Getränkeautomaten verstecken.
22.
Einsame, liebevolle und wunderbare russische Damen zum Heiraten und Lieben. Unsere bildhübschen russischen Single Frauen auf der Partnersuche suchen einen ehrlichen und treuen Lebenspartner und Mann, um eine glückliche Lebenspartnerschaft und Familie zu gründen für eine gemeinsame, glückliche Zukunft.
Die meisten russischen Frauen lehnen den westlichen Feminismus ab, und versuchen eher, Erfolg und Charme zugleich zu leben.
Die russischen Frauen lieben ihr Land, sie fühlen sich als Bürgerinnen des größten Staates der Welt und sind stolz darauf.
Die russischen Frauen sind wesentlich toleranter und geduldiger als westliche Frauen, das liegt daran, dass in Russland gegenseitige Hilfe und Abhängigkeit innerhalb der Familie ganz großgeschrieben wird.
Es ist sehr wichtig für russische Frauen, die im Ausland leben, sich nützlich zu fühlen. Die russischen Frauen mögen es nicht, ohne Aktivitäten zu sein, sie arbeiten gerne.
Rechnen Sie mit einer Wartezeit von etwa einem Jahr, bevor Sie mit ihr Kinder haben werden.
Wenn Sie Ihre Brieffreundin etwas fragen wollen, fragen Sie direkt, ohne Umwege, aber sehr höflich.
Versuchen Sie, die slawische Seele zu verstehen. Das ist entscheidend in der Korrespondenz mit einer russischen Frau.
Lächeln Sie auf allen Fotos.
Hüten Sie sich vor ukrainischen oder russischen Anzeigenseiten, die gratis angeboten werden.
Schicken Sie den Damen, mit denen Sie in Kontakt treten, niemals Geld.
Treten Sie in Kontakt mit mehreren Damen ein. Eine russische Frau hat es lieber, wenn der Mann sie unter mehreren Damen nach längerem Briefwechsel ausgesucht hat.
Falls auch Ihre zweite Email ohne Antwort bleibt, schicken Sie einen Brief auf dem Postweg, vielleicht hat sie ein Problem mit ihrem Computer.
Die meisten russischen Frauen sprechen weder Englisch noch Deutsch.
Wenn Sie auf Englisch schreiben, benutzen Sie einfache Wörter, um sicher zu gehen, dass sie Sie verstehen wird.
Benutzen Sie nicht den Google-Übersetzer.
Schicken Sie niemals Geld.
Nehmen Sie zum ersten Treffen einen Dolmetscher mit, falls Ihre Russisch-Kenntnisse nicht ausreichen.
Sobald sie verheiratet sind, schreiben Sie Ihre Liebste in einen Deutschkurs ein (russische Frauen sind begabt für Fremdsprachen), und sie wird wesentlich weniger Heimweh haben.
Sie können jederzeit auf einen Dolmetscher zurückgreifen, wenn Ihre Frau noch nicht gut Deutsch spricht.
23.
In unserer Stadt gab es zwei kleine russische Geschäfte, in denen man slawische ‒ meist in Deutschland hergestellte ‒ Lebensmittel kaufen konnte, Käse, Quark, Pelmeni, Schokoladenpralinen, Limonade, Getreideflocken, Konserven, aber auch Spielzeug aus China, selbstgebrannte DVD-Filme, und man konnte dort Pakete abgeben, die man in sein Heimatland schicken wollte. Für viele unsere Bekannte waren diese Läden überlebenswichtig, auch wenn es eine offizielle Deutsche Post und gewöhnliche Discounter mit russischen Lebensmitteln gab. Sie trugen seltsame Namen, 5+ PLUS zum Beispiel, das Plus als Zeichen und Wort nebeneinander wies auf die ausgezeichneten Qualitäten des Ladens hin, während im deutschen Schulsystem die Fünf nur für mangelhaft stand. Das andere Geschäft hieß Rasputin, ähnlich düster schaute der stämmige Besitzer an der Kasse, er sollte zusammen mit seinen drei erwachsenen Söhnen vor Kurzem ein eigenes Haus im benachbarten Dorf gebaut haben, und unser Bekannter erfuhr von einem anderen Bekannten, dass es zweieinhalb Stockwerke hatte. Seine Frau stand an der Frischwarentheke, schnitt und wog Käserollen ab, angelte gesalzenen Hering aus einer Holztonne. 5+ PLUS war zu zentral gelegen und schnell bankrott, wir wechselten zu Rasputin. Dort war es eng und staubig, die Kunden kannten einander, es gab Sympathien, verborgene Feindschaften gegenüber dem Ladenbesitzer und seiner Frau, wir wussten über ihre Einkommensverhältnisse Bescheid, achteten nicht auf ein abgelaufenes Haltbarkeitsdatum und diskutierten an der Kasse, warum hier alles so teuer sei.
38.
Wenn ich unsterblich wäre, würde ich mir Fehler zugestehen können, so aber läuft die Zeit davon, zerrinnt zwischen den Fingern, und bald schon werde ich nicht schön sein und werde meinen immer fauler werdenden Körper durch einwandfreie teure Kleidung, durch Botoxinjektionen, Bleaching regelmäßig, aufrecht erhalten müssen, und wer weiß, ob ich das Geld dazu haben werde, ob ich noch einen Mann haben werde, mit gutem Verdienst und oder Eigentum, ob ich das alles alleine bezahlen kann, ob meine Einsparungen, bislang hundertdreißig Euro auf dem Extra-Konto und hundertfünfzehn im weißen Briefumschlag, zwischen Benn und „Einführung in die Mediävistik“ eingeklemmt, für all das reichen werden.
110.
Unser Wochenende verbrachten wir zuhause, im Discounter, im Tierpark, auf einem Spielplatz, am Meer, am See, in der Eisdiele, meist verbrachten wir es zusammen, zu dritt, und an jedem Sonntagabend freute ich mich auf Montag. Ich hatte sie gern, meine Männer, den Großen, den Kleinen, und doch nervten mich unsere gemeinsamen Wochenenden ungemein, sodass ich ihnen beiden gegenüber am Sonntagabend massive Antipathie verspürte, den Kleinen so früh wie möglich ins Bett brachte, ein sinnloses, nie gelungenes Vorhaben, den Großen ignorierte, anzischte, auf irgendeine Weise zu demütigen versuchte in Form von Befehlen und Ekelbekundungen (wäscht du jetzt endlich das Geschirr ab, willst du dich nicht mal duschen), ja ihn manchmal bespucken, verprügeln wollte und dann vor dem Einschlafen, mit fester Zuversicht auf den Montag, den Tag der Arbeit, ihn wieder um Vergebung bat. Auch dem Kleinen gegenüber war ich oft unbeherrscht und grob, sein unverhältnismäßiges Schreien bei jeder Kleinigkeit brachte mich immer wieder aus der Fassung, mein junges Leben erschien mir umsonst vergeudet, die Weiterentwicklung meiner Talente gegen eintönige, unausgeschlafene Heimexistenz eingetauscht, ich hatte keine Freude daran, Sachen zu erklären, die ich schon kannte, und zweifelte daran, ob ich die geeignete Beziehungsperson für mein Kind, überhaupt für ein Kind wäre. Auch wusste ich nicht, ob ich in meiner Arbeit es zu etwas bringen würde, ob ich klug und energisch genug wäre, und litt einerseits an den zwecklosen, deckungsgleichen Wochenenden, empfand sie wiederum auch als Strafe für mein Versagen während der vorangegangenen fünf Tage. Was wir dem Kind gaben, wurde von ihm nicht geschätzt, kein einziges Mal sagte es aus eigenem Wunsch heraus Danke, und das Komplizierteste daran war, dass wir kein Recht hatten, einen Dank zu erwarten, uns bewusst auf eine jahrelange einseitige parasitäre Beziehung eingelassen hatten. Glaubt er mir, dass ich ihn geboren habe, fragte ich mich abends, wenn sein zartes Gesicht einschlief, habe ich ihn überhaupt geboren, woher sollte ich es wissen, meinem Körper waren keine Spuren mehr davon anzusehen, keine Beweise, ich habe keine Nabelschnur gesehen, keine Geburt. Wie kann mein Mann glauben, dass ich ein Kind von ihm geboren habe, sein Leben von diesem Glauben bestimmen lassen, wenn nicht mal ich daran ganz glaube, und doch fungierte er als Zeuge dessen, was ich selbst nicht gesehen habe. Unser Zusammenleben basierte auf einem gegenseitigen, mal erstarkenden, mal abfallenden Glauben an unsere körperliche Verbundenheit, und ich war das Mittelglied zwischen dem Großen und dem Kleinen, von anderem Geschlecht zwar, vielleicht deshalb aber trotz aller Unbeherrschtheit akzeptiert, der Große war das Bindeglied zwischen mir und dem Kleinen und umgekehrt, drei hoch drei gerechnet, neun unterschiedliche Stränge, die uns verbanden. Ich putze das Waschbecken von Resten roter Kinderzahnpasta frei, sortierte Socken nach Formen und Farben, und erlangte nicht den Status einer Guten Mutter in den Augen anderer Frauen, Freundinnen, Kolleginnen, Bekannten, unserer Vermieterin, Kindergartenleiterin, Kinderärztin, meiner Mutter, alles, was ich tat, war ein obligatorisches Minimum, von Guter Mutter weit entfernt. Einmal die Woche kam eine Putzfrau, wischte das Treppenhaus und ich litt aus weiblicher Solidarität, wenn ich an ihr vorbeiging, vielleicht wäre es meine Aufgabe gewesen, die Treppen zu wischen, immer waren es Frauen, die Treppen wischten, warum sollte ich besser sein als sie. Was soll das denn sein, fragte er, weibliche Solidarität, und wir küssten uns, prallten mit den Mündern aufeinander, warm, weich, und wenn mich das andere, kleine, zarte Gesicht küsste, sah ich ein, dass ich auch daran zu glauben lernen musste, dass mein Kind mich mag, nicht für immer vielleicht, aber dass ich nichts zu verlieren hatte, außer als mich zu irren, und dass ich nicht alles bis ins Unendliche beweisen konnte.
118.
Zwei Arten von Leuten gab es, die einen fragten, wann wir ein zweites Kind bekommen, da uns das erste schon so gut gelungen, da wir ja gut miteinander auskamen und ein zweites sicher guttun würde, ein Verzicht auf ein zweites, ohne nachvollziehbaren Grund, war absurd und verdächtig, dass wir wohl doch nicht so gut auskamen miteinander. Und die anderen, die ignorierten auch das eine Kind, stellten es sich als eine Art zusätzliches Projekt vor, in das man je nach Möglichkeit Zeit investierte, eine kleine Beeinträchtigung, die mit genug Babysittern zu überspielen war, eine konservative Geste, Geschlechtsverkehr mit Kinderzeugung zu verbinden. Aufenthaltsstipendien etwa waren für freie Persönlichkeiten gedacht, die für fünf Monate nach Rijeka gingen, für zwei Monate nach Ahrenshoop, für ein Jahr in die Villa Massimo, einen dichten Lebenslauf erstellten, ohne jeden Abend Hausaufgaben zu kontrollieren, an Schulferien, Krankheiten, Wachstumsschübe gebunden zu sein. Zur Elite deutscher Künstler, wie in einer Ausschreibung bezeichnet, gehörten keine Künstler mit Kindern, oder keine mit kleinen Kindern, oder keine Frauen mit Kindern, das war klar und irgendwie seltsam, das hat mir keiner gesagt bisher, dass ich mich selbst wieder ausgeschlossen habe aus einem Kollektiv, zu dem ich gehören wollte, da half kein Migrationshintergrund, kein gutes Porträtfoto, obwohl ich nichts geändert hätte, wenn ich es könnte, nur, es musste einen Weg geben, das zu werden, was ich wollte, die Angst zu verlieren vor Abweisungen, mich weniger zu ärgern, oder einfach abzuwarten.
129.
Wenn wir abends, wenn das Kind schläft und wir uns gegenüber in der Küche sitzen, jeder an seinem Notebook, verspüren, dass wir uns gleichgültig geworden sind, zu vertraut und fremd zugleich, dass wir uns gegenübersitzen, weil wir ein gemeinsames Konto und ein gemeinsames Kind haben, die Grundmerkmale einer ehelichen Gemeinschaft, dass wir nie mehr, zumindest die nächsten zehn Jahre, zu zweit ins Theater oder ins Kino gehen und immer, jeden Abend, von Jahr zu Jahr, in der Küche sitzen werden, jeder an seinem Notebook, wenn wir das verspüren, wenn dieser Gedanke in dem Raum zwischen uns entsteht, immer größer, fester, prophetischer wird, werde ich wütend, klappe mein Notebook zu und fordere ihn zum Sprechen auf, er erschrickt, verteidigt sich, zieht den Kabel aus der Steckdose, überlegt, wir reden, dann steht er auf, küsst mich und schlägt vor, ins Wohnzimmer zu gehen.

Slata Roschal – *1992, Studium von Slawistik, Germanistik, Komparatistik in Greifswald, z.Z. Promotion in Slawistischer Literaturwissenschaft an der LMU München, Veröffentlichungen von Lyrik und Kurzprosa in Literaturzeitschriften und Anthologien, Textwerkstätten (u.a. Edenkoben), 2019: Debütband Wir verzichten auf das gelobte Land bei Reinecke & Voß Leipzig. Diese Texte sind Auszüge aus einem laufenden Romanprojekt, 148 Formen des Nichtseins, das u.a. durch ein Arbeitsstipendium der Stiftung „Zurückgeben. Stiftung zur Förderung jüdischer Frauen in Kunst und Wissenschaft“ gefördert wurde.








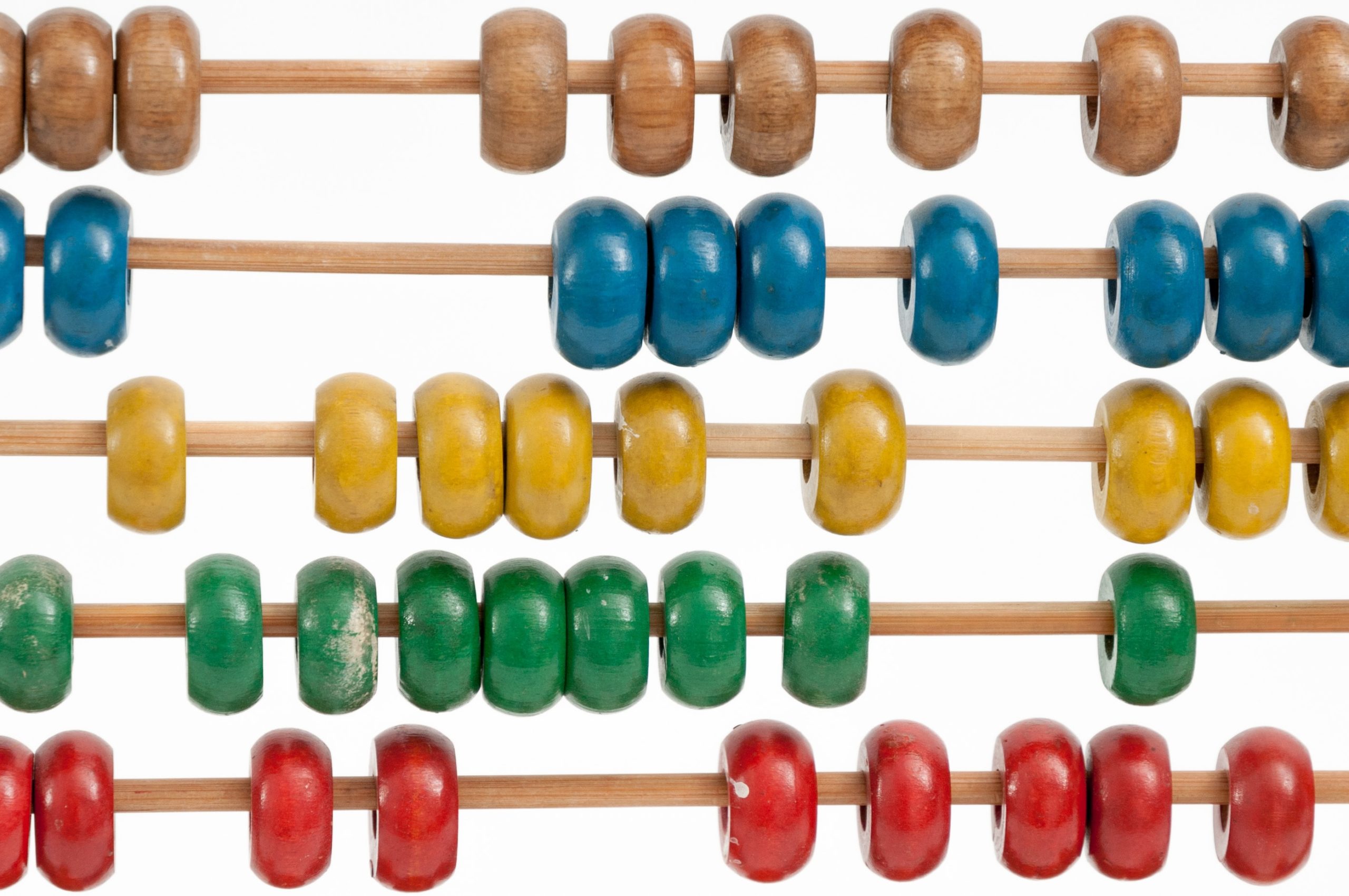
 Arztbesuch, Öffentliches Leben und Katastrophenmanagement – nutzt sie als Schauplätze, um evidenzbasiert (also auf Basis empirisch ausgewerteter Daten) die Benachteiligung von Frauen vorzuführen. Es geht ihr darum, die (Gender-)Neutralität von Algorithmen in Frage zu stellen und die weibliche Hälfte der Bevölkerung zu rezentrieren. Denn obwohl wir geradezu manisch Daten sammeln, bleiben Frauen zu oft unsichtbar: „Frauen werden nicht gesehen, und man erinnert sich nicht an sie, weil Daten über Männer den Großteil unseres Wissens ausmachen.“
Arztbesuch, Öffentliches Leben und Katastrophenmanagement – nutzt sie als Schauplätze, um evidenzbasiert (also auf Basis empirisch ausgewerteter Daten) die Benachteiligung von Frauen vorzuführen. Es geht ihr darum, die (Gender-)Neutralität von Algorithmen in Frage zu stellen und die weibliche Hälfte der Bevölkerung zu rezentrieren. Denn obwohl wir geradezu manisch Daten sammeln, bleiben Frauen zu oft unsichtbar: „Frauen werden nicht gesehen, und man erinnert sich nicht an sie, weil Daten über Männer den Großteil unseres Wissens ausmachen.“