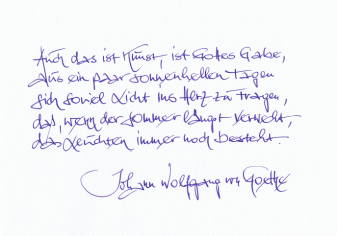Sehr geehrter Herr Prof. Raddatz,
die letzten Tage schlief ich schlecht, denn ich bin ein sehr schlechter Schwimmer. Doch seit ich in Hamburg wohne und die Vorstellung Ihrer Tagebücher verpasste, plane ich einen Besuch im Holthusenbad, um Sie bei Ihrem „morning swim“ zu treffen und mit Ihnen zu sprechen. So legte ich mir bereits viele Gesprächseinstiege zurecht die Situation eines Ihnen im Schwimmbad auflauernden jungen Mannes zu erklären. Da ich Sie heute aber nicht antraf, stattdessen nur ein 5 Euro teures Duschbad nahm, ich aber viel hätte sagen wollen, schreibe ich Ihnen diesen Brief.
Die große Zeit des Raddatz’schen Feuilletons in der Hamburger Wochenzeitung liegt vor meiner Geburt und erst vor knapp einem Jahr stieß ich auf Ihre Tagebücher. Zuerst skeptisch, zunehmend angezogen und später wie im Wahn las ich diese, die letzten 500 Seiten des ersten Bandes an einem Stück. Meine Freunde fuhren mir über den Mund und verbaten sich eines Abends, Sie ständig als meine Referenz zu nennen, so sehr war ich in Ihren Aufzeichnungen gefangen, so sehr bestimmten Sie in dieser Zeit selbst mein alltägliches Denken.
Ich las Ihre Autobiographie, weilte auf Sylt, verschlang dreimal, jeweils auf der Hin- und Rückfahrt und einmal am Strand, Ihre Liebeserklärung an die Insel und wartete sehnsüchtig auf den nächsten Band Ihrer Tagebücher. Im Internet sah ich alte Sendungen, in denen Sie zu Gast waren und fand alte Interviews. Nach dem zweiten Band Ihres Diariums las ich „Lieber Fritz“, nun begleiten mich Ihre „Stahlstiche“; „Die Tagebücher in Bildern“ und die Sammlung Ihrer Romane sind bereits geordert. Von wenigen Autoren, und keinem Journalisten, habe ich derart begeistert jegliche Veröffentlichung gelesen, von keinem in derart schnell aufeinanderfolgender Lektüre ohne mich satt zu fühlen.
Aus jedem Ihrer Texte spricht die Leidenschaft für das Sujet, in jedem steckt soviel von Ihrer Persönlichkeit; viele berühren mich tief. In Ihren Tagebüchern sind Sie zuweilen ein spitzzüngiger Spötter, aber eben auch, nein vor allem, dieser sensibler Mensch, dessen menschliche Enttäuschungen und Ängste bewegen. Ihre Ehrlichkeit, Ihre Geschichte und Persönlichkeit, die Sie (allen) Ihren Texte zu Grunde legen, erzeugt eine Authentizität, die mich glauben lässt Sie zu kennen und ich fühle mich Ihnen nah.
Anders als Sie bei der Lektüre der Gide Tagebücher verspürte ich bei den Ihren keine “wachsende Enttäuschung, [weil] doch fast nur dünn aufgegossener Literatur-Klatsch (mit sehr/zu vielen Einschüben von Attacken auf ihn, zumal über Leute und Phänomene, die heute meist vollkommen verblaßt – was allerdings dem Herrn FJR mit seinen Tagebüchern ebenso passieren wird!)”. Auch wenn es nicht zu leugnen ist, dass bereits viele Begebenheiten und Autoren als damaliger Zeitgeist heute nicht mehr viel beachtet werden, verblassen diese nicht, vielmehr leuchten Sie in Ihren Büchern. Hubert Fichte und Paul Wunderlich, um nur zwei zu nennen, waren mir vor der Lektüre Ihrer Bücher unbekannt, ich musste sie erst nachschlagen, heute betrachte ich mit Freude die Bilder, lese mir unbekannte Autoren. Entgegen der von Ihnen geäußerten Bedenken gibt es heute noch genügend, auch junge, Menschen, die sich für Kultur und Literatur dieser Zeit begeistern können, sie brauchen einen Lehrer, ich lerne aus Ihren Tagebüchern.
Weiterhin keine wachsende Enttäuschung, weil Sie immer wieder auf frappierende Weise ehrlich sind, nicht nur mit Ihren Mitmenschen, sondern eben auch mit sich selbst. Sie sprechen über eigene Arroganz, Ihren Stolz, über die Enttäuschungen, Angst und den Tod. Niemand gibt so redlich über sein Innerstes Auskunft, schreibt seine Schwächen nicht klein, sondern gesteht sie und das trotz der vielen, häufig so persönlichen und verletzenden, Kritik.
Neben dieser persönlichen Ebene durchleuchten Sie den Kulturbetrieb, die Sehnsucht aller Künstler nach Anerkennung, die Ränkespiele untereinander, Intrigen und Fallen, Sie eröffnen und demaskieren eine Welt, die mir vorher zu großen Teilen unbekannt war, ich lerne aus Ihren Tagebüchern. Dazu schaffen Sie es, fast beiläufig in einem Tagebuchnotat, immer in Ihren großen Kritiken, Literatur auf den Punkt bringen, den Stil eines Autors in einen Satz einzuschmelzen. Sie vermitteln Ihre Liebe und Begeisterung für Literatur und Kunst, Sie erzeugen bei mir ein Bedürfnis alle von Ihnen gelobten Werke sofort zu konsumieren, Sie machen mich neugierig und klüger.
Ihre Bücher bilden seit gut einem Jahr die Grundlage meiner Bildung. Ich verdanke Ihnen viel und möchte dem Menschen, den ich durch die Lektüre intimster Berichte zu kennen meine, danken für die Freude, die Sie mir mit jedem Ihrer Texte machen, alle habe ich mit Gewinn gelesen. Auf diesem Wege, unpersönlicher, aber vollständig bekleidet, möchte ich Ihnen meine Hochachtung übermitteln und erneut aufrichtig danken.
Es grüßt Sie herzlich
[Diesen Brief hat Fritz J. Raddatz über seine Sekretärin Heide Sommer im Mai 2014 von mir tatsächlich erhalten.]