Die Sprache vom Rand her bereichern
Eine Gedichtübersetzung kann aus mehrerer Hinsicht als gelungen gelten. Eine ist, dass ihr Genießer Neid auf die verspürt, die die echte Sprache kennen.
Doreen Daume war so jemand. Ihrer übersetzerischen Leidenschaft verdanken wir, die des Polnischen Unkundigen, die Bekanntschaft mit Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki [Tkátschischín-Ditzki]. Von dem Mann mit dem – auch für Polen – Namen wie ein Zungenbrecher hat sie 2013, dem Jahr ihres Todes, den Gedichtband „Geschichte polnischer Familien” übersetzt. Nun liegt bei der Wiener Edition Korrespondenzen als zweiter Band auf Deutsch vor, „Tumor linguae”. Gern hätte Doreen das selbst übernommen, beteuert im Nachwort Michael Zgodzay, der die Gedichte mit Uljana Wolf eingedeutscht hat.
Der 1962 geborene, in Warschau lebende „Dycio", wie sich Tkaczyszyn-Dycki in seinen Gedichten nennt, genießt in Polen Kultstatus und wurde mit etlichen Preisen ausgezeichnet, darunter 2009 mit der höchsten nationalen Auszeichnung, dem Nike-Dichterpreis.
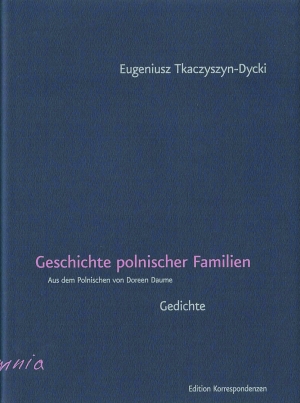 Edition Korrespondenzen „Geschichte polnischer Familien" besteht aus 50 mit lateinischen Ziffern nummerierten Gedichten, jedes drei Vierzeiler lang – manche länger, manche kürzer. Viele der poetischen Gebilde haben auch einen Titel. Sie sind frei von Reim und Metrum. Strukturbildend sind die Enjambements, in Kombination mit fehlenden Satzzeichen, und die Eigenschaft, dass einzelne Halbsätze, Zeilen und zum Teil fast ganze Gedichte im jeweils nächsten Text wieder vorkommen. Dadurch entsteht der Eindruck eines Langgedichts aus 50 Stücken, einer Litanei, worin manche Sätze immer wieder Einsätze geben, um sich an schon aufgeworfenen Fragen von Neuem abzuarbeiten. Einige hintereinander gereihte Gedichte wirken zwar unabhängig voneinander, doch in Summe entsprechen sie dem Werdegang des Poetischen Ich. Auch in der Auswahl von ins Deutsche übersetzten Gedichten aus neun Bänden, „Tumor linguae“, sind die Texte vom Autor durchnummeriert und folgen einer biografischen Entwicklung.
Edition Korrespondenzen „Geschichte polnischer Familien" besteht aus 50 mit lateinischen Ziffern nummerierten Gedichten, jedes drei Vierzeiler lang – manche länger, manche kürzer. Viele der poetischen Gebilde haben auch einen Titel. Sie sind frei von Reim und Metrum. Strukturbildend sind die Enjambements, in Kombination mit fehlenden Satzzeichen, und die Eigenschaft, dass einzelne Halbsätze, Zeilen und zum Teil fast ganze Gedichte im jeweils nächsten Text wieder vorkommen. Dadurch entsteht der Eindruck eines Langgedichts aus 50 Stücken, einer Litanei, worin manche Sätze immer wieder Einsätze geben, um sich an schon aufgeworfenen Fragen von Neuem abzuarbeiten. Einige hintereinander gereihte Gedichte wirken zwar unabhängig voneinander, doch in Summe entsprechen sie dem Werdegang des Poetischen Ich. Auch in der Auswahl von ins Deutsche übersetzten Gedichten aus neun Bänden, „Tumor linguae“, sind die Texte vom Autor durchnummeriert und folgen einer biografischen Entwicklung.
Sehr viele Gedichte erwähnen die abwesende Anwesenheit einer weiteren Person im Nebenraum. Vom Satz „im nebenzimmer stirbt meine mutter“ eingeleitet, stellen sie lapidar die Befindlichkeit und die in dieser Hinsicht unveränderten Umstände des Dichters fest. Der lebendige Fortschritt in den Gedichten konterkariert dieses statische Element; das ergibt eine fiebrige Nervosität. Die Mutter – wegen ihrer Schizophrenie und des Alkoholismus lange Zeit ein Pflegefall – liegt im Nebenzimmer und kann den Dichter jederzeit vom Schreibtisch wegrufen. Obzwar 2009 gestorben, befindet sich Tkaczyszyn-Dyckis Mutter von den ersten bis zu den letzten Gedichten der Auswahl im Nebenzimmer, beschäftigt mit dem Sterben und daher ihren Sohn stets mit dem Thema Tod beschäftigend.
Tkaczyszyn-Dyckis eindringlicher Vortragsstil ist hörens- und sehenswert. Oft tritt er im Schutz der Kapuze seiner dunkelgrauen Zippjacke auf oder präsentiert sich unheimlich, ein Schamane. Als ob von Schmerz oder Alter gebeugt, gebiert der 52-Jährige seine Gedicht-Ketten als dramatisierte Rosenkränze. Im titelgebenden Gedicht von „Tumor linguae“ erklärt er seine Haltung: „worin besteht mein amt ich schreibe gedichte / meine herrschaften gebeugt über imaginiertes / papier wie über mich selbst es durchfließt mich / eingebung flackerndes licht ich schalte es ein".
Mit seinen Eigenarten hatte Dycki es im Literaturbetrieb anfangs nicht leicht. Seine Themen sind im Geist von Rimbaud und Baudelaire zu Sprachkunst erhobene Hässlichkeiten: Friedhöfe bei Nieselwetter, ein Kübel mit Fäkalien, Strichertreffs in Plattenbauten. Seinen Gedichten eignet etwas unverkennbar Abgründiges, das im Kontrast mit Lebendigem einen Reiz auslöst, der im Lesenden ernste Gedanken entzündet. Je öfter man einen solchen Text liest, umso tiefer. Ein Kritiker hat geschrieben, Tkaczyszyn-Dyckis Gedichte würden einen lesen. Das meinen wohl auch die Bilder von Spiegel und Mond darin.
Man hat die Stimmung seiner Gedichte mit dem polnischen Horrorfilm „Haus des Bösen" (2009, Regie: Wojciech Smarzowski) verglichen. Dort erweist sich ein verlassenes Dorf als Hort vergangener Verbrechen. In „Quelle” (LXX. Gedicht in „Tumor linguae”) beschreibt Dycki die Absicht eines Besuchs in seiner südpolnischen Heimatregion: „mich zu vergraben in mir in meinen verwandten / die ihre märchen erzählen wer wen erschlug // mit der axt Ukrainer oder Pole wer wen warf / in den brunnen an dem ich jetzt vorbeigehe [...] ich glaube an die familiengeschichte trinke aus ihr / wie aus einer quelle schöpfe aus tiefen ihrer märchen / über biester auf beiden seiten des spiegels und bin / nicht schuldlos seit ich polnisch schreibe gegen wen“.
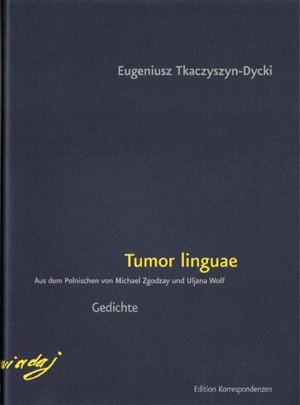 Edition Korrespondenzen Die Gegend, aus der der Dichter stammt, ist die ehemalige Woiwodschaft Przemysl, heute Karpatenvorland. Man kennt sie als Hinterland zu Joseph Roths k.u.k.-Garnisonen am Fuß der Beskiden, in ihr liegen Bloodlands des 20. Jahrhunderts. – Von der Landschaft um „Grodek” hat man eine Vorstellung, seit es ein anderer Dichter, Georg Trakl, vor seiner tödlichen Verzweiflung beschrieb. Tkaczyszyn-Dycki schreibt: „im landkreis przemyskie sind friedhöfe das wichtigste“ (im XIII. Gedicht von „Tumor linguae").
Edition Korrespondenzen Die Gegend, aus der der Dichter stammt, ist die ehemalige Woiwodschaft Przemysl, heute Karpatenvorland. Man kennt sie als Hinterland zu Joseph Roths k.u.k.-Garnisonen am Fuß der Beskiden, in ihr liegen Bloodlands des 20. Jahrhunderts. – Von der Landschaft um „Grodek” hat man eine Vorstellung, seit es ein anderer Dichter, Georg Trakl, vor seiner tödlichen Verzweiflung beschrieb. Tkaczyszyn-Dycki schreibt: „im landkreis przemyskie sind friedhöfe das wichtigste“ (im XIII. Gedicht von „Tumor linguae").
Er mag auch an das Konzentrationslager Bełżec gedacht haben, wo ein halbe Million galizischer Juden ermordet wurde. Im kleinen Wólka Krowicka, wo Tkaczyszyn-Dycki herstammt, jagten einander Ukrainer und Polen, Orthodoxe und Katholiken. Das nächste Städtchen ist Lubaczów , 24km von der Grenze zur Ukraine entfernt. 1947 wurde es im Rahmen der ethnischen Säuberung „Aktion Weichsel“ fast ganz zerstört. Wenn in „Geschichte polnischer Familien" von Polonisierung der Ukrainer und Katholisierung der Unierten die Rede ist, so weil diese Vorfälle in den Familien der Region Gräben und Lücken hinterlassen haben. Etwa reißt im Gedicht „Stempel“ die Mutter die verräterischen ersten Seiten aus Büchern, weil sie verraten, dass sie vertriebenen Familien gehört haben. In anderen Gedichten herrscht Freude, als Bände mit dem Ex-libris der eigenen Familienbliothek in Antiquariaten aufgestöbert werden können. An Tanten und Nachbarinnen, die ausgewandert oder gestorben sind, erinnern leerstehende Räume und Gebäude, manche schicken aus Chicago Pakete, nachdem ihre Gesichter längst vergessen sind.
In der Übersetzung spürt man es nicht, doch Tkaczyszyn-Dyckis Literatursprache Polnisch enthält originelle Einsprengsel und ungewohnte Wendungen aus einem altertümlichen russinischen Dialekt, dem heute vom Aussterben bedrohten Chałackischen. Diese Mischsprache der Grenzregion zur Ukraine verdankt der Dichter seinem Vater, einem polonisierten Ruthenen, und bis zum Schuleintritt hat er sie gesprochen, sollte erst mit 16 ein polnisches Buch lesen. Umso origineller erscheint in polnischen Ohren Tkaczyszyn-Dyckis als Unbedarftheit getarnte Bereicherung der polnischen Literatursprache durch seine randsprachigen Eigenheiten. Er verwendet Wörter und Wendungen im Polnischen – das sich, weil es biegsam und flexibel ist, besonders für Gedichte eignet – anders als üblich; etwa als abfällig begriffene Ausdrücke in ihrer altertümlichen, im Chałackischen noch aufrechten Bedeutung. Das sorgt für Heiterkeit, hinter der freilich hohes Sprachbewusstsein, Sprachkritik, Sprachphilosophie stecken. – Leider erschließt sich diese Dimension nur denen, die das Original verstehen. Auch in seinen journalistischen Beiträgen – „Kresy”, d.h. Grenzregionen, Randgebiete, nennt sich auch die Vierteljahreszeitschrift, für die der Dichter schreibt – beutet Tkaczyszyn-Dycki den Reichtum seines vielfältigen sprachlich-kulturellen Erbes aus und bespricht wegen ihrer Randstämmigkeit in Vergessenheit geratene Regionalautoren des 18./19. Jahrhunderts aus der Familienbliothek seiner ruthenischen Vorfahren. Seine Verdienste für die Bereicherung der Literatur von ihrem fast ausgemerzten Rand her wird heute in Polen gewürdigt.
Tkaczyszyn-Dyckis Hauptthema, die Berührungspunkte zwischen Erotik und Tod, ist zutiefst barock. Wie viele Grenzbewohner trat seine Familie von der griechisch-katholischen (unierten, ukrainischen) zur römisch-katholischen Kirche über. Zu ihr gehören Totentanz und Rosenkranz, aber auch das Schuldgefühl des Jugendlichen für sein homosexuelles Begehren. Nicht anders als der Kärntner Josef Winkler schreibt sich sein polnischer Leidensgenosse die Themen Tod und Homosexualität, erlebt und gelitten in einem schweigsam-glaubensstrengen Dorf, bei obsessiver Sturheit in immer neuen Ansätzen von der Seele.
Der Umzug in die Stadt – zum Literaturstudium nach Lublin – sorgt im Selbstbewusstsein des Dichters als junger Mann für Erleichterung. Die Angst vor Entdeckung weicht in Tkaczyszyn-Dyckis Gedichten dann dem kecken Jargon der Schwulencommunity, um gleich wieder umzuschlagen in Galgenhumor über die prekäre Situation von Randgruppen; neben Homosexuellen Prostituierte, Obdachlose, psychisch Kranke.
Der Mensch, der hier schreibt, ist gläubig, glaubt an – im Schreiben – Erlösung. Manchmal spricht der Dichter sich selbst an, witzigerweise manchmal seine LeserInnen, häufig Gott – unter anderem über Vermittler wie Rainer Maria Rilke, dessen Herbstgedicht „Herr, es ist Zeit” einen ganzen Zyklus von Gedichten zum Thema Unbehaustheit (in dem Band „Tumor linguae”) nach sich zieht. Doch wie Rilke klingen Dyckis Gedichte nicht; sie sind kräftig wie die von François Villon, die Mischung aus Angst und Selbstbewusstsein, abgeklärten Sprüchen und Demut macht sie stark. Im XXX. Gedicht heißt es: „von der Ungewissheit halte mich / fern Herr wenn du kannst und [...] lehre Beruhigung // [...] bewahre mich [...] vor dem Stummen / das wie ein Stachel ist und wächst / sooft ich den Atem ausstoße aus Angst / dass ich nichts ausstoße außer einem Tröpfchen“ .
Das erste Gedicht in „Geschichte polnischer Familien” hat nichts von dem Dycki-typischen „Glanz und Schmutz“. VORWORT manifestiert den Sinn oder die Aufgabe von Tkaczyszyn-Dyckis Schreiben: Ein Schmetterling wiegt sich im Gras und / auf seine Weise beglückt er die bunte Welt / oder beunglückt er sie doch in Anbetracht / der Tatsache dass er von irgendwo herflog // und sich auf einem Kleeblatt niederließ / von Blüte zu Blüte aber vor allem / bleibt er bis heute unenträtselt im / vierblättrigen Klee auch in Anbetracht // dessen dass ausschließlich Tatsachen zählen.
Der Schmetterling ist das Gedicht, das sich in einer Welt, in der Tatsachen zählen, nicht festlegen lässt. Schmetterlinge sind ansehnlich, zerbrechlich, aus einer anderen Sphäre. Die einen genießen ihren Anblick, die anderen beunruhigt es, dass es sie, „von irgendwo her<ge>flogen“ gibt und sie vom Nektarschlürfen existieren. Die Angst der Beunruhigten bedroht das Gedicht.
Fixpoetry 2015
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.







Kommentare
Die Sprache vom Rand her
Kleiner Beitrag am Rande Frau Eisinger: So neu ist Dycki im deutschen Sprachraum gar nicht. Er wurde seit 1998 in mehreren deutsch polnischen Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht.
regards DK
Lieber Herr Krause, das mag
Lieber Herr Krause, das mag schon sein. Für mich war er neu und seit der Buchveröffentlichung ist er hoffentlich in Händen vieler Leser gelandet!
lg
ue
Neuen Kommentar schreiben