MANIFESTE HÄUSLICHKEIT
Adelheid Dahimène (1956-2010)
Seit jeher reden die Dinge
zum Schein für den Nutzen
gibt es den Satzbau die Axt
bildet den Zimmermann aus
im vierten Fall beugt er ein
Brett und bindet und leimt
ohne Ton steht ein Haus hat
Fenster hat Türen schweigt
seine Grammatik verschlüsselt
zum Rauchfang hinaus
Adelheid Dahimène war eine oberösterreichische Autorin, deren Namen man vor allem in Zusammenhang mit Kinderbüchern kennt, für die sie sich die Geschichten ausgedacht hat, in fruchtbaren Zusammenarbeiten mit den Illustratorinnen.
Die mehrfache Preisträgerin war aber auch Dichterin, Veranstalterin, selbstlose Netzwerkerin und Ermunterin zu lohnenswerten, wenngleich wenig profitablen Literaturunterfangen. Im Verlag Klever sind zwei ihrer Bücher erschienen, das letzte bereits nach ihrem Tod.
Adelheid Dahimène ist nur 54 Jahre alt geworden, ein paar Jahre älter als ich jetzt bin. Wie ich hatte sie drei Kinder und wie alle schreibenden Frauen lebte sie den Spagat zwischen Mutter-, Alleinverdienerin- und Dichterin-Sein. Als sie starb, fielen der einzigen Tageszeitung Österreichs, die das Ereignis erwähnte, gerade einmal drei Zeilen Nachruf ein; wenigstens eine Leserbriefstimme entrüstete sich über diese Geringschätzung ihrer Leistung der Leseerziehung und des Durchhaltevermögens für die österreichischen Literatur.
Dahimènes Bücher stehen in jedem Kindergarten, doch ihre „erwachsene Qualität“ ist wenig bekannt.
Vielleicht liegt das darin, dass sie mit Attributen aus dem Inneren ihres Haushalts gearbeitet, vom Küchentisch im Zentrum ihrer Familie aus geschrieben hat; das schreckt Leser ab, die sich für über diesen profanen Dingen stehend halten.
Das hier vorgestellte Gedicht arbeitet weniger mit Alltagsassoziationen als mit solchen aus dem Repertoire des „gelernten“ Literaten – doch ohne den vordringlichen Impetus eines Dichtenden aus den Augen zu lassen: stimmig Teilen.
In der kinderumringten Lebensetappe, als meine Tage sich um Legosteine, Schwimmflügel und Wäschekluppen drehten, habe auch ich versucht, mir von diesen Dingen etwas sagen zu lassen. Und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es vor allem auf den freien Raum ankommt, in dem sich das Hin- und Hinein-Horchen entfalte, bis ein poetischer Gedanke dabei herauskommen kann:
Ute Eisinger
Die Dinge reden ja nicht mit einem.
Vielleicht werfen sie mehr zurück
als den zugeworfenen Blick (Neugier, Freude),
verleihen kurz Hellsicht.Da musst du längst ruhig sein,
gespanntes Segel,
horchend.12. Februar 2004
Aus: AUFNAHMEZUSTAND
Dahimène geht offenbar derselben Frage nach – und ist zu einer anderen Lösung gekommen.
Das in gleichlangen Zeilen grafisch nahezu konkrete Gebilde ihres Gedichts „Seit jeher reden die Dinge“ entwischt, sobald man ihm auf die Schliche kommen möchte. Nicht einmal die Enjambements erweisen sich als berechenbare Entgleisungen aus Satz- und Versbau. Auch die (möglichen) Versatzstücke aus geläufigen Zitaten schimmern nur zu einem gewissen Grad aus dem Silbenstrickwerk heraus; festhalten, bestimmen, lassen sie sich nicht.
„Seit jeher“ setzt Dahimène an; ist doch ihr Thema kein geringeres als die Bestimmung des Gedichts in Relation zu seinem Gegenstand – in nicht weniger als gleich der ganzen Geschichte der Poetik.
Doch der Behauptung folgt ihre Zerstreuung auf den Fuß: Das „Reden <der> Dinge“ hat nur „zum Schein“ einen Nutzen. Vielleicht muss es diesen Eindruck bei denen erwecken, die immer nur Nützliches sehen müssen, Rentabilität; Die können Gedichte, steht widerständig zwischen den Zeilen, freilich nicht bieten. Als Sprachgebilde verfügen sie allerdings über Grammatik, ein geregeltes System zur Hervorbringung von Gedachtem. Doch schon macht Dahimène auch dieser Verständnishilfe den Garaus und erinnert an die Axt, d.h. die Axt, die laut Franz Kafka ein Buch sein muss, damit es „beißt und sticht“ und das „gefrorene Meer in uns“ aufbricht.
Eine solche Waffe kann gefährlich werden! Sie bedroht Denkfaulheit, Dummheit und Gemeinheit. So verstehen es jedenfalls Leute, die Kafkas Diktum kennen. Die anderen nehmen nur die andere Lesart, hier hinein gesteckte Bedeutung des Accessoires „Axt“ wahr, das Sprichwort: „Eine Axt im Haus erspart den Zimmermann!“. Es besagt so viel wie: Der geschickte Mensch sei sein eigener Handwerker!
Im Koffersprichwort, d.h. indem beide Sentenzen ineinander gesteckt wurden, ergibt das ein Drittes: „die Axt / bildet den Zimmermann aus“. Man könnte das Ergebnis als eine Philosophie lesen, die besagt: Schreibleidenschaft („Axt“) macht den Schreibenden.
Ich kenne nur wenig von Dahimène. Es heißt, der Sprache aufs Maul zu schauen sei eine ihrer Lieblingsstrategien und sie hätte sich stets gegen eine Unterscheidung in Kinder-, Jugend- und Erwachsenenliteratur gewehrt. In der Tat ermuntern ihre Zeilen dazu, unbefangen und jeweiligen Alters ungeachtet Sprache beim Wort zu nehmen und sich selbst zu bilden, ja zum Dichter auszubilden.Hier weht der Geist des "Sprachbastelbuchs", eines der besten österreichischen Kinderbücher: 1975 im fortschrittlichen "Jugend und Volk"-Verlag erschienen und jüngst wieder aufgelegt, regen darin österreichische Dichtende die aufmüpfige Fantasie der Kinder durch Sprachlust an. Die heimische Tendenz zum neobarocken Sprachspiel ist mit diesem Buch für Generationen wachgehalten worden.
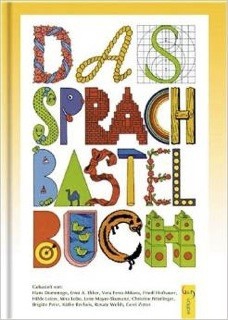 Sprachbastelbuch, Jugend und Volk Verlag
Sprachbastelbuch, Jugend und Volk Verlag
Auch in Zeile 5 wird weiter am Bedeutungsfeld des Heimwerkers festgehalten, „der Zimmermann“ bleibt im Pronomen Subjekt. Nebenbei bemerkt ist der Zimmermann, im Unterschied zum Architekten, der, dessen Erfahrung und Geschick wir einen Bau verdanken, eine profundere Version des Dichters: mehr Handwerker als Genie, mehr Josef als Messias.
Doch es geht auch immer noch um die Sprache: Der Zimmermann kann „im vierten Fall <...> beugen“ wie ein Schulkind im Sprachunterricht, doch nicht nur theoretisch, sondern indem er die Sprache konkret, als „ein Brett“ nimmt. Immerhin soll ein Haus draus werden, darum gilt’ s (Verszeilen, ein Buch) zu "binden und leimen" – selbst wenn „ohne Ton“.
Das Produkt hat nun Fenster und Türen, d.h. es kann bewohnt werden und wird dann auch, mit Sinn erfüllt, klingen, etwas von sich geben...
Die Dichterin spricht es nicht aus. Sie überlässt es uns – Klein oder Groß –, über die Möglichkeiten eines Hauses respektive Gedichts – in der arabischen Literatur heißt der Begriff [bait] gleichermaßen „Haus“ und „Vers“, im Italienischen meint „stanza“ sowohl die Strophe als auch das Zimmer – nachzudenken. Doch eines verrät uns Dahimène: seine „Grammatik“ – was es im Innersten zusammenhält, gibt das (Gedicht-)Gebäude nicht preis: „verschlüsselt <…> schweigt es seine Grammatik zum Rauchfang hinaus“. – Die Wendung erinnert an unbeschwertes Zum-Fenster-hinaus-Werfen von Schätzen, ine großzügige und freie Geste, wenngleich nicht unbedingt die wirtschaftliche Art des Haushaltens.
Nun: Selbst wenn sich dem Leser nicht erschließt, mit welchem Zauber hausbackene Worte auf einmal Gedicht geworden sind: das Haus ist beseelt, es lebt; denn sein Rauch signalisiert, dass es sich drinnen jemand behaglich gemacht hat. Also muss, will man das Geheimnis seiner Machart erfahren, ein Gedicht betreten und befragt werden – ganz wie man eine Familie am besten in der Nähe ihres Herds kennenlernt.
Fixpoetry 2014
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.







Neuen Kommentar schreiben