#textediebleibensollten [Klaus Mann]
Erinnerung an ein Antiquariat in Amsterdam vor gut zehn Jahren: Zwischen den alten Bänden eine etwas abgegriffene, ansonsten gut erhaltene Ausgabe von Klaus Manns „Mephisto. Roman einer Karriere“ – eines von knapp über tausend Exemplaren der Erstausgabe, erschienen 1936 im deutschsprachigen Exilverlag Querido und heute eine echte Rarität.
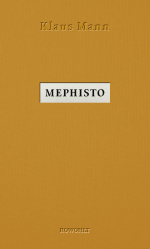 Die Erscheinungsgeschichte des Romans, die weit über 1936 hinausreicht und ein Verfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 1971 beinhaltet, als das Buch letztinstanzlich verboten wurde, sowie schließlich die massenhafte Verbreitung durch den Rowohlt Verlag 1981, die dieses Verbot zunächst ignorierte und dann praktisch aufhob, ist längst Teil der deutschen Literatur- und Rechtsgeschichte. 83 Jahre nach der erstmaligen Veröffentlichung hat der Rowohlt Verlag jetzt eine Neuauflage des „Mephisto“ auf den Markt gebracht, mit einem lesenswerten Nachwort von Michael Töteberg, der der Entstehung und Verbreitung des Buches noch einmal eingehend nachspürt. Es finden sich dort zahlreiche Details, die in der bisherigen Rezeptionsgeschichte nicht ausführlich adressiert wurden. Etwa (1) die Unsicherheit Klaus Manns selbst beim Umgang mit seinem Stoff („Mephisto wird ein kaltes und böses Buch. Vielleicht wird es den harten Glanz des Hasses haben.“); oder (2) die Querelen im Vorfeld der Veröffentlichung, als die Exilzeitung „Pariser Tagblatt“ einen Vorabdruck des „Mephisto“ brachte, mit dem Hinweis, dass es sich dabei um einen „Schlüsselroman“ handle, in dessen Zentrum „die Figur eines Intendanten und braunen Staatsrates [steht], der die Züge Gustav Gründgens’ trägt“ (was bei Querido dazu führte, dass man über einen Abbruch des Vorabdrucks nachdachte); und schließlich (3), dass Gustav Gründgens 1956 höchstselbst den Aufkauf von Exemplaren des Romans veranlasste, die – in einer sozialistisch „gesäuberten“ Version – über den Aufbau-Verlag in der DDR in die Frankfurter Bahnhofsbuchhandlung gelangt waren.
Die Erscheinungsgeschichte des Romans, die weit über 1936 hinausreicht und ein Verfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 1971 beinhaltet, als das Buch letztinstanzlich verboten wurde, sowie schließlich die massenhafte Verbreitung durch den Rowohlt Verlag 1981, die dieses Verbot zunächst ignorierte und dann praktisch aufhob, ist längst Teil der deutschen Literatur- und Rechtsgeschichte. 83 Jahre nach der erstmaligen Veröffentlichung hat der Rowohlt Verlag jetzt eine Neuauflage des „Mephisto“ auf den Markt gebracht, mit einem lesenswerten Nachwort von Michael Töteberg, der der Entstehung und Verbreitung des Buches noch einmal eingehend nachspürt. Es finden sich dort zahlreiche Details, die in der bisherigen Rezeptionsgeschichte nicht ausführlich adressiert wurden. Etwa (1) die Unsicherheit Klaus Manns selbst beim Umgang mit seinem Stoff („Mephisto wird ein kaltes und böses Buch. Vielleicht wird es den harten Glanz des Hasses haben.“); oder (2) die Querelen im Vorfeld der Veröffentlichung, als die Exilzeitung „Pariser Tagblatt“ einen Vorabdruck des „Mephisto“ brachte, mit dem Hinweis, dass es sich dabei um einen „Schlüsselroman“ handle, in dessen Zentrum „die Figur eines Intendanten und braunen Staatsrates [steht], der die Züge Gustav Gründgens’ trägt“ (was bei Querido dazu führte, dass man über einen Abbruch des Vorabdrucks nachdachte); und schließlich (3), dass Gustav Gründgens 1956 höchstselbst den Aufkauf von Exemplaren des Romans veranlasste, die – in einer sozialistisch „gesäuberten“ Version – über den Aufbau-Verlag in der DDR in die Frankfurter Bahnhofsbuchhandlung gelangt waren.
Apropos Gründgens: Wie sich der Schauspieler gegenüber dem Buch positionierte, stand durchaus nicht von Anfang an fest. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass er sich insgeheim durch die ihm literarisch zuteil gewordene Aufmerksamkeit geschmeichelt gefühlt haben dürfte. So berichtete ein langjähriger Mitarbeiter, dass Gründgens den „Mephisto“ fast auswendig gekannt und den Wunsch geäußert habe, den Stoff selbst zu verfilmen. Davon hat er freilich wieder Abstand genommen. Stattdessen drehte er 1941 den Film „Friedemann Bach“ über den Sohn des Komponisten Johann Sebastian Bach, dem es zeitlebens nicht gelungen war, sich aus dem Schatten des übermächtigen Vaters zu befreien. Man durfte das getrost als boshafte Retourkutsche in Richtung von Klaus Mann verstehen. Denn auch das gehört zu den Besonderheiten des „Mephisto“: Mann und Gründgens kannten einander gut. Sie waren in den 1920er Jahren als „Revue zu Vieren“ gemeinsam aufgetreten (zusammen mit Erika Mann und Pamela Wedekind) und nach der Hochzeit Gründgens’ mit Erika vorübergehend sogar verschwägert gewesen. Nicht zuletzt die engen privaten Verflechtungen der Akteure, die sich im Roman kaum kaschiert wiederfinden, machten den „Mephisto“ für die Zeitgenossen zu einer so aufsehenerregenden Lektüre.
Die Handlung des Romans ist hinlänglich bekannt, nicht zuletzt aufgrund der gleichnamigen Oscar-prämierten Verfilmung von István Szábo aus dem Jahr 1981 mit dem grandiosen Klaus Maria Brandauer in der Hauptrolle. Ein junger, hochtalentierter, vor Ehrgeiz brennender Schauspieler schafft den Sprung von der Hamburger Theaterprovinz auf die Berliner Bühne, wo er rasch zum Star im Ensemble des großen Max Reinhardt („Der Professor“) aufsteigt. Selbst der Machtantritt der Nazis vermag die Karriere des alerten Hendrik Höfgen nicht zu bremsen; im Gegenteil, durch die spezielle Förderung des Luftfahrtministers (Göring) wird er zum Intendanten des Berliner Staatstheaters ernannt – und ist dort angekommen, wo es ihn immer hingezogen hat: ganz oben! Ibsen und Sternheim lassen sich jetzt zwar nicht mehr inszenieren, doch Goethe und Shakespeare dürfen nach wie vor auf den Spielplan.
Dass Gründgens unmittelbar nach Ende des Krieges bereits wieder Erfolge feierte, sowohl im Osten als auch Westen des Landes, lag sicherlich an seinen herausragenden schauspielerischen Fähigkeiten; sowie daran, dass er es während der Nazi-Zeit geschickt verstanden hatte, nach innen – wohldosiert, versteht sich – stets eine gewisse Ambivalenz in Raum stehen zu lassen, eine Art Hintertürchen, durch das er letztlich zu entwischen vermochte. Wie sehr Gründgens das Bild, kein Nazi gewesen zu sein, sondern vielmehr im Theater einen – zugegebenermaßen: kleinen – Schutzraum für sich und seine Kollegen geschaffen zu haben, verinnerlicht hatte, zeigte sich in einem Interview, das er kurz vor seinem Tod 1963 Günter Gaus gab und das heute noch auf YouTube verfügbar ist.
Entschieden verneint er darin die Frage, ob ihn beim Blick auf die Zeit 1933 bis 1945 nicht doch eine gewisse „Unsicherheit“ beschleiche. Vielmehr sei unter seiner Führung die Bühne des Staatstheaters der „einzig sichere Faktor“ für die Schauspieler gewesen. Diesen geschützten Ort zu bewahren, sei seine Aufgabe gewesen, wenngleich auch er mehrfach über den Gang ins Exil nachgedacht habe. Letztlich war es die Verantwortung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, so das Gründgens’sche Selbstverständnis, die ihn von diesem Schritt abgehalten hatte. Davon abgesehen sei er zeitlebens ein unpolitischer Mensch gewesen.
Dass der „Mephisto“ bis heute nichts an Aktualität eingebüßt hat, sieht man auch daran, dass Rowohlt das Buch zum 70. Todestag von Klaus Mann im Mai 2019 in einer schönen Leinenausgabe neu aufgelegt hat. Und im Wiener Burgtheater lief in der vergangenen Herbstsaison der Roman in einer Adaption von Bastian Kraft mit Nicholas Ofczarek als Mephisto. Leider tappte die Wiener Inszenierung dabei genau in jene Falle, die die man bei der Neuauflage historischer Schlüsselromane tunlichst vermeiden sollte: Die Begebenheiten der Vergangenheit derart offenkundig auf das Hier und Heute übertragen zu wollen, etwa durch vom Bühnenrand stakkatohaft ins Publikum gebrüllte Erläuterungsmonologe, dass auch der Letzte im Raum die wohlmeinenden Absichten des Regisseurs versteht. Dabei ist das beim „Mephisto“ gar nicht nötig. Wie hatte Klaus Mann es selbst am Ende seines Romans formuliert? „Alle Personen dieses Buches stellen Typen dar, nicht Porträts.“ Und „Typen“ gibt es bekanntlich in jeder Zeit.
 Klaus Mann
Klaus Mann
Mephisto
Roman einer Karriere
416 Seiten
ISBN: 978-3-498-04546-3
Rowohlt Verlag 2019
Fixpoetry 2019
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.







Neuen Kommentar schreiben