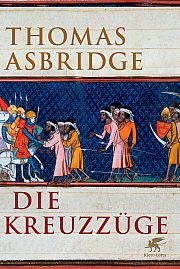|
|
Anzeige Versandkostenfrei bestellen! Versandkostenfrei bestellen!
Die menschliche Komödie als work in progress Ein großformatiger Broschurband in limitierter Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. |
||||
|
Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | |||||
|
Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links |
Angesichts der religiösen Hochstimmung, die Papst Urban II. auf der Synode von Clermont-Ferrand im November 1095 in der lateinischen Christenheit entfacht hatte, schien es auch ohne Belang, dass bisher Pilgern aus dem Westen der Zugang nach Jerusalem – von kurzen Phasen abgesehen – stets offen gestanden hatte. Ob der Papst tatsächlich eine bewaffnete Massenpilgerfahrt auslösen oder nur dem bedrängten byzantinischen Reich eine militärische Atempause verschaffen wollte, wird auch in der voluminösen Monographie des britischen Mediavisten Thomas Asbrigde nicht wirklich geklärt. Ganz auf den Spuren seines renommierten Landsmannes Steven Runciman entwirft der Dozent am Londoner Queen Mary College ein konventionelles Porträt jener dramatischen Epoche des Mittelalters, die sich dem Verständnis einer säkularisierten Nachwelt zunehmend entzieht. Was Urban II. tatsächlich am 27. November 1095 vor einigen hundert Zuhörern vor den Toren der zentralfranzösischen Stadt gesagt hatte, lässt sich heute kaum noch klären, da mehrere Versionen seiner Rede überliefert sind. Asbrigde argumentiert jedoch, dass vor allem eine frühe Form antimoslemischer Gräuelpropaganda im Zentrum seiner Rede gestanden haben muss, da schon sein Vorgänger, Gregor VII, Pläne zu einem Kreuzzug in den Orient geschmiedet hatte, damit aber noch auf wenig Widerhall gestoßen war. Ob die propagandistische Indoktrinierung auch der Auslöser für das spätere Massaker der Kreuzfahrer an den moslemischen und jüdischen Bewohnern Jerusalems gewesen war, ist ungewiss. Ein reiner Religionskrieg waren die Kreuzzüge jedoch nicht, wie Asbrigde betont, da noch viele andere Kalküle sozialer und machtpolitischer Natur mit ihnen verknüpft waren. Der römischen Kirche ging es in ihrem Streit mit dem Kaisertum auch darum, sich als eigenständige Organisation gegen die so genannte weltliche Macht zu etablieren, was auch eine Militarisierung nicht ausschloss. Zugleich vermochte sie den wiederholten Angeboten aus Konstantinopel kaum zu widerstehen, die im Ausgleich gegen militärische Hilfe aus dem Westen eine Restitution der erst vier Dekaden zuvor verloren gegangenen Kircheneinheit in Aussicht stellten. Viele Kreuzfahrer selbst lockte nicht nur die versprochene Vergebung der eigenen Sünden, die ihnen der Papst für ihren militärischen Dienst im Zeichen des Kreuzes in Aussicht gestellt hatte, sondern auch die Möglichkeit einer eigenen Territorialherrschaft im Orient, der aus der Perspektive mittelalterlicher Europäer als sagenhaft reich galt. Der Erfolg des ersten von insgesamt sieben Kreuzzügen hing jedoch nicht vom Glaubenselan und der Kampfkraft der christlichen Streiter ab, die mit ihren begrenzten militärischen Erfahrungen aus den ständigen Kleinkriegen europäischer Feudalherren kaum auf eine Auseinandersetzung mit richtigen Armeen vorbereitet waren. Für ihren überraschenden Erfolg waren, wie Asbrigde hervorhebt, hauptsächlich die Zersplitterung der moslemischen Welt verantwortlich sowie die anfängliche Unfähigkeit der Herrscher des Nahen Ostens, die Lateiner überhaupt als neuartige Bedrohung zu erkennen.
Die Eroberung von
Jerusalem am 15. Juli 1099 war der Abschluss des ersten und militärisch
erfolgreichsten Kreuzzuges, der die Gründung von vier so genannten
Kreuzfahrerstaaten im Nahen Osten zur Folge hatte. Ihr Initiator, Papst Urban
II., war jedoch bereits am 29. Juli 1099 in Rom verstorben, kurz bevor ihn die
Nachricht von dem spektakulären Erfolg der Kreuzfahrer erreichen konnte. Zwei Jahrhunderte lang zogen immer neue Wellen von Kreuzfahrerheeren in den Orient, von denen allerdings nur noch zwei Züge dem so genannten Heiligen Land galten. Schon der vierte Kreuzzug offenbarte das abnehmende Gewicht religiöser Motive, richtete er sich doch gegen das ehedem verbündete Byzanz und führte im Jahre 1204 zur Eroberung von Konstantinopel, dem damals noch unbestrittenen Zentrum der Christenheit. Die drei letzten Kreuzzüge galten dagegen Ägypten oder – wie der letzte Zug – der nordafrikanischen Stadt Tunis. Die islamische Welt benötigte lange, wie Asbrigde betont, um ihr altes religiöses Ideal des Dschihad zu erneuern. Das Erstarken der ägyptischen Mameluken zeigte auch, dass die ursprüngliche Kreuzzugsidee mit ihrer sporadisch entfachten religiösen Euphorie kaum geeignet war, den lateinischen Staaten in der Levante eine solide Machtbasis zu verschaffen. Mit dem Fall der Stadt Akkon, der letzten westlichen Bastion in Palästina, am 28. Mai 1291 fand jedoch die Geschichte der Kreuzzüge noch nicht ihren Abschluss. Herausgelöst aus ihrem Entstehungskontext spielte die Kreuzzugsidee im Westen noch Jahrhunderte lang eine verhängnisvolle Rolle als propagandistischer Code für ideologische Kriege innerhalb des Christentums. Noch Dwight D. Eisenhower sprach in seinen Memoiren von einem Kreuzzug gegen das Dritte Reich. Dagegen begann die islamische Welt erst im 20. Jahrhundert – mit Blick auf die Gründung des Staates Israel und die militärischen Interventionen des Westens – von Kreuzzügen zu sprechen. Als Auftakt zu einem Jahrhunderte langem „Clash of Civilisations“ zwischen dem Westen und dem Orient sieht Asbrigde daher die mittelalterlichen Kreuzzüge nicht. Während der knapp zweihundertjährigen Existenz der Kreuzfahrerstaaten kam es – kaum überraschend – immer wieder zu regen Handelskontakten und sogar zu einem kulturellen Austausch. Hierüber hätte man gern noch mehr gelesen als nur das knappe Kapitel, dass der Verfasser in seine hauptsächlich den Linien der großen Politik folgende Darstellung eingebaut hat.
Auch wenn Asbrigde betont,
eine Geschichte der Kreuzzüge aus der Perspektive der drei betroffenen
mittelalterlichen Kulturkreise geschrieben zu haben, überwiegt doch die
westliche Sicht. Seine Darstellung bleibt letztlich konventionell der
Ereignisgeschichte und ihren Hauptakteuren verpflichtet und bietet gegenüber dem
älteren Werk seines Landsmannes Steven Runciman kaum Neues. |
Thomas Asbrigde |
|||
|
|
|||||