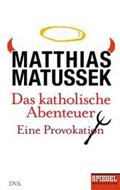|
Bücher & Themen

Bücher-Charts
l
Verlage A-Z
Medien- & Literatur
l
Museen im Internet
Glanz & Elend
empfiehlt:
50 Longseller mit
Qualitätsgarantie
Jazz aus der Tube u.a. Sounds
Bücher, CDs, DVDs & Links
Andere
Seiten
Quality Report
Magazin für
Produktkultur
Elfriede Jelinek
Elfriede Jelinek
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.»

|
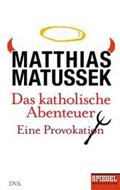 Glaubensbekenntnis Glaubensbekenntnis
»Das katholische Abenteuer« des Matthias Matussek.
Von Gregor Keuschnig
Hans-Georg Gadamers Prämisse für das Gespräch – "Ein Gespräch setzt voraus, dass
der andere Recht haben könnte" – ist für den potentiellen Leser dieses Buches
die Minimalanforderung. Ansonsten sollte man lieber verzichten und seine
Vorurteile im Garten der Akklamation pflegen (etwas, was nicht nur für dieses
Buch gilt).
Dabei gibt es sofort Grund zur Kritik. Der eigentlich schöne Buchtitel "Das
katholisches Abenteuer" wird durch die flapsig-überflüssige Unterzeile "Eine
Provokation" sofort wieder nivelliert (das hätte sich vielleicht dem Leser noch
selber erschlossen). Und der hehre Anspruch, hier erzähle jemand von seinem
katholischen Glauben in den Zeiten des forsch-plappernden Atheismus wird durch
das blöde Cover mit Hörnchen, Dreizack und Heiligenschein konterkariert.
Marketing ist wohl alles und Matthias Matussek muss unbedingt als
Feuilleton-Krawallbär verkauft werden - drunter geht's nicht.
Schade, denn da hat jemand durchaus etwas zu sagen. In den besten Augenblicken
berührt das Bild des gläubigen Katholiken Matussek in der zynischen
Spaßgesellschaft mit ihrer anödende[n] Dauerironie sogar. Wenn er von dem
Moment Verwandlung im Gottesdienst erzählt (er ist natürlich Mystiker). Und wenn
er die Gemeinde und die Verbundenheit mit ihr wenigstens für einen kurzen Moment
zu spüren beginnt. Oder das "Vater Unser"-Gebet Wort für Wort liest und seine
Ergriffenheit bemerkbar ist (freilich wäre es bei dieser Gelegenheit interessant
gewesen,
welchen Wandlungen die Worte in den letzten Jahrzehnten unterworfen waren und
warum). Matussek versteht es ernsthaft und dabei ohne
paternalistischen Unterton über die Sünde zu referieren. Tatsächlich poltert
hier kein Mode-Katholik, der dem Atheismus-Mainstream aus purer
Konfrontationslust entgegenpöbelt. Da ist jemand im Katholizismus verwurzelt und
vermag dies durchaus zu belegen (sogar für seine Marxismus-Zeit). Und als Sohn
eines CDU-Manns im roten Ruhrgebiet ist Matussek geradezu prädestiniert für
Diaspora-Situationen. Daher mag er
"Don Camillo" so und schlüpft sogar einmal in dessen
Rolle.
Verteidigung für den "Kulturspeicher"
Insofern erwartet den Leser eine emphatische Verteidigungsschrift. Der
Katholizismus ist längst im Verteidigungsmodus, was einem durch Matusseks
furiose Plädoyers für den Fels Kirche in der Brandung des Beliebigkeitsmeers
deutlich vorgeführt wird. Matussek hat keine Probleme damit, den Zölibat zu
verteidigen, ist gegen Frauen im Priesteramt und erkennt, dass eine
demokratische Struktur in der Kirche nicht zweckmäßig ist. Tatsächlich gibt es
Untersuchungen, die zeigen, dass religiöse Gemeinschaften mit strengen Regeln
auf Dauer denen mit eher liberalen Geboten überlegen sind.
Sind doch auch die Protestanten seit Jahren mit schwindenden Mitgliederzahlen
konfrontiert – und die machen doch all das, was die Kritiker fordern. Dabei
sind, so Matussek, die meisten Debattenbeiträge zum Thema katholische Kirche
eine geradezu beleidigende Unterforderung der Intelligenz. Ähnlich äußert er
sich auch für die lauwarmen Frömmigkeitsreden à la "Wort zum Sonntag".
Matussek hat Recht, wenn er sagt, dass 180-Grad-Wendungen nur um dem Zeitgeist
und den publizistischen Gegenpäpsten (Küng, Geißler) zu genügen, billiger
Populismus wäre. Und sozialpolitisch stünden Katholiken eh schon weit links. Wie
heuchlerisch doch Medien (und bestimmte Institutionen) seien, die Papst und
Kirche vor allem bei diesen Themen immer als ethische Referenz herbeizitieren,
während ihnen ansonsten zumeist jegliche moralische Reputation abgesprochen
wird.
Matussek verfechtet sogar eine teilweise Zurücknahme der Beschlüsse des Zweiten
Vatikanischen Konzils, deren Folgen (unter anderem eine Entmystifizierung) er
wortgewaltig geißelt. Er plädiert für eine Hinwendung zu einer neuen
Ernsthaftigkeit - zur Not auf Kosten eines weiteren Mitgliederschwunds. Und
übernimmt damit den Duktus des 2000 verstorbenen Erzbischofs Johannes Dyba: Zur
Not gehe es eben wieder in die Katakomben. 'Weniger ist mehr' - kommt einem da
in den Sinn. Die Frage bleibt jedoch unbeantwortet, ob damit nicht auch die
gesellschaftliche Legitimation schwinden würde.
Die katholische Kirche, dieser 2000 Jahre alte Kulturspeicher solle sich,
so Matussek, nicht zu Gunsten kurzfristigen Beifalls einer irreversiblen
Geschichtslosigkeit hingeben. Anpassung an den Zeitgeist gäbe es schon genug.
Hier macht er naturgemäß den weichgespülten Protestantismus aus, der trotz jener
Maßnahmen, die man von der katholischen Kirche fordere ebenfalls längst in eine
Sinnkrise getaumelt sei. Warum soll ein geschiedener protestantischer Priester
eine bessere Eheberatung geben können als sein zölibatär lebendes Pendant, fragt
er neckisch. Schließlich gibt es auch keinen Verein, der, nur um neue Mitglieder
zu gewinnen, seine Prinzipien einfach verwässert.
Die Welt des Gläubigen ist eine andere als die des Ungläubigen
Matussek erklärt wortgewaltig, warum Wulff irrt, wenn er sagt, der Islam gehöre
zu Deutschland. Er verwirft die lutherische Schreckenstheologie, preist
den naiven Kinderglaube als ein Reservoir, so groß wie ein
unterirdischer See und berichtet über das Mysterium des Weihrauchschwenkens.
Er wettert gegen Wellness-Religiosität und Betriebsnudeln der
katholischen Kirche. Er moniert, es werde zuviel über den Glauben
gesprochen, statt aus dem Glauben. Der Katholik Matussek bekennt durchaus seine
Zweifel an der Auferstehungsgeschichte (schließlich ist der Zweifel das Salz des
Katholizismus), verfasst ein flammendes Plädoyer für die Wahrheit, ist
angewidert von der Spießigkeit einer Habsuchtsgesellschaft und vertritt
die Position des
erkenntnistheoretischen Pluralismus (er nennt es nur
anders). Er zollt dem Atheisten Camus seinen großen Respekt und findet ein
Böll-Zitat, welches den Katholizismus ehrt. Er erkennt degoutante
Plünderungen der katholischen Ikonografie und erklärt, warum er den Film
"Das Leben des Brian" gut finden kann. Er spricht mit Rüdiger Safranski und
besucht Michael Krüger. Er erzählt über Engel und poltert gegen hirnlose
Wohlstandsatheisten wie Christopher Hitchens. Er sympathisiert mit der
anonymen Ohrenbeichte, die eine Psychoanalyse durchaus ersetzen könne. Und er
fragt sich, warum alle Welt Angst vor einer Koranverbrennung hat und niemand
eine Bibelverbrennung auch nur mit einer Zeile meldet.
Natürlich ist - um Wittgenstein zu variieren - die Welt des Gläubigen eine
andere als die des Ungläubigen. Und so verteidigt er seine Kirche auch, wenn es
um die fürchterlichen Missbrauchsverbrechen geht (die er auch Verbrechen nennt).
Sein Kronzeuge ist der Kriminologe Christian Pfeiffer, der in einem Artikel in
der
Süddeutschen Zeitung im März 2010 von einer Täterquote durch katholische
Geistliche von 0,1% sprach. Auch wenn solche Zahlen
mit Vorsicht zu genießen sind, ist es ein Faktum, dass die
meisten Verbrechen innerhalb der Familie stattfinden.
Worin nun die Attraktivität besteht, kirchliche (und besonders katholische)
Würdenträger in den Medien überproportional als Täter herauszustellen – hierzu
hätte ich gerne eine These gelesen.
Matusseks trotzige Apologie der Entscheidungsreligion Katholizismus hat
seinen Charme. Man liest dieses Pathos als Erholung zum dauerironischen
Journalistenkritizismus zunächst ganz gerne. Mit der Zeit entdeckt man
allerdings Redundanzen. Schließlich kommt man zum Kapitel mit Reportagen aus dem
Ausland - "Gott und die Welt". Hier wird die Lektüre manchmal ermüdend; die
Texte wirken leicht verstaubt. Liegt es daran, dass dem Polemiker das Futter
fehlt? Man beginnt zu recherchieren - und siehe da: Matussek hat diese
Reportagen aus "Spiegel" bzw. "Spiegel Reporter" übernommen. Dabei wurden
Formulierungen, die eine zeitliche Einordnung der Texte ermöglichen könnten,
zumeist entfernt oder bearbeitet. Einen Hinweis auf das Entstehungsdatum der
Reportagen gibt es allerdings auch nicht. Warum eigentlich nicht?
Viele Reportagen haben mit dem Katholizismus wenig bis nichts mehr zu tun, etwa
wenn er von den Evangelikalen in den USA schreibt und die sozialen und
politischen Gefahren ausmalt. Das tat Matussek schon 1994 - mit der Reportage,
die im Buch unter
"Glauben und Sternenbanner" abgedruckt ist. Das
Portrait über Al Sharpton ist auch von 1994. Noch
älter (von 1992) ist
die Reportage über Calvin Butts (aus "42, ein
federnder junger Intellektueller mit scharfem Verstand" wurde 2011 ein
Intellektueller mit scharfem Verstand. Alles gut und schön. Aber wenn man
schon diese Clinton-Zeit wiederaufleben lässt, hätte man zwangsläufig die noch
aggressivere Evangelikaliserung unter Bush thematisieren müssen. Das unterbleibt
jedoch - vermutlich, weil Matussek damals nicht mehr "Spiegel"-Korrespondent in
den USA war.
Vieles wiedererkannt
Die Gespräche mit dem brasilianischen Autor João Ubaldo Ribeiro und dem
Pianisten Joãs Carlos Martins sind von 2003. Die
Lubawitscher in Brooklyn besuchte er 1992 (ein dürrer
Satz erklärt am Ende, dass der "neue Messias" 1994 verstarb) und über
den indigenen Katholizismus Boliviens schrieb er 2001.
Fast schüchtern kommentierte
Alexander Wallasch in der Rezension in der Süddeutschen Zeitung,
dass man meine, "vieles wiederzuerkennen aus seiner jahrzehntelangen
journalistischen Arbeit". Wenigstens ihm schwant da was.
Einmal fündig geworden, entdeckt man auch viele andere Texte, die Matussek für
dieses Buch bearbeitet bzw. aneinandergefügt hat. Klar, der "Spiegel" hat
ein Kapitel vorabgedruckt. Aber auch
der schöne Text über die sieben Todsünden, das
Wahrheitsplädoyer, das
Gespräch mit Martin Walser, die Reportage über
"Geld und Glaube" (Merkels Rede zur Wirtschaftskrise
war damals "ganz schmal und unwichtig"; 2011 steht dann eher klein und
unwichtig; das nennt man dann wohl Lektorat), Matusseks
Auseinandersetzung über Thomas Steinfeld und Patrick Bahners über die
Islamkritik in Deutschland, die beiden
Verteidigungstexte zum Zölibat (Januar
2011 und
Februar 2011) und die
emphatisch-klugen Bemerkungen zu Benedikts Jesus-Buch
finden sich mit Leichtigkeit im Netz. Das heute noch brisante und
hochinteressante Portrait über den Fuldaer Erzbischof Johannes Dyba (hierzu gibt
es eine kleine Einleitung) und die Reportage über die Abtreibungsbefürworter
sind von 1999. Aber hätte man nicht 2011 noch einmal nach Fulda fahren können?
So bedient sich Matussek bei Matussek - der Verlag verkauft es als "neues Buch",
was es für vielleicht 50% der Texte auch sein mag (sagt ein
Nicht-Spiegel-Leser).
Leider geht Matussek zu selten in die Tiefe. So hätte man gerne gewusst, wie man
einerseits das theologische Jesus-Bild Benedikts derart loben kann, während man
andererseits – vollkommen zu Recht - vom
Pasolini-Film über das Matthäus-Evangelium von 1964
der einen
sozialrevolutionären Jesus zeigt [Teil 1
hier], schwärmen kann. Und obwohl Matussek manchmal
nonchalant bis hin zur Oberflächlichkeit die Vorbehalte gegen die Institution
Kirche abbürstet - manchmal bekommt man dann doch eine Ahnung, was mit dem
"Abenteuer" gemeint sein könnte. Auch wenn man glaubt (sic!), damit nichts mehr
zu tun haben. Gregor Keuschnig
|
Matthias Matussek
Das katholische Abenteuer
Eine Provokation. Ein SPIEGEL-Buch
DVA
Gebundenes Buch mit Schutzumschlag
368 Seiten, mit Abbildungen
ISBN: 978-3-421-04514-0
€ 19,99 [D] | € 20,60 [A]
Leseprobe
|
 Versandkostenfrei bestellen!
Versandkostenfrei bestellen!