|
Glanz@Elend |
Gesellschaftspolitik |
|
|
|
Preisrätsel Verlage A-Z Medien & Literatur Museen & Kunst Mediadaten Impressum |
|||
|
Ressorts |
|||
|
|
Da sind die ersten 70 Seiten. Jammerorgien über die Freiheitsmüdigkeit der säkular[n] Moderne, wider den paternalistischen Staat und der Neigung seiner Bürger, die ein krudes Verständnis vom globalisierten Markt an den Tag legen, sich gegen die Freiheit zu entscheiden, um stattdessen rundum versorgt zu werden. Da wird der Staat zum Gott-Ersatz gemacht und der Markt, dieser Hort der Freiheit, der autoritäre Systeme à la longue destabilisiert, verschmäht. Das Hohelied auf den Staat resultiert aus dem bürgerlichen Selbsthaß (unter anderem in der Frankfurter Schule verbalisiert), einem Erbe des Faschismus, Nationalsozialismus und Kommunismus, jener säkularen Religionen, die das Erbe der Aufklärung und vor allem der Romantik pervertiert haben. Mit dem Ende des real existierenden Sozialismus der alten DDR ist auch, so Ackermann, das alte BRD-Modell des rheinischen Kapitalismus … untergegangen. An dessen Stelle tritt jetzt der globalisierte Markt und der Wettbewerb, jenes Entdeckungsverfahren und Entmachtungsinstrument. Jeder ist darin seines Glückes Schmied und nur der die Bürger infantilisierende Staat, diese säkulare Umma, stellt sich mit neuen Schikanen der Freiheit der Marktteilnehmer entgegen. Die fortschreitende Gesetzes- und Regulierungswut in bestimmten politischen Feldern nutzt Ackermann, um mit dem Bade sämtliche Kinder gleich mit auszuschütten. Rauchverbot, Alkoholfreie Zonen, Ampelregelung auf Lebensmittelverpackungen – alles nur Gängelungen. Das Schlimme dabei: Der Bürger begibt sich auch gerne in diese Abhängigkeit und Bevormundung vom Staat. Und der Staat macht das, um die Bürger, die oft nur ein krudes Verständnis vom globalisierten Markt haben, damit zu kontrollieren. Man könnte diese Diagnose von Ulrike Ackermann für eine mittelmässige Satire halten, aber die Dame meint es Ernst. Die Feinde der Freiheit sieht sie allerdings nicht nur im Staat, sondern auch in den kollektivistischen Tendenzen der Religionen und da vor allem im weltweiten Vormarsch des Islam. Der Kampf der Kulturen ist für Ackermann in Form einer schleichenden Scharia in unseren Städten angekommen, wo gewaltaffin[e] Muslime die freiheitliche Gesellschaft abschaffen wollen. Statt sich dem mutig entgegenzustellen, verharren wir in Appeasement und betreiben sehenden Auges eine Verharmlosung des Islam. Eine multikulturelle Attitüde führt in falsch verstandener Toleranz zu einer Verherrlichung des Fremden. Selbst unsere Rechtssprechung ist davon angeblich nicht mehr frei. Hier wird das allseits beliebte Beispiel der Frankfurter Richterin herangezogen. Zwar wird es mindestens verzerrend dargestellt (es wird suggeriert, als sei es ein Urteil der Richterin ergangen, aus dem eine Billigung eines "Züchtigungsrechts" abzuleiten wäre), aber mit solchen Details hält sich die Autorin nicht auf. In den nächsten rund 80 Seiten entwickelt Ackermann nun eine Geschichte der Freiheit. Getreu dem Motto von Benjamin Constant, dass die individuelle Freiheit… nie der politischen Freiheit geopfert werden darf, untersucht sie nun in einem Parforceritt die westliche Geistesgeschichte der letzten zweitausend Jahre. Das es dabei zu Verkürzungen und Vereinfachungen kommen muss, ist klar. Aber leider zeigt sich Ackermann in wichtigen Punkten der Angelegenheit nicht gewachsen. So parliert sie dann irgendwann von der Penetranz der aufklärerischen Vernünftelei und zeigt dabei, dass sie den Kantschen Vernunftbegriff und dessen unterschiedlichen Ebenen nicht nur nicht verstanden hat, sondern Vernunft, ein Anfängerfehler, gelegentlich mit Verstand verwechselt. In ihrer Vergötterung der Romantik als eine Art Wiege des Individualismus verschweigt sie bis auf einen halben Nebensatz die Interdependenzen zwischen Romantik und Nationalismus, was nicht schlimm wäre, aber eben nur eine Seite der Medaille der Romantik ist. Ziemlich stark reduktionistisch auch ihre Deutungen zur Dichotomie Vernunft gegen Psychoanalyse. Der Tenor ihrer Ausführungen: Trotz enormer historischer Rückschritte (insbesondere im 20. Jahrhundert durch diverse Heilsideologien, die allesamt im Unheil endeten) gelangte 1989/90 im Zusammenbruch des Kommunismus, die Freiheit zur neuen, wirkungsmächtigen Kraft. Nach insgesamt nun 149 Seiten erhofft man sich in den letzten beiden Kapiteln eine gewisse Ausschmückung der Thesen zum "Eros der Freiheit". Aber mehr als den negativen Freiheitsbegriff (Freiheit ist in erster Linie … Freiheit von Zwang), einen zweiseitigen Abriss über Eros, den griechischen Gott der Liebe, seine Verwandtschaft und Verortung in der griechischen Mythologie nebst anschliessender Zusammenfassung der vulgärhistorischen Thesen des Buches, die plötzlich für kurze Zeit Guido Knopp als Cicero oder Thukydides der zeitgenössischen Geschichtsschreibung erscheinen lassen, hat Ulrike Ackermann nichts zu bieten. Zwar beklagt sie, dass Liberalismus nur als Wirtschaftsliberalismus wahrgenommen wird, aber sie unternimmt rein gar nichts, den Liberalismus zu verbreitern. Und dass die Hybris, einen neuen Menschen und eine neue Gesellschaft zu planen im 20. Jahrhundert zu einem Rückfall in die Barbarei führte, ist unbestreitbar, aber warum sie hierin das Echo der Wissenschafts- und Technikgläubigkeit der Aufklärung erblickt, wo sie selber die politische Freiheit … auf zunehmendem Reichtum, Wohlstand und dem technologisch-wirtschaftlichen Wachstum verortet, bleibt ein unauflöslicher Widerspruch. Ackermann erkennt immerhin, dass die negative Freiheit … die anhaltende Sehnsucht des Einzelnen nach Sinn, Erhabenheit, nach gemeinschaftlicher Wärme und Geborgenheit nicht oder nur sehr schwer befriedigen kann, aber mehr als eine verschwurbelte Ideologie des Individualismus vermag sie nicht anzubieten. Die von ihr verfochtene Trennung der Sphären von Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, Recht, Religion und Privatheit, stark an Friedrich von Hayek angelehnt, suggeriert, dass ein Gemeinwesen in unterschiedliche Parallelwelten aufgespalten werden kann, die nun autark nebeneinander bestehen und wirken können. Dieses Konzept auf die heutigen globalisierten Strukturen weiter zu entwickeln (wie man es von einem Buch mit diesem emphatischen Titel erwarten dürfte) und dabei dann auch gleich über eine zweifellos erforderliche Neudefinition von Demokratie nachzudenken unterbleibt (was gerade in Bezug auf Hayeks Thesen schade ist). Somit ist dieses Buch belanglos, ja läppisch. Es will für die Freiheit begeistern, stranguliert den Leser aber mit hölzerner Behauptungsrhetorik, die den Markt als neuen Fetisch feiert. Dass er aber bei aller Notwendigkeit aus Prinzip eine wilde, unbezähmbare Bestie ist, ein Ort des (Sozial-)Darwinismus und damit am Ende das Gegenteil eines freiheitlichen Konzepts eines Gemeinwesens darstellt, kann oder will die Autorin, die sich am Ende artig bei Wolfgang Gerhardt und Dietmar Doering von der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung für die finanzielle Unterstützung bedankt, nicht einmal thematisieren. Sie ergeht sich in plüschigen Wohlfühlsätzchen, die sie aus Zitaten herausdestilliert, ohne sich um die Entsorgung der Nebensätze eben dieser Zitate zu kümmern. Von der Freiheit des Andersdenkenden bzw. Andersglaubenden will sie nichts mehr wissen, wenn sie ihren missionarischen Universalismus zum Apriori erhebt. Ihre teilweise ins paranoide gehende Islamophobie erinnert stark an Henryk M. Broder, den sie zwar im Buch nicht zitiert, aber in ihrer "Auswahlbibliographie" erwähnt.
Wer ein intelligentes,
manchmal aufregendes, stellenweise erregendes, zuweilen hanebüchendes, aber nie
triviales Buch über eine konservativ-liberale Neudefinition von Freiheit lesen
will, sollte Udo Di Fabios "Die Kultur der Freiheit" heranziehen. Man kann sich
dann den Schmarren von Ulrike Ackermann getrost schenken. Gregor Keuschnig
|
Ulrike Ackermann |
|
|
Glanz@Elend
|
|||

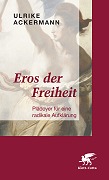 Mogelpackung
Mogelpackung