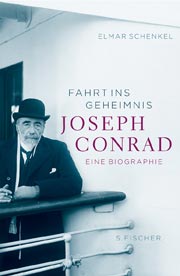|
Glanz@Elend |
Biographien & Belletristik |
|
|
|
Preisrätsel Verlage A-Z Medien & Literatur Museen & Kunst Mediadaten Impressum |
|||
|
|
Fahrtenbücher
eines Kapitäns
zur See und zur Seele Es könnten vier Aspekte seines Lebens und seines Werks sein, die zur Konjunktur der Conrad-Biographik beitragen: Sein familiärer Hintergrund als Kind polnischer Freiheitskämpfer, dessen Eltern an den Folgen der russischen Verbannung früh starben. Sein Leben als Seeman, der ab dem 16.Lebensjahr seine Bildung nicht auf (Hoch-)Schulbänken erwarb, sondern sich vom Schiffsjungen zum Kapitän hocharbeitete und in den Weiten des Kolonialimperiums der Handelsmarine diente. Zudem vielleicht seine Freundschaften mit Autoren wie André Gide, Henry James, Ford Maddox Ford und John Galsworthy. Wobei besonders die zu Galsworthy noch zu Seemannszeiten geschlossen wurde und lebenslänglich eine enge Bindung blieb. Vor allem aber dürften die Charaktere seiner literarischen Protagonisten und das moralisch-metaphysische Universum seiner Erzählungen das Interesse am Menschen hinter den Texten befeuert haben: Einsame Männer, meist an abgeschnittenen Orten (insbesondere auf Schiffen), müssen sich elementaren Herausforderungen physischer und moralischer Art stellen.
Daß Conrads Leben und
Texte im Zeichen der kulturellen Konflikte und Vermischungen des
kolonialistischen Zeitalters stehen, hat das Interesse an diesem Autor im
Zuge der postkolonialistischen Wende der Kulturwissenschaften nochmals
verstärkt. Wurde Joseph Conrad von modernistischen Autoren wie André Gide,
Thomas Mann, Borges und Philip Roth wegen seiner raffinierten literarischen
Erzähltechniken bewundert, so steht er nun im Zentrum des Interesses (etwa
Edward Saids) als der Autor hochgradig ambivalenter Darstellungen der
kolonialen Gewalt. Zum 150 Geburtstag Conrads am 3.12.2007 erschienen nun zwei ganz gegensätzlich konzipierte neue Biographien. Jedes literarische Portrait und jede Biographie komponiert eine Lebensgeschichte mittels zweier komplementärer rhetorischer Mittel. Ergänzend zum Modus der (potentiell unendlichen) Aufzählung einzelner Ereignisse in Leben oder auch Werk der Persönlichkeit arbeitet die Biographik notwendig auch mit Mitteln der Verdichtung, der metaphorischen oder metonymischen Kondensierung, durch die das Wesen der Person fixiert werden soll. Während die Enumeration der täglichen oder monatlichen Beschäftigungen und Begebenheiten eines Lebens einer filmischen Ablauflogik des ‚und dann und dann und dann’ gehorcht, ähnelt die (immer gewagte und potentiell gewaltsam essenzialisierende) verdichtende Wesensschau eher der Schnappschuß-Logik eine photographischen Portraits, in dem die unendliche Bewegtheit der Lebensvollzüge still gestellt wird.
Der Leipziger
Anglistik Professor Elmar Schenkel, der auch schon als Romancier in
Erscheinung getreten ist, wagt mit seiner stärker essayistischen, durchaus
a-chronologisch nach Themenkreisen gegliederten Biographie einiges mehr. Und
er gewinnt. Durch die kluge Auswahl seiner als Sonden in Leben und Werk
fungierenden Stichworte bietet Schenkel das prägnantere Bild des Autors und
offeriert zudem (bei etwa einem Drittel weniger an Umfang) erhellende
Analysen zu einigen Werken Conrads und zu deren Wirkungsgeschichte in Polen,
Frankreich und Deutschland. Beide Conrad-Biographen stehen, wie sie in ihren
Vorworten und in ihren nützlichen Auswahlbiographien freimütig einräumen,
als Forscher der ‚vierten Generation’ (so Stapes treffliche Formulierung)
auf den Schultern von Riesen: insbesondere von Zdislaw Najder, der die
polnischen Familienhintergründe erforschte und von Norman Sherry, der
Conrads östliche und westliche Reisewege aufarbeitete. John Stape hat durch
seine Entdeckung einiger entfernter Verwandter Conrads oder seines Umfelds
und durch die Aufarbeitung der erst seit den 1980er Jahren komplett
zugängliche Korrespondenz wohl noch ein paar kleine neue Faktenbrösel
eruiert. Obwohl sich Conrad dezidiert als englischer Autor betrachtete – die englische Staatsbürgerschaft erlangte er schon 1886 – und leicht allergisch auf die Vereinahmungsversuche seiner seit etwa 1910 international prominenten Person durch polnische Nationalisten reagierte, ist seine Herkunft als Sohn polnischer Edelleute prägend gewesen. Conrads Vater, Apollo Korzeniowski, war Schriftsteller, Übersetzer von Shakespeare und Hugo; und er war ein politischer Aktivist. Als polnischer Nationalist wurde er nach achtmonatiger Haft von den russischen Machthabern samt Frau und Sohn erst nach Perm im Ural verbannt, dann ins nur etwas mildere Wologda, 500km östlich von Moskau. Conrads Mutter starb früh in der Verbannung, der Vater an deren Folgen. Mit 11 war Conrad Vollwaise, betreut wurde er nun von einem hilfreichen Bruder seiner Mutter. Mit 16 reist der junge Korzeniowski mit dem Zug nach Marseille und wird Seeman. Er fährt als Matrose mehrfach in die Karibik und entdeckt sich und das wilde Leben der Hafenstädte bei Aufenthalten in Marseille. Zeitlebens wird er eine große Affinität zu Frankreich fühlen, dessen Sprache er schon lange vor der englischen beherrschte. Nach einigen Fahrten auf französischen Schiffen wechselt Conrad wegen Schwierigkeiten mit seinem Aufenthaltsstatus als Pole zur englischen Handelsmarine. Er beginnt während der Liegezeiten in diversen Häfen, gewissermaßen heimlich, mit seinem ersten Roman‚ Almayers Wahn’.
Conrad wechselt seinen
Beruf vom Seeman zum Dichter, (ohne daß er dabei einem bewußten Plan gefolgt
sein mag) genau in dem historischen Moment, als die Schifffahrtsbranche
wegen der Motorisierung zunehmend rationalisiert wird, was die Jobsuche
schwieriger macht – während der Buch- und Zeitschriftenmarkt aufgrund immer
breiterer, neuer Leserschichten expandiert. Nach der Hochzeit mit Jessie
George, einer aus einfachen Verhältnissen stammenden Angestellten in einer
Schreibmaschinenfirma, reisen die beiden für 6 Monate in die Bretagne.
Während der Flitterwochen und zugleich als sidekick während der
Schreibhemmungen an seinem Romanprojekt ‚Die Rettung’, das ihn von 1899 bis
1919 immer wieder beschäftigen und quälen wird, schreibt der nun zum
Berufschriftsteller gewordene Ex-Kapitän die Kurzgeschichte ‚Die Idioten’.
Es ist dies, wie Stape formuliert, „die Tragödie eine Frau, die von ihrem
brutalen Ehemann zum Sex – und zur Geburt einer Horde geistig behinderter
Kinder – gezwungen wird. Ihr einziger Ausweg aus dieser Hölle besteht darin,
ihn zu erstechen und sich dann selbst zu töten. Der vermutlich düstersten
Geschichte, die jemand während der Flitterwochen geschrieben hat, wurde
prophezeit, sie werde ‚allen künftigen psychoanalytischen Interpreten
Conrads großen Spaß bereiten’.“ Um 1920 war der Autor zu einer strahlenden öffentlichen Figur geworden. Doch hinderten ihn seine hohen Einnahmen nicht, durch noch höhere Ausgaben für die Familie und das üppige Personal (von Köchen, Gärtner, Privatlehrer und Chauffeur) auf seinem teuer gemieteten Haus ‚Oswalds’, immer wieder in Finanzschwierigkeiten zu geraten, aus denen ihm Freunde oder sein Agent Pinker heraushalfen. Angetragene Ehrendoktorwürden und Leseeinladungen erreichten ihn nun in hoher Zahl. Freilich lehnte er diese meist ab, nicht zuletzt wegen einer für diesen Sprachmeister erstaunlichen Unsicherheit im gesprochenen Englisch, das zeitlebens mit starkem Akzent behaftet blieb. Auch als Autofahrer war der Exkapitän Conrad, der stets ohne Straßenkarte reiste und selbstverständlich in seemännischer Terminologie von den Orientierungsnöten zu Lande sprach, nach Aussage seines später im Automobilhandel tätigen Sohnes, eher minder begabt. Der leidenschaftliche Automobilist liebte hohe Geschwindigkeiten seines mit 12 PS stattlich motorisierten Cadillacs. Doch fuhr er den Wagen häufig in den Graben und provozierte etliche Beinaheunfälle. Der kühle Biograph Stape zeigt sich überraschend streng gegenüber dem Objekt seiner materialreichen Darstellung, wenn er am Ende Conrads literaturgeschichtlichen Rang kritisch fixiert: „Conrad ist unbestritten ein bedeutender Schriftsteller, weil er die Sichtweise seiner Generation und der Nachwelt verändert und geprägt hat. Im Ganzen betrachtet ist er aber vermutlich kein ganz >großer< Romanschriftsteller, da ihm – ganz knapp – die eisige Perfektion eines Stendhal oder Flaubert abgeht, worin er Tolstoi oder Dostojewski ähnelt. Sein Stil, geschmeidig und verführerisch und mit Kadenzen, die aus seinem mehrsprachigen Erbe geformt und dem Englischen einen neuen Ton abgewannen, wird zuweilen manieriert (die erwähnte >Darbietung auf der Conradorgel<) oder, schlimmer, ungenau, wenn er grammatische Feinheiten und Idiome nicht ganz in den Griff bekommt. Vom Aufbau neigen selbst seine besten Werke dazu, zum Ende hin auszufasern“. Nützlicher als diese stilkritische Hierarchisierung Stapes (die im übrigen gänzlich absieht von der wirkmächtigen diskursiven Rolle, die Conrad als Dichter kolonialer Ambivalenzen fürs 20. Jahrhundert doch fraglos innehat) sind die Anhänge seiner Biographie. Hier findet man Karten der politischen Verhältnisse um Polen und kartographische Darstellungen der kolonialen Regionen, die Conrad als Menschen und Schriftsteller wohl ähnlich nachhaltig prägten, wie er, als bild- und sprachmächtiger Autor, die Vorstellungen dieser Regionen für spätere Generationen formte. Permanente Irritationen lösen allerdings Stapes Umrechnungen der damaligen Geldbeträge in heutige Pfund aus. Zwar begründet der Biograph im Anhang gründlich, nach welchen Inflationsraten und Steigerungen des Volkseinkommens über 100 Jahre er diese Umrechnungen vornimmt. Doch bleibt die Höhe der heutigen Summen befremdlich, etwa wenn ein einmaliges Rettungsstipendium der britischen Regierung über 500 Pfund von 1905 heutigen 190000 Pfund entspräche oder für einzelne Erzählungen Zeitschriftenhonorare von 30000 (heutigen) Pfund gezahlt werden. Wo gäbe es heute solch üppig dotierten Autorstipendien oder Honorare?
Unter der Überschrift ‚Fremde Zungen’ werden Conrads Beziehungen zur französischen und englischen Sprache, in der er schriftstellerischen Weltruhm erringen wird, analysiert. Aufschlußreiche Kapitel widmet Schenkel Conrads Liebe zu Frankreich, die von dessen Autoren und Lesern recht früh und eifrig erwidert wurde; sowie Conrads Rezeption in Polen, die ihren vielleicht bedeutendsten Niederschlag fand in der Conrad-Begeisterung des Pioniers der Ethnologie, Bronislaw Malinowski. Neben seinen anderen literaturkritischen Essays, die allesamt Autoren des 19. Jahrhunderts (von Maupassant über Daudet und France bis Henry James und Turgenjew) galten, schrieb Conrad 1923 einen Aufsatz ‚Proust als Schöpfer’, in dem Prousts exzessiv analytische Fähigkeiten als Beitrag zur kreativen Dichtung gefeiert werden. Der lakonisch knapp formulierende Seemannsautor hat somit überraschenderweise lobenden Anteil an der frühen Rezeptionsgeschichte des französischen Ästheten mit den berühmten Schachtelsätzen. Für ein deutsches Publikum aufschlußreich ist auch Schenkels Verzeichnis der ambivalenten Figuren von Deutschen im Werk Conrads, der zur deutschen Literatur der Gegenwart kaum eine Beziehung hatte und die deutschen Klassiker bestenfalls als vage Kindheitserinnerung gekannt haben mag. Die literarisch künstlerische Rezeption Conrads in Deuschland findet sich bei Männern wie Benn, Genazino, Buchheim und Wolfgang Niedecken von BAP. Brigitte Kronauer wird als ‚vielleicht loyalste und sensibelste’ Leserin, die Conrad in deutscher Sprache gefunden hat’, zur weiblichen Ausnahme in der Gefolgschaft dieses Männer-Autors. In ihrem Roman ‚Der berittene Bogenschütze’ ist der Protagonist ein Conrad-Forscher, der von dem Unbestimmten, Vieldeutigen und Desillusionierenden im Werk des großen Erzählers besessen ist. Zur deutschen Rezeption Conrads sind im übrigen 2005 und 2006 zwei akademische Studien erschienen. Deren eine, versehen mit einer CD-Rom, die über 1000 Publikationen zu Conrad versammelt, ist als Forschungsprojekt von Frank Förster an Schenkels Leipziger Lehrstuhl entstanden. Im zentralen Kapitel ‚Weiße Finsternis’ berührt der essayistische Biograph geschickt kondensierte Fakten der Kolonialgeschichte. Und er erklärt Conrads raffinierte Erzähltechnik in ‚Herz der Finsternis’, durch die die genialische Monströsität des Europäers Kurtz überspielt wird in die moralische Verschlingung des Erzählers und des europäischen Lesers: „Nicht wie Rimbaud sagt er, ich ist ein anderer, sondern: der andere ist ein Ich, ich bin der andere. Kurtz ist Conrad, bin ich, bist du.“ Auf einem weiteren Dutzend Seiten werden die literarischen und politischen Nachwirkungen von ‚Herz der Finsternis’ skizziert, die bis zu Francis Coppolas ‚Apokalypse Now’ reichen, wo die verheerende Begegnung der vermeintlich Zivilisierten mit den vermeintlich Wilden in den Vietnamkrieg verlegt wurde. Schenkel bemüht sich um eine Korrektur des negativen Bildes der Gattin Conrads, die in vielen früheren Biographien sehr schlecht wegkam – wohl nicht zuletzt, weil die Biographen die Schriften der Witwe über ihren Mann als unleidliche Konkurrenz wahrnahmen. Nüchterne Erwägungen über die heiklen Transferprozesse zwischen Einbildungskraft, Leben und Werk vollzieht Schenkel angesichts eines bestimmten Typs von Frau. Die femme fatale materialisiert sich bei Conrad (wie übrigens bei zahllosen anderen Autoren der Jahrhundertwende) erst fiktional in einem frühen Roman, dann trat sie als Amerikanerin Jane Anderson, die später Propagandistin der Faschisten wurde, 1916 in Conrads Leben. Schließlich findet diese sich weitere 15 Jahre später zu literarischer Unsterblichkeit geformt wieder (zumindest spurenhaft und anteilig) als Arlette in den Dichtungen ‚Der Freibeuter’ und als Doña Rita in ‚Der goldene Pfeil’. Befremdlich an Schenkels insgesamt angenehm lesbaren, nur gelegentlich blumig formulierten Buch ist das wiederholte, zusammenfassende Zitieren aus Briefen, das ohne Anführungszeichen Briefpassagen in einer Art style indirect libre kondensiert. Dies führt die willkommene Technik des Verdichtens und Dramatisierens, die Schenkels biographischen Versuch auszeichnet, dann vielleicht doch etwas weit. Lieber wüßte man doch genau, was und mit welchen Worten Conrad hier schrieb, und wo wir wieder der Stimme seines Biographen lauschen. Auch der wichtigen Frage der Leserbindung und der Rezeptionshaltung, die Conrads Werke provozierten, stellt sich der deutsche Conrad-Experte, wenn er die Obsession für biographistische Schlüsse(l) kommentiert: „Kein Roman Conrads hat wie Lord Jim zu solchen Suchaktionen Anlaß gegeben, und man fragt sich, wieso eigentlich? Welche Rolle spielt es, ob es einen wahren Lord Jim gegeben hat oder aus welchen realen Personen sich die Fiktion zusammensetzt? Warum dieses endlose Puzzlespiel mit all den Williams und Wallaces, den Lingards, den Toms und Jims? Vielleicht ist es dies: mit keiner anderen Figur Conrads kann man sich so identifizieren wie mit Jim. Marlowe bleibt zu sehr im Schatten, Kurtz ist zu dämonisch, Nostromo zu sehr Meister seines Metiers, Winnie Verloc zu melodramatisch, Heyst zu philosophisch distanziert, Razumov zu russisch und all die anderen Seebären zu seebärenhaft. Die Identifikation mit Jim heißt aber auch Identifikation mit Schuld und Scham.“ Womit wir wieder bei der Frage nach den Anziehungskräften wären, die Conrads Werke wie sein Leben auf eine heutige Leserschaft (und Biographenschar) ausübt.
Joseph Conrads
Protagonisten sind meist so integre wie isolierte Kämpfer für hehre Ideale,
die den widrigen Realitäten freilich selten standhalten. Ihr heroisches,
stoisches und einsames Scheitern lädt besonders männliche Leser zur
Identifikation ein. Das ist vielleicht nicht zuletzt einer leicht
sentimentalen Erzählhaltung der Erinnerung an vergangene erlebnisreiche
Zeiten geschuldet, wie sie nicht nur Novellen wie ‚Jugend’ oder ‚Das Ende
des Lieds’ kennzeichnen, sondern auch Conrads Erinnerungsbuch ‚Im Spiegel
der See’. Idealismus und Pessimismus werden von Conrad mittels einer oft nur
ganz leicht ironisch eingefärbten Standpunkttechnik und durch seinen
lakonischen Erzählton kunstvoll amalgamiert. Conrads durch vielerlei Erzähltricks meist spannend dargebotene Erzählungen feiern die imperialistische Religion der Kraft selten ungebrochen. Seine Darstellung elementarer Gefühle und der Hang zum Kult ums primitive Leben, welche die Situationen auf See mit sich bringen, machten Conrad zu einem Existenzialisten avant la lettre. Die Condition humaine verdüstert sich im Werk dieses Spätviktorianers und nähert sich der Moral des Camusschen’ Sisyphos, der seine vergeblichen Mühen tapfer, ja glücklich erträgt.
Stapes etwas additiv
langatmiges Buch bietet das Archiv der meisten wichtigen Fakten zu Conrads
Leben. Schenkels Essay-Biographie wirft erhellende Schlaglichter auf eine
Vielzahl der besonders interessanten Aspekte von Conrads Leben, Werk und
Wirkung. Alliés Neuübersetzung wiederum bietet gewissermaßen den Anfang des
Liedes und die eigentliche Essenz dieses Meistererzählers: seine Texte in
einer gelungenen Übertragung. Gerne hätte man freilich in diesem schön
gestalteten Buch des S. Fischer Verlags auch noch einige kurze Anmerkungen
des Übersetzers zu den Prinzipien seiner Übertragung gefunden und zur
Geschichte der Conrad-Verdeutschungen. Doch für solche Hinweise auf die
Übersetzungsgeschichte und Übersetzungskunst ist in einer Leseausgabe eines
Publikumsverlags offenbar leider noch kein Raum.
Bernd Blaschke |
John
Stape |
|
|
Glanz@Elend
|
|||

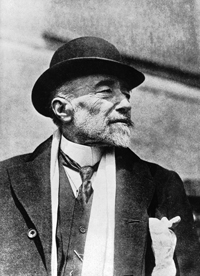
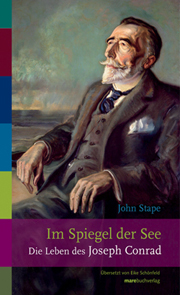 John Stapes
Conrad-Biographie ‚Im Spiegel der See’, die vom Mare-Buch Verlag im Jahr
ihres englischen Erscheinens sofort auf deutsch publiziert wurde, operiert
ungeheuer faktenreich und positivistisch nach dem aufzählenden Modus. Stape,
der gleichfalls als Herausgeber des ‚Cambridge Companion to Joseph Conrad’
fungierte, ist zweifellos einer der gründlichsten Kenner des Erfolgsautors.
Doch leider verschafft einem die materialreiche Nacherzählung der
Conradschen Vita so etwa im Monatstakt keine besonders einprägsamen oder gar
fesselnden Lek
John Stapes
Conrad-Biographie ‚Im Spiegel der See’, die vom Mare-Buch Verlag im Jahr
ihres englischen Erscheinens sofort auf deutsch publiziert wurde, operiert
ungeheuer faktenreich und positivistisch nach dem aufzählenden Modus. Stape,
der gleichfalls als Herausgeber des ‚Cambridge Companion to Joseph Conrad’
fungierte, ist zweifellos einer der gründlichsten Kenner des Erfolgsautors.
Doch leider verschafft einem die materialreiche Nacherzählung der
Conradschen Vita so etwa im Monatstakt keine besonders einprägsamen oder gar
fesselnden Lek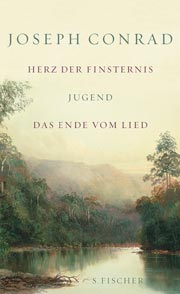 Die
multiplen Pannen und der finale Untergang des Kohlentransportschiffs ‚Palestine’,
auf dem Conrad als 25jähriger mehr in Docks lag als tatsächlich auf der See
fuhr, waren Vorbild für die Ereignisse seiner Novelle ‚Jugend’. Obwohl der
Immigrant sich fortbildet und es schließlich bis zum Kapitänspatent bringt,
findet er auf den Schiffen meist nur Arbeit auf einer Stufe unter seiner
Qualifikation.
Die
multiplen Pannen und der finale Untergang des Kohlentransportschiffs ‚Palestine’,
auf dem Conrad als 25jähriger mehr in Docks lag als tatsächlich auf der See
fuhr, waren Vorbild für die Ereignisse seiner Novelle ‚Jugend’. Obwohl der
Immigrant sich fortbildet und es schließlich bis zum Kapitänspatent bringt,
findet er auf den Schiffen meist nur Arbeit auf einer Stufe unter seiner
Qualifikation. 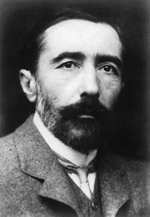 1897 etabliert der
1857 geborene Conrad sich zunehmend als respektierter Autor. Er gewinnt die
Anerkennung etwa von Henry James und schreibt sein Vorwort zu ‚Der Nigger
von der >Narcissus<’, in dem sich seine berühmten wirkungsästhetischen
Aussagen finden: „euch kraft des geschriebenen Wortes hören, fühlen – und
vor allem sehen zu machen.“ Widersprüchliche Aussagen oder
Selbststilisierungen Conrads existieren über die Erfindung seiner berühmten
Erzählerfigur Marlow. In der Erzählung ‚Jugend’ taucht dieser später immer
wieder verwendete Erzähler 1898 erstmals auf. Diese Erzählung hat Conrad (je
nach Version ihrer Schöpfungslegende) entweder direkt in der Nacht nach der
Geburt seines ersten Sohnes Borys verfaßt, oder einen oder fünf Monate
später.
1897 etabliert der
1857 geborene Conrad sich zunehmend als respektierter Autor. Er gewinnt die
Anerkennung etwa von Henry James und schreibt sein Vorwort zu ‚Der Nigger
von der >Narcissus<’, in dem sich seine berühmten wirkungsästhetischen
Aussagen finden: „euch kraft des geschriebenen Wortes hören, fühlen – und
vor allem sehen zu machen.“ Widersprüchliche Aussagen oder
Selbststilisierungen Conrads existieren über die Erfindung seiner berühmten
Erzählerfigur Marlow. In der Erzählung ‚Jugend’ taucht dieser später immer
wieder verwendete Erzähler 1898 erstmals auf. Diese Erzählung hat Conrad (je
nach Version ihrer Schöpfungslegende) entweder direkt in der Nacht nach der
Geburt seines ersten Sohnes Borys verfaßt, oder einen oder fünf Monate
später.