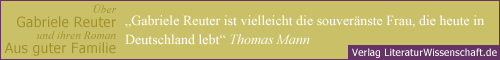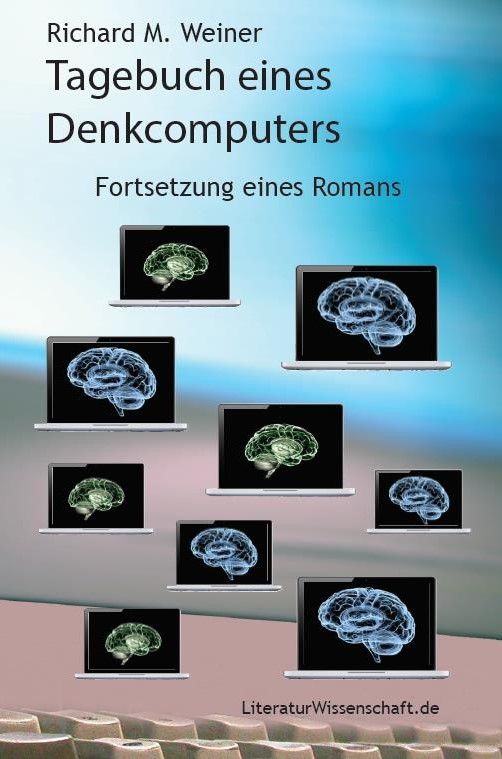Christian Chappelow schrieb uns am 14.06.2017
Thema: Peter von Matts anekdotenreicher (und leider wenig aufschlussreicher) Ausflug in die Welt der Lyrik
Mit einem halben Katalog von Fragen zur Natur der Lyrik lädt der Reclam Verlag auf dem Klappentext zur Lektüre des Essaybandes Was ist ein Gedicht? vom Germanisten und Schriftsteller Peter von Matt ein. Mit euphemistischen Worten werden die Einlässe von Matts zum Gedicht gepriesen, der Autor gar als „einer der großen Literaturvermittler“ und ein „Verführer zum Lesen“ bezeichnet. Zurecht mag man behaupten, feierte der inzwischen achtzigjährige von Matt jüngst mit dem Band Sieben Küsse Glück und Unglück in der Literatur einen vergleichbaren, medienwirksamen Ausflug in Schicksalskonzepte um literarische Küsse. Ausgangspunkt der Verführung in die Lyrikwelt scheint zu sein, dass es Diskussionsbedarf zu mannigfaltigen Facetten dieser Literaturform gibt. Wie anders lässt sich erklären, dass dieser essayistische Rundumschlag von Matts nicht nur grundsätzliche Einblicke in das Verfassen von Gedichten, ihrer Geschichte und ihrer poetischen Gestaltungsmöglichkeiten geben will, sondern immer wieder erwähnt werden muss, dass eigentlich niemand weiß, was ein Gedicht sei (S. 9), oder dass in der Gegenwart die Existenz von Gedichten unter Verdacht stehe (S. 43)?
Die leichte Zugänglichkeit aktueller Forschungstopoi, aufbereitet für ein an Belletristik gewöhntes Lesepublikum, bestimmt das Werk. Es ist bestimmt durch die Verbindung von Arbeitsbereichen der Literaturwissenschaft und der Psychoanalyse – eine Kombination, die vor allem AnhängerInnen von Freud oder Jung gefallen dürfte. Irgendwo zwischen Essay, Kritik und Literaturwissenschaft anzusiedeln, möchte der Verfasser in Was ist ein Gedicht? den Fragekatalog aber nicht durch die „theoretischen Diskurse der Moderne“ (S. 14), sprich auch bestehende literaturwissenschaftliche Befunde, beantworten. Stattdessen wird die weite Welt des Gedichts in eigenen, anekdotenhaften mit bis unter esoterisch anmutenden Lesungen bereist; eine Strategie, die was Wesen des Gedichts als ein „anthropologisches Ereignis“ (ebd.) fassen mag, einem menschlichen Streben nach Vollkommenheit. Leider wird zu keinem Zeitpunkt der Lektüre eindeutig klar, was mit dieser Strategie wie verfolgt wird (ein ähnliches Narrativ zur anthropologischen Lesung von Gedichten konstruierte von Matt bereits in seinem 1998 veröffentlichten Essay mit dem Titel „Zur Anthropologie des Gedichts und zum Ärgernis seiner Schönheit“, auf dem der vorliegende Band aufbaut).
Das anthropologische Ereignis des Gedichts wird so im Detail in neun kürzeren thematischen Essays zu den Themen Vollkommenheit, Inspiration, Ernüchterung, Epochenmoral, Aufstand der Moderne, Hermetik, Natur, Politik und Liebe untersucht. Ein Mangel der sich aus dieser thematischen Einleitung ergibt ist der, dass der Leserin oder dem Leser keine Anhaltspunkte gegeben werden, über welche DichterInnen oder welche Epochen er nun liest. Zu willkürlich sind in den einzelnen Essays die besprochenen Gedichte gewählt, zu wenig Kontext geboten, als dass dabei nachhaltiger Erkenntnisgewinn über das Untersuchungsobjekt der Lyrik geboten wird. Ob man der sprachlich gekünstelten Argumentationslinie von Matts nun aus Erkenntnisinteresse oder literarisch gebildetem Unterhaltungsanspruch verfolgt, mag abhängig von Rezeptionsästhetik und Leseverhalten sein. Der paternalistische wie elitäre Duktus, in dem diese anthropologische Argumentation umgesetzt wird, entzieht sich in Zitaten wie dem folgenden Vergleich zwischen der Frau und dem Gedicht zumindest sowohl Erkenntnis- wie auch Unterhaltungsanspruch:
Wenn man sagt, jede Frau wolle schön sein, ist das ein Klischee und womöglich ein sexistischer Akt. Dass dem trotzdem so ist, macht die Sache nicht einfache. So auch beim Gedicht (S. 13)
Lässt man sich auf den paternalistischen Tonfall sowie die Erkenntnis ein, dass es sich hier bewusst nicht um eine literaturwissenschaftlich und gattungstheoretisch zitierfähige Abhandlung zur Literaturform des Gedichts handelt, mögen die zahlreichen Anekdoten zum Wirken und Werk bekannter Weltautoren von Shakespeare über Rilke bis Brecht durchaus informativ unterhalten. Ebenso beeindrucken mag die neugierige Hingabe, mit der von Matt seine lyrischen Favoriten kommentiert. Kaum ein anderer Literaturkritiker der Gegenwart schafft es wohl, mit solch überschwänglichen Worte in die Welt sowohl klassischer wie auch moderner Dichtung einzutauchen, wie auch die sprachliche Konstruktion lyrischer ProtagonistInnen, Topoi und Emotionen mit argumentativem Spannungsaufbau entlang der eigenen Leseerfahrung paratextuell aufzuwerten.
Ebenso euphorisch ist mitunter die Sprachwahl der Unterüberschriften, mit der die besprochenen Dichterinnen und ihre Poetik wie in einem Drama in die Narrationen von Matts eingeführt werden. Beispiele hierzu: „Wenn der Gott verschwindet“ (S. 34, zu Shakespeare), „Brecht schafft Ordnung in der Lyrik“ (S. 90) oder auch „Verschlüsselung und Klartexte beim frühen Grass“ (S. 124). Die Leidenschaft des Autors für sein Forschungsfeld springt dabei auch auf den Leser überspringen. Eine gelungene (wenn auch hochgradig selbstinszenierende und unwissenschaftliche) Werbung also für eine Literaturform, die kaum nach Präsenz auf den Bestsellerlisten zeigt?
Nur mit zwei Einschränkungen lässt sich diese Frage positiv beantworten. Erstens zeigt sich in den großen und meinungsgeladenen Narrativen zum Wesen des Gedichts eine tendenzielle Abneigung gegen modernistische Texte. Auch den „Aufstand der Moderne“, der durch poetische Dekonstruktionen rebellierte, weiß von Matt als jugendlichen Leichtsinn etwas entzaubern, schreibt es doch mit absoluter Überzeugung davon, dass jedes Gedicht (ob es das möchte oder nicht) nach den vormodernen Idealen von Vollkommenheit strebe. Insgesamt lassen die absoluten (anthropologischen) Urteile zu dem Wesen des Gedichts wenig Raum für Detailsichtung, Opposition oder aber auch die angekündigte Diskussion. Vielmehr fühlt man sich wie vom Klassenlehrer im Gymnasium belehrt.
Zweite Einschränkung zeigt sich schnell für den an außereuropäischer Literatur interessierten Lyrikfreund. Die Frage scheint nur angebracht, mit welcher Legitimation man in der hochgradig selektiven Betrachtung primär deutscher, englischer oder französischer Gedichte ein „anthropologischen Ereignis“ definieren kann. Die absoluten Aussagen zum Anspruch der Vollkommenheit im Gedicht etwa bedürfen zwingend, und in dieser Erkenntnis verlieren sich die schönen Ausführungen von Matts an argumentativem Boden, eine Definition erstens der Terminologie des „Gedicht“ jenseits des Anthropologischen, zweitens eine zurecht bescheidene Selbstkritik gegenüber der eurozentrischen Perspektive auf die Welt der Literatur. Schließlich, und das mag man 2017 als dritten Kritikpunkt äußern, lässt der Blick auf die Großen der Welt der Lyrik keinen Raum für aktuelle Trends und Turns, beispielsweise Digitalisierung, Interaktivität oder Performanz, zu. Die Leitfrage „Was ist ein Gedicht?“ verpasst so Anschluss an relevante Diskussionen zum Zustand von Gedichtproduktion und Gedichtrezeption um die Jahrtausendwende. Auch hierdurch rückt der Gesamteindruck des Bandes eher in die Richtung eines Reliktes vergangener Tage, sowohl durch die Ergötzung an den Genies der Lyrikgeschichte wie auch der Attitüde des elitären Literaturvermittlers.
Vielleicht auch möchte von Matt selbst ein lyrisches Genie imitieren, das nach Vollkommenheit strebt – eine Vollkommenheit, die der detaillierten, präzisen und nie absoluten wissenschaftlichen Erkenntnis durch Theoretisierung die intuitive Lesefreude nehmen kann. Scheint es verlockend, die Augen einstweil für den Ernst literaturwissenschaftlichen Arbeitens zu Zeiten beschleunigter und ökonomisierter Forschungslandschaften zu schließen, geht kein Weg an der Frage vorbei, ob es auch in der so trivialen erscheinenden Welt der Literaturkritik angebracht ist, den einfachen Weg zur Erkenntnis zu gehen, den postfaktischen Weg um empirisch nachprüfbarer Verantwortung. Spannend ist die Frage „Was ist ein Gedicht?“ auf jeden Fall, der Band als unterhaltsame wie anekdotenreiche Begleitlektüre zur Texten von Weltliteratur empfehlenswert. Nur mit gutgläubiger Bewunderung für das Genie des Verfassers mag man den paternalistischen Duktus verzeihen. Stichhaltige Antworten auf die Frage sollte man andersweit suchen.
|