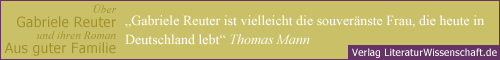Martin A. Hainz schrieb uns am 12.10.2018
Thema: Hans Blumenberg: Phänomenologische Schriften
Hans Blumenberg beschäftigte sich phasenweise intensiv mit der Phänomenologie und dem Denken Husserls, manche seiner Texte lesen sich auch so, als ließe er sich diesem Komplex zuordnen. Allerdings wäre das zu einfach, ihm geht es eher um die Anstöße aus derselben, man müsse „an das denken, was zu überwinden war“, um die Phänomenologie nicht zu gering zu veranschlagen, während er – eben kein Phänomenologe – doch auch einräumt, dass man vom „Programmatischen“ bei ihr „mehr vergessen (muss), als einem ohne Besorgnis um die Substanz geheuer sein kann.“
Wie Blumenberg den Impetus wahrt, ebenso aber Distanz zu Husserl oder auch Heidegger, das konnte man dem 1986 erschienen Band Lebenszeit und Weltzeit wie auch dem posthum erschienenen Band Beschreibung des Menschen entnehmen, das belegt nun aber auch der nicht nur für begeisterte Blumenberg-Leser spannende Band Phänomenologische Schriften, der wesentlich dem Nachlass-Konvolut „PHA“ aus Marbach entspricht. Die Typoskripte waren bereits weitestgehend ausgearbeitet, samt Fußnoten, wobei der Herausgeber dankenswerterweise Quellen dennoch teils nach anderen Editionen zitiert, etwa Nietzsche nicht nach der Musarion-Ausgabe, sondern nach Colli/Montinari. Entstanden sind die Typoskripte anhand der Karteikarten, die der mit Blumenberg Vertraute wohl kennt.
Was nun die Einzeltexte betrifft, die den Band ergeben, so sind es einerseits genaue Beobachtungen, die jeweils Systeme entweder aufreißen, fast aphoristisch als Möglichkeit skizzieren, oder andererseits präzise Destruktionen, vielleicht ließe sich auch von Dekonstruktionen sprechen, freilich in einem anderen Gestus. So werden das, was sei, das Denken desselben und der Text als Gelegenheiten für oder zu einander gezeigt, dann aber mit „okkasionellen Beschränkungen“. So wird vom Sich-Zuhören geschrieben, dass man sich nicht „glaube(n)“ müsse – nicht einmal, das von sich etwa „Gehörte zu denken […], wenn […] laut gedacht wird.“ Das Erlebte überrascht, so entsteht ein Text zum „Elementarerlebnis der Überraschung“, das dann immerhin skizziert wird: abgesehen von dem, was da oder damit kommen mag. Und den „Raum“ beschreibt Blumenberg als „Grenzwert von »Atmosphäre«“, wobei er unversehens zwischen denen steht, die den Raum als eben diese oder aber als transzendentale Kategorie sehen und dann nicht mehr weiter wissen.
Zwischen diesen und anderen Stühlen entfaltet sich das Denken Blumenbergs, raffiniert und irritierend, aber auf jeden Fall anregend – dieser Philosoph bleibt jenseits aller modischen turns eigentümlich aktuell.
|