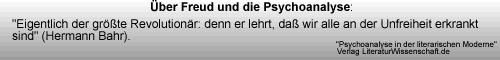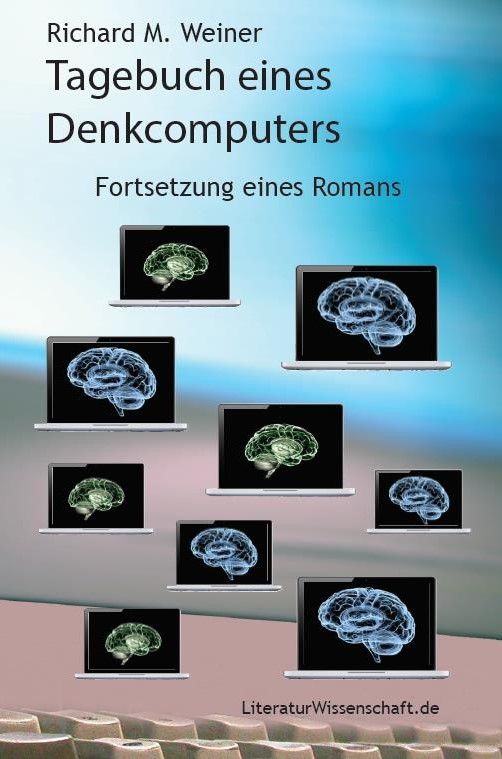Leserbriefe zur Rezension
Demonstrare contra docere - Figuren des Unbestimmbaren
Roland Barthes "Neutrum"
Von Evelyne von Beyme
Johannes-Paul George schrieb uns am 07.03.2006 Barthes Konzeption des stark an die „différance“ Derridas erinnernden „Neutrum“-Begriffs stellt sich sowohl formal wie inhaltlich als der durch die Trauer um seine ein Jahr zuvor verstorbene Mutter verstärkte Versuch dar, die einschränkenden Zwänge des Logos, die grammatikalischen Vorschriften des Diskurses zu sprengen und somit endgültig das rein strukturalistische, dyadische Denken zu verlassen, indem ein Drittes, das „Neutrum“ (das als Genus im Französischen nicht vorkommt!), als paradigmensprengend eingeführt wird. Die von Barthes seit „Le plaisir du texte“ verfolgte hedonistische Ausrichtung seiner dritten und letzten Schaffensphase, kommt auch im „Neutrum“ überdeutlich zum Vorschein. |
Matthias Attig schrieb uns am 18.08.2012 als Antwort auf einen Leserbrief In seinen Vorlesungen »Das Neutrum« und »Wie zusammen leben« hat Barthes schlagend wie kaum ein Denker vor ihm demonstriert, dass noch die scheinbar esoterischsten Überlegungen – diejenigen, denen häufig Lebensferne und Selbstgenügsamkeit unterstellt wird – auf die Alltagswirklichkeit Einfluss üben können, wenn sie sonst unbeachteten Vorgängen und Routinen, das heißt dem vermeintlich Banalen regelrecht maßlose Aufmerksamkeit angedeihen lassen. Allein die Genauigkeit der Betrachtung scheint ihren Gegenstand zu verwandeln und über den gesellschaftlichen Zusammenhang, in dem er eine spezifische Funktion erfüllt, hinauszuheben. Eben darin, dass sie dem Ephemeren ein Eigengewicht zumisst, liegt das subversive Moment aller Sensibilität, das sie Funktionären und Politikern, die sonst nicht müde werden, von den Geisteswissenschaften einen sofort zu Buche schlagenden gesellschaftlichen Nutzen einzufordern, so verdächtig macht. |