Am 21. Mai 1975 begann in Stuttgart-Stammheim der Prozess gegen vier Mitglieder der Rote-Armee-Fraktion. Unter ihnen Ulrike Meinhof, die das Ende des Mammutprozesses nicht mehr erlebte – sie erhängte sich 1976 in ihrer Zelle. Die politische Aktivistin und Autorin Jutta Ditfurth über eine Frau, von der in der öffentlichen Wahrnehmung bis heute ein verzerrtes Bild existiert.
von Jutta Ditfurth

Ulrike Meinhof wäre heute 80 Jahre alt. Vor 40 Jahren begann ihr Prozess in Stuttgart-Stammheim. Da hatte sie bereits drei Jahre unter fürchterlichen Bedingungen in Untersuchungshaft gesessen. Am 21. Mai 1975 wurde sie in Handschellen in einer fensterlosen Kellerzelle des Oberlandesgerichts eingeschlossen. Als sie den Gerichtsaal betrat, erschraken Menschen, die sie kannten, denn sie sah aus wie eine, die gleich in Ohnmacht fällt. Sie hatte einen Mammutprozess mit insgesamt 192 Verhandlungstagen vor sich, den sie nicht überleben würde.
Acht Jahre nach Erscheinen meiner Meinhof-Biografie werden vielerorts immer noch alte Mythen wiedergekäut, die ich dort längst widerlegt habe. Immer noch wird behauptet, Ulrike Meinhof stamme aus einer antifaschistischen christlichen Familie, sei von einer fortschrittlichen Pflegemutter (Renate Riemeck) erzogen worden und habe, weil ihr Ehemann (Klaus Rainer Röhl) sie betrog, zu Sprengstoff gegriffen. Verwirrt und planlos sei sie bei der Befreiung von Andreas Baader im Mai 1970 aus dem Fenster in den Untergrund gesprungen. Dann habe die „Rabenmutter“ auch noch ihre Zwillingstöchter entführen lassen, während sie in den bewaffneten Kampf zog, um am Ende dem Streit mit Gudrun Ensslin, und nicht unmenschlichen Haftbedingungen zum Opfer zu fallen. Die zahlreichen Akten, die ich für meine Recherchen über Jahre hinweg ausgewertet habe, waren unberührt wie frisch gefallener Schnee. Andere Autoren machten sich nicht die Mühe, sie zu lesen. Es war wohl leichter, die Fakten den Mythen zu opfern.
Die Meinhofs waren Deutsche Christen und Nazis. Der Vater Werner Meinhof, ein ehrgeiziger NS-Kunsthistoriker, war an der Kampagne „Entartete Kunst“ beteiligt. Die Historikerin Renate Riemeck leugnete bis zu ihrem Tod 2003 ihre NSDAP-Mitgliedschaft und verschwieg, dass sie an der „SS-Universität“ Jena ihre Karriere begonnen hatte. Ehemann Röhl entwickelte sich im Laufe seines Lebens politisch immer weiter nach rechts, ähnlich wie das frühere RAF-Mitglied Horst Mahler, der heute Neonazi ist. Ulrike Meinhof musste versuchen – inzwischen ist bestätigt, was ich im Buch schrieb –, die Töchter vor ihrem pädophilen Ehemann in Sicherheit zu bringen.
Was Stefan Aust in seinem Buch Der Baader-Meinhof-Komplex zusammentrug, stammte größtenteils aus Polizeiakten und von fragwürdigen Zeitzeugen. Das Trio Bernd Eichinger (Produzent und Drehbuch), Uli Edel (Regisseur) und Stefan Aust (Story-Lieferant) schuf den gleichnamigen Film. Es prahlte mit historischer Genauigkeit und behauptete, jeder Einschusswinkel sei belegbar. Doch viele Szenen, die das Leben von Ulrike Meinhof betreffen, entbehren jeglicher Realität. Die vierte, ebenfalls nicht neutrale Quelle war das Bundeskriminalamt (BKA).
Der Umgang mit Ulrike Meinhofs Lebensgeschichte ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie sich herrschende Meinung herstellen lässt. Interessengeleitete Legenden ließen das Zerrbild eines Menschen entstehen. Dabei ist Ulrike Meinhofs Biografie wie kaum eine zweite geeignet, die eisernen autoritären Nachkriegsjahre der alten Bundesrepublik anschaulich zu machen.
Ulrike Meinhof, am 7. Oktober 1934 in Oldenburg geboren, war nicht die brave junge Christin, sondern eine Art Beatnik: Sie trug Hosen, rauchte auf der Straße, las existentialistische Philosophen und liebte moderne Kunst. Auf dem Gymnasium ließ sie sich nicht von autoritären Nazilehrern einschüchtern, sondern verlangte von ihnen Respekt. Um ein Haar flog sie deshalb von der Schule. Die junge Ulrike Meinhof tanzte leidenschaftlich gern, spielte Schlagzeug in einer Jazz-Combo und fühlte sich politisch dem linken Flügel der SPD nahe. Sie liebte den jungen Künstler Thomas Lenk und dann die gleichaltrige Maria. Renate Riemeck, ihre Pflegemutter, untersagte beide Beziehungen und drohte der mittellosen Vollwaise, sie auf die Straße zu werfen oder ins Heim zu sperren (Weilburg 1952-1955). Diese Bedrohung war konkret.
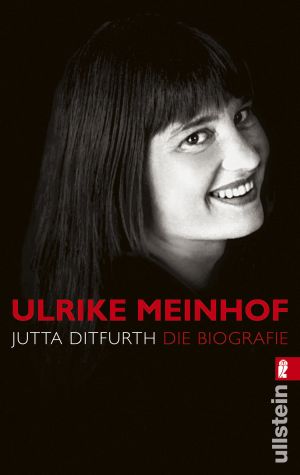 Mitten im Kalten Krieg wurde die Studentin – inspiriert von Marx, vom Kampf gegen die Wiederbewaffnung und vom KPD-Verbot – im Widerstand gegen Atomwaffen politisch aktiv (Marburg 1955). Sie gründete die erste Anti-Atom-Gruppe und organisierte eine Kundgebung (Münster 1958). Dabei kam die 24-Jährige der SPD in die Quere, denn die Partei war auf dem Weg nach Bad Godesberg, um endlich regierungsfähig zu werden, und bekannte sich dafür zur Nato und zum Kapitalismus. Bis in die „Baracke“ in Bonn (die damalige SPD-Bundesgeschäftsstelle) reichten die Intrigen gegen die junge Frau. Als Ulrike Meinhof und ihre Freunde den studentischen Anti-Atom-Kongress in Westberlin aus der Bevormundung der SPD-Führung um Helmut Schmidt befreiten und die Forderung durchsetzten, Gespräche mit der DDR zu führen, ging eine Pressekampagne los, die der späteren Hetze der Springer-Medien gegen die Außerparlamentarische Opposition (APO) in nichts nachstand (Januar 1959). Die SPD jagte Ulrike Meinhof aus dem SDS, der im Mai 1959 noch der Studentenverband der SPD war.
Mitten im Kalten Krieg wurde die Studentin – inspiriert von Marx, vom Kampf gegen die Wiederbewaffnung und vom KPD-Verbot – im Widerstand gegen Atomwaffen politisch aktiv (Marburg 1955). Sie gründete die erste Anti-Atom-Gruppe und organisierte eine Kundgebung (Münster 1958). Dabei kam die 24-Jährige der SPD in die Quere, denn die Partei war auf dem Weg nach Bad Godesberg, um endlich regierungsfähig zu werden, und bekannte sich dafür zur Nato und zum Kapitalismus. Bis in die „Baracke“ in Bonn (die damalige SPD-Bundesgeschäftsstelle) reichten die Intrigen gegen die junge Frau. Als Ulrike Meinhof und ihre Freunde den studentischen Anti-Atom-Kongress in Westberlin aus der Bevormundung der SPD-Führung um Helmut Schmidt befreiten und die Forderung durchsetzten, Gespräche mit der DDR zu führen, ging eine Pressekampagne los, die der späteren Hetze der Springer-Medien gegen die Außerparlamentarische Opposition (APO) in nichts nachstand (Januar 1959). Die SPD jagte Ulrike Meinhof aus dem SDS, der im Mai 1959 noch der Studentenverband der SPD war.
Enttäuscht von der SPD und beeindruckt von den Lebensgeschichten deutscher Kommunisten, die KZs überlebt hatten und nun erneut verfolgt wurden, trat Ulrike Meinhof im Herbst 1958 in die illegale KPD ein und entwickelte freundschaftliche Beziehungen zur SED. Etwa von diesem Zeitpunkt an wurde sie überwacht. Die KPD überzeugte Meinhof 1959 Redakteurin von konkret in Hamburg zu werden, 1961 wurde sie Chefredakteurin. Sie schrieb ab 1961 über die Notwendigkeit einer „neuen Linken“. 1964 brach sie mit der dogmatisch gewordenen KPD.
Als sich Ulrike Meinhof 1967 der APO anschloss, mit Rudi Dutschke anfreundete und nach Westberlin zog, war sie 33 Jahre alt, eine prominente politische Publizistin, Dozentin und alleinerziehende Mutter von sechsjährigen Zwillingen. Sie war seit Anfang der 1960er bekannt für ihre großartigen Reportagen über NS-Prozesse, Heimkinder, Industriearbeiterinnen und „Gastarbeiter“. Sie war 1964 „die erste Person in der Bundesrepublik, die aufrichtig und ernsthaft wünschte, über meine Erlebnisse im Warschauer Ghetto informiert zu werden“, schreibt Marcel Reich-Ranicki in seiner Autobiografie. Er ließ auch unter Druck von dieser Aussage nicht ab.
Die Lage in Westberlin war Ende der 1960er Jahre so bedrohlich, dass Ulrike Meinhof die DDR um die Bereitstellung von Bauhelmen bat – zum Schutz der Westberliner Linken. Die Westberliner Polizei war durchtränkt von alten Nazis und von ehemaligen Angehörigen der Wehrmacht und der SS-Divisionen. Unter dem Beifall eines Teils der Öffentlichkeit und angefeuert von den Springer-Medien ging sie brutal gegen die neue Linke vor. In Portugal, Spanien und Griechenland herrschten faschistische Diktaturen.
Meinhof verlor durch Röhl ihren Einfluss auf konkret. Ihre Arbeit als Journalistik-Dozentin an der FU wurde von der CDU attackiert. Ihr Fernsehspiel Bambule wurde ihr aus der Hand genommen. Ihr Freund Rudi Dutschke wurde Opfer eines Attentats. Die APO zerbrach, beschleunigt durch den Überfall der Warschauer Pakt-Staaten auf den Prager Frühling, mit dem Ulrike Meinhof sympathisierte. Der Krieg in Vietnam wütete immer noch (1968/69).
Ulrike Meinhof sah sich in einer Sackgasse, sie diskutierte mit Freunden über den „bewaffneten Kampf“. Die BRD schien ihr fälschlicherweise in einem vorrevolutionären Zustand zu sein, den eine militante „Avantgarde“, die RAF, zuzuspitzen habe. Anfang 1970 beschaffte sie Geld für Waffen. Sie brachte ihre Kinder unter und steckte ihr gesamtes Vermögen, einen Pfandbrief über 40 000 Mark, in ihre Handtasche, als sie sich aufmachte, um Andreas Baader zu befreien.
Fünf Jahre später, Mai 1975: Einen Prozess wie den Stammheim-Prozess hatte es in der Bundesrepublik Deutschland noch nie gegeben. Er war neben dem Auschwitz-Prozess der einzige, von dem es ein Wortprotokoll gab. Selbst Ärzte des Gerichts stellten fest, dass kein Gefangener solche Haftbedingungen gesund überstehen könne – wie da erst einen Prozess? Aber der Staat hielt an seinem Vorgehen fest. Am 9. Mai 1976 wurde Ulrike Meinhof erhängt in ihrer Zelle gefunden. Helmut Schmidt war Bundeskanzler.
Mit der portugiesischen Revolution endeten 1974 die Kolonialkriege in Angola, Mosambik und Guinea-Bissau, gegen die Ulrike Meinhof gekämpft hatte. Bald darauf wurde das Militärregime in Griechenland gestürzt. Die meisten jungen Linken in der Bundesrepublik kannten den SDS und die APO nur noch aus Erzählungen.
Es gibt immer noch keine Veröffentlichung der vollständigen Texte von Ulrike Meinhof. Das ist nicht von Staats wegen verhindert worden, sondern dafür haben ihre Töchter gesorgt.
Weblinks
„Ulrike Meinhof. Die Biografie” auf den Seiten der Ullstein Buchverlage
Die offizielle Website von Jutta Ditfurth
Mehr von Jutta Ditfurth über Ulrike Meinhof
Jutta Ditfurth bei Facebook
Facebook-Fanpage für Jutta Ditfurth

