Zum ersten Mal nach über zwei Jahren kamen Nord- und Südkorea zum Jahresbeginn zu direkten Gesprächen zusammen. Thomas Reichart beobachtet als Asienkorrespondent für das ZDF die Lage zwischen den verfeindeten Bruderstaaten. Um ermessen zu können, was diese Gespräche bedeuten, muss man die Geschichte Koreas kennen. In „Der Wahnsinn und die Bombe“ blickt Reichart zurück auf die Ereignisse die zur Teilung Koreas führten und zeigt, wie sich diese bis heute auf das Leben der Menschen dort auswirken.

Lee Young-kyu steht am Rand eines Feldwegs, wo brusthoch wilder Sesam wächst. Er reißt eines der handtellergroßen Blätter ab und saugt den ätherischen Duft ein. Für die Koreaner ist Sesam eine Wunderpflanze. Die Blätter haben heilende Kräfte, sagt Lee. »Du musst mal koreanisches Grillfleisch darin einwickeln, das ist am besten.« Er grinst und sieht hinüber zu einem Bauern, der Unkraut zwischen den Sesampflanzen entfernt. Lee, Anfang sechzig, klein und athletisch, ist einer, der immer zugepackt hat, der immer Kraft hatte und Mut und Zuversicht. Aber etwas hat sich da bei ihm verändert, schleichend und langsam ist die Angst gewachsen in ihm. Die Angst, die immer da war, die sich aber durch viel harte Arbeit wegdrücken ließ.
Vögel zwitschern über weiten Reisfeldern, die sich langsam gelblich färben, weil die Ernte naht. Uncheon könnte ein friedlicher Ort in Südkorea sein, wenn nicht hinter dem Bauern auf einer Böschung ein hoher Stacheldrahtzaun verliefe. Wenn da nicht die Wachttürme wären. Und die südkoreanischen Militärpolizisten, die sofort mit ihrem Jeep heranpreschen, sobald man dem rostigen Zaun zu nahe kommt. Die uns misstrauisch ausfragen und dann wegschicken, aber uns noch lange nachschauen und in ihre Funkgeräte sprechen.
Plötzlich zerreißen Donnerschläge die Idylle, gefolgt von einem Zischen, als würde etwas durch die Luft schießen. Unwillkürlich ziehen wir die Köpfe ein. »Panzerkanonen«, sagt Lee trocken. »Sie machen wieder Manöver auf unserer Seite. Das machen sie immer, wenn die Situation angespannt ist.« Inzwischen kann er am Kanonendonner sogar das Kaliber der Geschosse erkennen, mit denen Südkoreas Panzer schießen. Nicht dass er stolz darauf wäre. Er weiß es eben, so wie er auch um die Wirkung von Sesamblättern weiß. Es ist Teil seines Alltags, Teil seines Lebens im Schatten der Grenze zwischen Nord- und Südkorea.
Manchmal bringt Lee seinen Vater in die Nähe des Zauns, und sie blicken zusammen hinüber in die Demilitarisierte Zone, den vier Kilometer breiten Grenzstreifen, der Nord- und Südkorea entlang des achtunddreißigsten Breitengrads trennt. Weil kaum jemand in diese Zone darf, hat die Natur sie sich zurückgeholt.
Der Stacheldraht, die Reisfelder, die Militärpolizisten – das ist Lees Welt, seit er denken kann. Sein Vater ist während des Koreakriegs aus dem Norden geflohen. Er stammt aus Cholsan: grüne Hügel, Eichen- und Pinienwälder, ein Bauernhof, am Horizont das Gelbe Meer. Lees Vater hat den Verlust seiner Heimat nie verkraftet. Er wollte deshalb so nah wie möglich am Norden leben, auch jetzt noch, mit über fünfundneunzig Jahren, da er kaum noch darauf hoffen kann, sein altes Zuhause jemals wiederzusehen. Lee hat das nie recht verstanden. Er hasst die Trennung und den Kanonendonner und würde lieber woanders wohnen. In Seoul oder noch lieber in Kanada oder Frankreich. »Irgendwo jedenfalls«, sagt er und blickt Richtung Grenzzaun, »wo man ganz entspannt leben kann. Ohne solche Sorgen und Ängste.«
Manchmal bringt Lee seinen Vater in die Nähe des Zauns, und sie blicken zusammen hinüber in die Demilitarisierte Zone, den vier Kilometer breiten Grenzstreifen, der Nord- und Südkorea entlang des achtunddreißigsten Breitengrads trennt. Weil kaum jemand in diese Zone darf, hat die Natur sie sich zurückgeholt. Am Horizont sind grüne Hügel wie in Cholsan. Manchmal steigen Reiher auf vom Flussbett des Imjin. Hinter den Hügeln liegt Nordkorea. »Mein Vater weint dann immer«, sagt Lee und schweigt einen langen Moment, in dem sich seine Hand um ein Zaunstück ballt. »Und ich spüre seinen Schmerz.«
Man braucht nicht viel Vorstellungskraft, um diesen Schmerz nachzuempfinden. Es gibt Abschnitte an dieser Grenze, die vollbehangen sind mit bunten, schmalen Bändern, auf denen Grüße an die unerreichbar entfernten Verwandten jenseits des Zauns stehen. Zu Chuseok, dem Erntedankfest, bringen die Südkoreaner Essen mit und stellen es am Zaun ab, als könnten sie so zumindest in Gedanken ein gemeinsames Mahl mit ihren Verwandten im Norden einnehmen. Oder die Gräber der Familie besuchen. Es ist ein trauriger Anblick, wenn sie die Teller abstellen, sich verbeugen wie zum Gruß. »An Chuseok ist es besonders schlimm«, sagt Lee.
»Dann sind die Älteren sehr traurig.« Dann stehen sie am Zaun und schauen reglos hinüber, als könnte ihr Blick bis dahin reichen, wo der andere Teil ihrer Familien lebt. Während der deutschen Teilung konnte man zumindest vom Westen aus den Osten besuchen und einige aus dem Osten auch den Westen. Es gab eine Art Grenzverkehr über den innerdeutschen Todesstreifen hinweg. In Korea ist das anders, die Teilung ist umfassend und unnachsichtig. Dort war es schon eine große Sache, als im März 2001 in der Demilitarisierten Zone Briefe von Familien ausgetauscht wurden. Oder dass getrennte Familien sich treffen konnten. Da standen sie sich dann gegenüber, nachdem sie sich Jahrzehnte nicht gesehen hatten, und konnten den Moment kaum fassen. Die einen lachten, andere weinten hemmungslos, wieder andere waren wie erstarrt und unter Schock, weil sie mit dem Übermaß an Gefühlen nicht zurechtkamen. Das Brutale an diesen Begegnungen war, dass sie nur kurz dauerten. Dann musste jeder wieder zurück und wusste nicht, ob und wann man sich wiedersehen würde. Koreas Teilung zerreißt Familien, und vielen zerreißt sie das Herz.
»Beim Kampf der Wale wird die Garnele zu Tode gequetscht«, sagt ein altes koreanisches Sprichwort. Man stutzt zunächst ein bisschen über diesen Blick auf die Welt und die eigene Geschichte. Korea, eine Garnele? Und wer sind dann die Wale? China ganz sicher jedenfalls. Das Joseon-Königreich, so selbstbewusst und eigenständig es war, zollte dem chinesischen Kaiser jährlich Tribut. Dort der Kaiser, hier ein König. Das machte den Unterschied schon deutlich. Ende des 19. Jahrhunderts gewann das immer mächtiger werdende Kaiserreich Japan Einfluss in Korea. Oder vielleicht sollte man besser sagen, Japan übernahm Schritt für Schritt die Herrschaft in Korea. Das Königreich Joseon war am Ende, und zwischen 1910 und 1945 war Korea formal eine Kolonie Japans. Für Korea war das eine traumatische Zeit, weil die Kolonialmacht eine brutale Japanisierung durchzusetzen versuchte: Koreanische Paläste wurden zerstört, Koreanisch durfte vielerorts nicht mehr gesprochen werden, selbst koreanische Familiennamen mussten zeitweise durch japanische ersetzt werden. Während des Zweiten Weltkriegs mussten Koreaner zur Zwangsarbeit in japanische Fabriken. Zehntausende Koreanerinnen wurden von der japanischen Armee als sogenannte Trostfrauen rekrutiert, was in Wahrheit nichts anderes bedeutete als Zwangsprostitution. Für Japan war Korea eine Art Brückenkopf für eine Eroberung Chinas, mehr nicht. Korea zwischen den beiden Walen China und Japan. Das war die Lage zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Man braucht nicht viel Vorstellungskraft, um diesen Schmerz nachzuempfinden. Es gibt Abschnitte an dieser Grenze, die vollbehangen sind mit bunten, schmalen Bändern, auf denen Grüße an die unerreichbar entfernten Verwandten jenseits des Zauns stehen.
Aber das änderte sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Kapitulation Japans im August 1945. Die Rote Armee rückte von Norden in Korea ein, etwas später folgten von Süden die US-Truppen. Ähnlich wie in Deutschland wurde Korea in Besatzungszonen geteilt, in diesem Fall waren es zwei: Die eine im Norden unterstand der Sowjetunion, die andere im Süden den USA. Die Trennung verlief in etwa entlang des achtunddreißigsten Breitengrads, der auch heute Nord- und Südkorea teilt. Wieder zwei Wale also, aber der Plan war zunächst, dass die Trennung nur vorübergehend sei und Korea bald wiedervereinigt werde. Nur konnten sich die Sowjetunion und die USA nicht darauf einigen, wie das geschehen sollte. Die Wale kämpften, es war Kalter Krieg. Und so gab es, um im Bild zu bleiben, bald zwei Garnelen.
Der Mann der Sowjetunion war Kim Il-sung, antijapanischer Guerillakämpfer und Kommunist, der in der Mandschurei gegen Japan gekämpft hatte und gerade erst nach Korea zurückgekehrt war. Im Süden setzten die USA auf Rhee Syngman, ein erbitterter Antikommunist, der während der japanischen Besatzungszeit Koreas lange Zeit in den USA gelebt hatte. Im August 1948 wurde im Süden die Republik Korea ausgerufen, mit Rhee Syngman als erstem Präsidenten, einen Monat später im Norden die Demokratische Volksrepublik Korea, mit Kim Il-sung an der Spitze. Die Sowjetunion erklärte kurz darauf, Kims Regierung beanspruche die Souveränität über beide Teile Koreas, während die Vereinten Nationen umgekehrt nur die Regierung des Südens als legitime Vertretung der beiden Koreas akzeptierte. Demokratien waren beide Staaten nicht. Kim Il-sung etablierte im Norden eine Volksrepublik nach sowjetischem Modell, Rhee im Süden eine autokratische Republik unter seiner Führung. Die Überwindung der Teilung war ein zentrales politisches Ziel im Norden wie im Süden, allerdings jeweils unter der eigenen Führung und auf der Grundlage des eigenen politischen Systems. Das war die Sackgasse, die im Grunde bis heute besteht.
Kurz nach der doppelten Staatsgründung im Norden und Süden Koreas zogen die Sowjetunion und die USA ihre Truppen von der koreanischen Halbinsel ab. Und es erschien ein dritter Wal. Oder besser: Er tauchte wieder auf. Chinas Rote Armee hatte 1949 den blutigen Bürgerkrieg gegen die Kuomintang gewonnen, Mao Zedong und Chinas Kommunistische Partei waren die neuen Herrscher in Peking. Aber an Chinas Blick auf Korea hatte sich wenig geändert. Mao hatte keine Einwände gegen Kim Il-sungs Plan zur gewaltsamen Vereinigung der beiden Koreas. Mao glaubte, die Amerikaner würden, »wegen eines so kleinen Territoriums keinen dritten Weltkrieg riskieren«. Schon zuvor hatte Kim Il-sung von Stalin die Zustimmung zum Krieg gegen den Süden erhalten. In einem Telegramm an Mao ließ Stalin wenige Wochen vor Kriegsbeginn ausrichten, man stimme dem Vorschlag der Koreaner zu, bei der Wiedervereinigung nun voranzugehen.
Kim Il-sung glaubte an einen einfachen, schnellen Sieg. Die Sowjetunion war bereit, Waffen, Munition und technische Ausrüstung zu liefern, die Angriffspläne waren mit Moskau und Peking abgesprochen. Aber er täuschte sich. Nach schnellen Erfolgen, und nachdem Nordkorea schon fast die gesamte koreanische Halbinsel erobert hatte, griffen die USA mit einem Mandat der Vereinten Nationen in den Krieg ein. Unter dem Kommando von US -General Douglas MacArthur landeten amerikanische Truppen bei Incheon, in der Nähe von Seoul, und drängten die Nordkoreaner hinter den achtunddreißigsten Breitengrad zurück, womit eigentlich der Status quo wiederhergestellt war. Aber in Washington galt inzwischen die Strategie des »rollback«, also den kommunistischen Einfluss, wo es ging, zurückzudrängen. US-Präsident Harry Truman entschied, dass die Truppen weiter Richtung Norden marschieren sollten. Dies führte zum Kriegseintritt Chinas, das Nordkorea mit Hunderttausenden angeblich freiwilligen chinesischen Kämpfern half. Die Sowjetunion mischte sich zwar nicht offen in die Kämpfe ein, unterstützte den Norden aber nach Kräften. Viele sahen es damals als einen Stellvertreterkrieg. In Deutschland kam es zu Panikkäufen, weil die Menschen einen dritten Weltkrieg befürchteten.
Da standen sie sich dann gegenüber, nachdem sie sich Jahrzehnte nicht gesehen hatten, und konnten den Moment kaum fassen. Die einen lachten, andere weinten hemmungslos, wieder andere waren wie erstarrt und unter Schock, weil sie mit dem Übermaß an Gefühlen nicht zurechtkamen.
Der Kriegseintritt Chinas brachte die US -Truppen in schwere Bedrängnis. In dieser Situation verlangte MacArthur den Einsatz von vierunddreißig Atombomben gegen Ziele in Korea, der Mandschurei und anderen Regionen Chinas. Es hätte die Ausweitung des Koreakriegs auf China bedeutet, aus einem konventionellen wäre ein nuklearer Krieg geworden. MacArthur konnte sich damit nicht durchsetzen. Ein Krieg gegen China sei »der falsche Krieg, am falschen Ort, zur falschen Zeit, gegen den falschen Feind«, befand der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs in Washington, General Omar Bradley. MacArthur wurde abgesetzt. Aber seine Idee entwickelte ihre eigene Wirkung. Die nukleare Drohung ist auf der koreanischen Halbinsel jedenfalls nichts, was die Kims im Norden erst erfunden hätten. Das haben sie sich eher von den USA abgeschaut.
Die Bilanz des Kriegs war fürchterlich. Die Angaben zu den Zahlen der Toten schwanken stark, weil bis heute insbesondere nicht klar ist, wie viele Zivilisten starben. Vermutlich fielen insgesamt rund drei Millionen Koreaner, zwei Drittel davon im Norden. Westliche Quellen schätzen, dass über 400 000 chinesische Kämpfer getötet wurden. 37 000 Soldaten der UN-Truppen starben, die meisten von ihnen Amerikaner. Die amerikanische Luftwaffe hatte die Städte im Norden in Schutt und Asche gelegt. Korea war eine Ruinenlandschaft und ein tief gespaltenes Land. Denn auch unter den Koreanern hatte es grauenhafte Kriegsverbrechen gegeben, die bis heute nicht aufgearbeitet wurden.
Der Text ist ein Auszug aus dem Buch „Der Wahnsinn und die Bombe“.
Das Buch
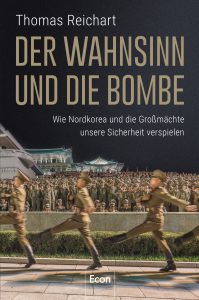 Ein abgeschottetes Land, ein brutaler Diktator, Atombombentests und massive Drohungen: Thomas Reichart, ZDF-Studioleiter Ostasien, war mit seinem Team in den letzten drei Jahren mehrmals in Nordkorea. Er konnte dort Gespräche führen, die tiefen Einblick geben in die Machtstrukturen und das Innenleben dieses Landes. Er reiste nach Pjöngjang, an die streng bewachten Grenzen Nordkoreas, in die Machtzentren der Nachbarn und Gegner und zu den Militärstützpunkten der USA in der Region. In Seoul sprach er exklusiv mit dem höchstrangigen Überläufer, er traf chinesische Schmuggler, die illegalen Handel mit Nordkorea betreiben, und recherchierte in Macao die Hintergründe zum Brudermord. Außerdem wertete er Geheimdienstberichte, Statistiken und Studien zu Nordkorea und der asiatischen Region aus. Die spannenden Ergebnisse seiner investigativen Recherchen machen deutlich, wie groß die Bedrohung durch eine nukleare Katastrophe ist.
Ein abgeschottetes Land, ein brutaler Diktator, Atombombentests und massive Drohungen: Thomas Reichart, ZDF-Studioleiter Ostasien, war mit seinem Team in den letzten drei Jahren mehrmals in Nordkorea. Er konnte dort Gespräche führen, die tiefen Einblick geben in die Machtstrukturen und das Innenleben dieses Landes. Er reiste nach Pjöngjang, an die streng bewachten Grenzen Nordkoreas, in die Machtzentren der Nachbarn und Gegner und zu den Militärstützpunkten der USA in der Region. In Seoul sprach er exklusiv mit dem höchstrangigen Überläufer, er traf chinesische Schmuggler, die illegalen Handel mit Nordkorea betreiben, und recherchierte in Macao die Hintergründe zum Brudermord. Außerdem wertete er Geheimdienstberichte, Statistiken und Studien zu Nordkorea und der asiatischen Region aus. Die spannenden Ergebnisse seiner investigativen Recherchen machen deutlich, wie groß die Bedrohung durch eine nukleare Katastrophe ist.
„Der Wahnsinn und die Bombe“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage.

