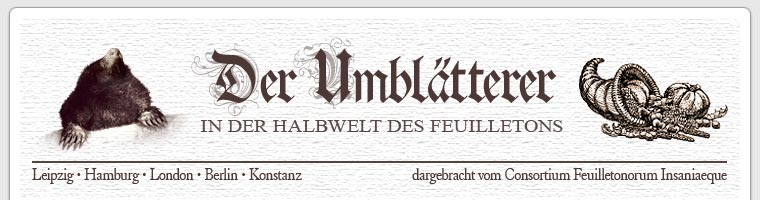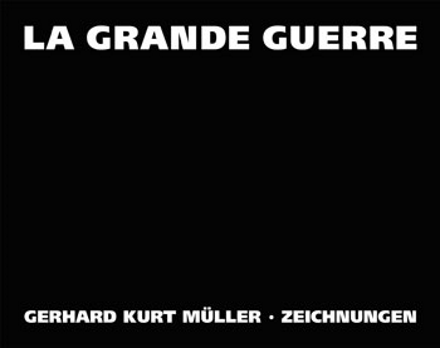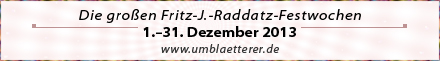»Spiegel« lesen in Detroit
Detroit, 29. Dezember 2015, 23:04 | von Dique
Vor vielen Jahren gab es den »Spiegel« erst am Montagmorgen zu kaufen. Irgendwann gab es ihn dann an Bahnhofskiosken schon am Sonntagabend, jedoch erst ab genau 20 Uhr. Deshalb konnte man manchmal sonntags um 19:45 Uhr Reisende und/oder Wahnsinnige (im Zweifelsfall sich selbst) dabei beobachten, wie sie um eine Ausgabe bettelten.
Denn meist lagen die Stapel schon hinter dem Verkaufspersonal bereit, die aber vor 20:00:00 Uhr noch kein Exemplar aushändigen durften. »Mein Zug fährt um 19:55 Uhr«, hieß es dann, »und ich würde auf der Fahrt so gern den neuen ›Spiegel‹ lesen!« Trotz dieser mittleren bis hohen Beweggründe waren diese Versuche zwar aussichtslos, aber zukunftsträchtig!
Denn in ausgesuchten Städten gab es den »Spiegel« dann bald schon am Sonntag um die Mittagszeit. Seit Wolfgang Büchners Intermezzo als Chefredakteur haben wir uns nun an den Samstags-»Spiegel« gewöhnt (also die, die ihn noch lesen, hehe). Jemand hat gerade errechnet, dass es bei dem aktuellen Tempo der Vorverlegung nur noch ca. 13,4 Jahre dauert, bis der »Spiegel«, nach Freitag, Donnerstag etc., wieder am Montag erscheint.
Ich erwähne den »Spiegel«, weil ich noch irgendwo vor der Abreise einen gekauft habe und seit ein paar Tagen mit mir herumtrage. Wir sind in einem Toyota Prius unterwegs. Der Prius macht beim Anlassen keinerlei Geräusch und ist das wahrscheinlich kleinste Auto hier in der Detroit Area. Bei »Hertz« am Flughafen habe ich sofort für den Prius votiert, weil Larry David in »Curb« immer einen fährt und damit immer so hochzufrieden ist. Später fragen uns tatsächlich noch Einheimische über unsere mögliche Verbindung nach L.A.
Nun, der »Spiegel« ist voller spannender Artikel und scheint mal wieder richtig gut zu sein, fristet aber ein einsames Dasein im Handschuhfach. Im Flieger las ich nur das Editorial an, sah dann einen Film und schlief ein. Ich hab ihn aber immer dabei, auch jetzt, wenn ich ins Detroit Institute of Arts gehe.
Das DIA hat eine Spitzensammlung, die wohl kaum jemand zu Gesicht bekommt. Um das majestätische, weiß strahlende Gebäude herum ist es dystopisch leer, man sieht niemanden auf der Straße an diesem Samstagnachmittag (dem Tag, an dem in Deutschland gerade der neue »Spiegel« erscheinen muss).
Jegliche Geschäftstätigkeit und überhaupt jedwede Bewegung liegt brach. Ab und an sieht man dann doch mal einen Penner mit Hoodiekapuze über dem Kopf und in einen dicken Parka gehüllt umherschlurfen, und mir friert beim Aussteigen aus dem Prius fast ein Ohr ab, so eisig pfeift der Wind. Eine verschlossene Chase Manhattan Bank mit pompösem Art-Déco-Portico schmort still vor sich hin, die Woodward Avenue, die von Detroit weit nach Michigan hineinstößt und am Museum vorbeiführt, ist aufgerissen und überall sind Absperrungen, durch die ich mich schlängeln muss, nur in der Ferne sieht man das berühmte Renaissance Center in den Himmel ragen, die einzige Stelle in Downtown, die noch atmet.
Die Sammlung des DIA wurde 2013 mal auf 900 Millionen USD unterschätzt, denn man überlegte tatsächlich, die Sammlung zu verkaufen, nachdem Detroit in die Pleite geschlittert war. Das Museum hat z. B. einen der besten Bauern-Brueghels, den »Hochzeitstanz«, allein der Wert dieses Bildes liegt bei ca. 900 Millionen oder so. Außerdem hat es einen Caravaggio, den ich gerade bestaune und von dem ich mir gerade vorstelle, dass er echt ist.
Es ist eines der Gemälde, mit dem von Caravaggio oft porträtierten Modell, Fillide Melandroni. Fillide fand den Weg in Caravaggios Pinsel auch bei der unglaublichen »Judith mit dem Kopf des Holofernes«, die heute in Rom im Palazzo Barberini hängt. Vielleicht war es sogar sie, für die Caravaggio 1606 in Rom Ranuccio Tomassoni ermordete, aber wer weiß das schon so genau, Insinuationen im Stil eines Kunstkrimis von Dan Brown oder Helmut Krausser.
Aber das große Highlight im DIA ist der Diego Rivera Court, in dem man von den berüüühmten »Detroit Industry Murals« umringt wird. Oben, unten, monumental und überall, Rivera. Das ist wie mit der Suppe vom »Seinfeld«-Soup-Nazi, nach dem ersten Kosten muss man sich zunächst mal kurz hinsetzen. Wie soll man das beschreiben, ein Satz fällt mir ein, den Frau Prof. Dr. Daniela Hammer-Tugendhat sehr häufig verwendet: »Das muss man wirklich sehen, das kann man sich sonst nicht vorstellen«, oder so ähnlich, zum Beispiel auch irgendwo in der Vorlesung zur »französischen Kathedralkunst der Gotik«, aber auch in der Folge zu Caravaggio und Velázquez und eben auch sonst noch ein paarmal.
Ok, nach dem Museum bin ich noch mit meinem alten Freund Tropical-Heat-Barthel verabredet, den es vor ein paar Jahren überraschenderweise hierher verschlagen hat. Ich hole ihn zu Hause ab und er kann wie alle anderen auch nicht fassen, dass ich hier mit einem Prius rumfahre. Was machen wir nun, wir fahren in die nächstgelegene Mall und gehen zu Starbucks. Als wir wieder draußen auf dem Parkplatz sind, passiert etwas, fast eine Art Zäsur. Wir laufen nämlich zum Prius, der mittlerweile zwischen zwei monströsen Ford F-150 SuperCrew Cabs steht, bei denen er ganz locker auf die Ladefläche passen würde.
Und nun: Wir steigen ein, ich will Tropical-Heat-Barthel zurück zu seiner Familie fahren und dort vielleicht noch ein bisschen mit allen reden, eine Einladung zum Abendessen wurde bereits ausgesprochen. Wir sitzen, ich will gerade die Fahrertür ins Auto ziehen – da fällt mir ein, dass ich den »Spiegel« im Starbucks vergessen habe.
Und was jetzt so in meinem Kopf losgeht: 10 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre »Spiegel«-Lektüre, Augstein und Aust, nicht namentlich gekennzeichnete Riesenartikel, die Achterbahnfahrt des Kulturteils, diese komische Leserbriefauswahl immer, der ganz und gar behämmerte »Hohlspiegel« usw. usw., all das kam mir plötzlich so unfassbar vor. Ich muss natürlich zurück in die Mall und den »Spiegel« holen, das Papier, das Objekt, heute später am Abend oder morgen oder in zwei Wochen würde ich diese glänzenden Seiten in Händen halten und »Spiegel« lesen, unterwegs, in der Bahn, im Café, im großen Irgendwo. Aber man kann die Artikel ja auch im Netz lesen, irgendjemand schickt auch immer mal einen PDF-Auszug vorbei usw., und will ich jetzt der Typ sein, der in diese dann ja doch irgendwie schreckliche Mall zurück geht, um einen liegengelassenen Print-»Spiegel« zu holen?
Hin- und hergerissen, es ist wirklich auch kognitiv anstrengend, ich forme schon Sätze, »äh, ich muss leider noch mal kurz in den Starbucks«, was insgesamt locker viereinhalb Minuten dauern würde, und der Freund hier allein im Auto, eingequetscht zwischen zwei Ford-Supertankern, die ihm das Licht rauben, vielleicht insgesamt trotzdem kein Problem, keine große Sache, viereinhalb Minuten, aber so ein sinnloses Detachment kann ja auch einen ganzen Abend verderben. Print-»Spiegel«! Wohin ziehst du mich, / Fülle meines Herzens, / Print-»Spiegel«! / Welche Wälder, welche Klüfte / Durchstreif ich mit fremdem Mut! Eine Horaz-Nachdichtung von Novalis, so was fällt mir jetzt ein, und ich weiß nicht, was ich tun soll, ich muss dich holen gehen, ich muss, natürlich, und ich werde.