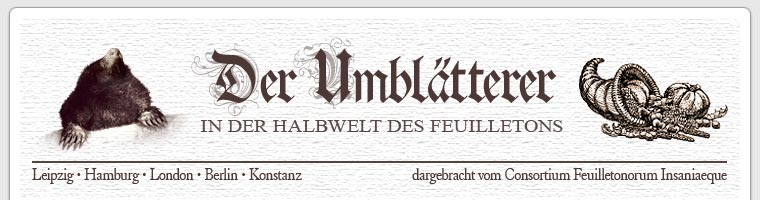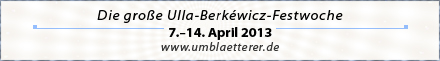100-Seiten-Bücher – Teil 81
John Kenneth Galbraith: »Eine kurze Geschichte der Spekulation« (1990)
Barcelona, 9. Oktober 2013, 10:58 | von Dique
John Kenneth Galbraith ist ein Vielschreiber der ökonomischen Literatur, eine Art Johannes Mario Simmel seines Genres. »The Great Crash, 1929«, der ganz nüchterne Account der größten Krise aller Zeiten, ist natürlich sein größter Hit. Der große Crash spielt auch in (Originaltitel:) »A Short History of Financial Euphoria« eine Rolle, aber diese kurze Geschichte ist nicht der kleine Bruder des großen Klassikers desselben Autors, sondern so was wie der kleine Stiefenkel von »Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds« von Charles Mackay.
Charles Mackay veröffentlichte seinen Ziegelstein bereits 1841 und reißt neben der Tulipomanie und der South Sea Bubble auch gleich mal die Geschichte der Alchemie und Scharlatanerie mit ab. Ein irres Buch, ein schönes Buch, aber eben ein Ziegelstein. Galbraith tanzt mindestens genauso elegant durch die Geschichte der Spekulation, aber leichter und flockiger und mit viel weniger Schnörkel und Detail. Ab und an klaut er sich auch mal eine Anekdote von Mackay. Zum Beispiel die mittlerweile berühmte mit dem Seemann, der nach Holland kommt und einen reichen Händler in seinem Warenhaus aufsucht, um ihm das Eintreffen seiner Waren zu melden.
Der Händler ist natürlich, wie quasi jeder im Holland des Tulpenwahns, ein Tulpenspekulant. Zwischen Samt und Seide im Warenhaus sieht der Seemann, der gern Zwiebel isst, auch etwas liegen, das er für eine solche hält, und lässt sie in seiner Tasche verschwinden. Kaum hat er das Lagerhaus verlassen, bemerkt der Händler das Fehlen der Zwiebel. Es handelt sich um eine Semper Augustus, die teuerste Tulpenart. Rasend vor Wut durchforstet er das ganze Lager und kann die Semper Augustus nicht finden.
Da erinnert er sich an den Besuch des Seemanns. Zusammen mit seinen Angestellten stürmt er hinunter zum Quai. Dort sehen sie den Seemann sitzen, er hängt zufrieden in einer großen Rolle Seil und verzehrt genüsslich das letzte Stück seiner ›Zwiebel‹. Von dem Wert dieser Semper Augustus hätte man ein ganzes Jahr lang die Besatzung des Schiffes ernähren können. Als ich das las, saß ich gerade im Bordrestaurant bei Königsberger Klopsen mit Butterreis und hätte mir auch fast eine rohe Zwiebel dazu bestellt.
Man kann natürlich für alle Hundertseiter sagen, dass sie sich bestens auf einer Bahnfahrt erledigen lassen. Man beginnt dann Reise und Buch gleichzeitig und schließt beide auch zur selben Zeit ab. Der letzte Schrei zur Geschichte der Spekulation ist übrigens »Devil Take the Hindmost: A History of Financial Speculation« von Edward Chancellor. Doch dieses Buch ist dann auch wieder etwas umfangreicher, wenn auch noch kein Ziegelstein. Trotzdem muss man dann schon eine längere Zugreise wagen, Hamburg–München und zurück und das ganze zwei Mal, zum Beispiel.
John Kenneth Galbraith: Finanzgenies. Eine kurze Geschichte der Spekulation. Aus dem Amerikanischen von Wolfgang Rhiel. Frankfurt/M.: Eichborn 1992.
John Kenneth Galbraith: Eine kurze Geschichte der Spekulation. Aus dem Amerikanischen von Wolfgang Rhiel. Frankfurt/M.: Eichborn 2010.
(Einführung ins 100-Seiten-Projekt hier. Übersicht über alle Bände hier.)