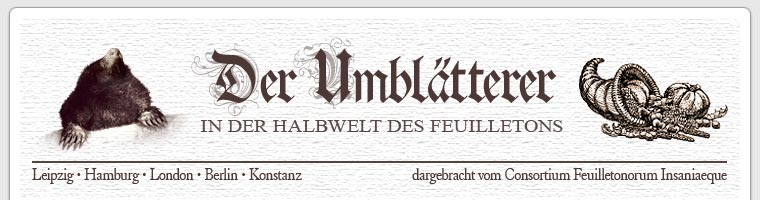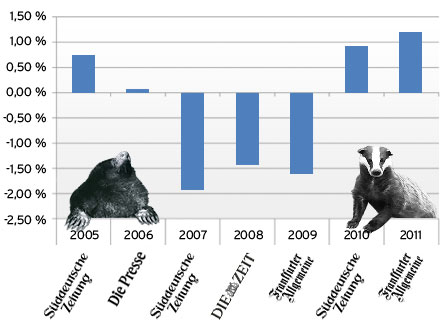Und hier nun der Schlussstein unserer Richard-Deiss-Berichterstattung. Schon im Umfeld unseres Interviews zu den 100-Seiten-Büchern hatte er bekanntgegeben, dass er demnächst offiziell seinen 1000. Buchladen besuchen werde, und zwar »25books« in Berlin. Doch viele Hindernisse wurden dem Humboldt unter den Buchladenforschern in den Weg gelegt. Nach vollbrachter Tat bekamen wir diese Mail, in der die abenteuerlichen Ereignisse spannend wiedergegeben werden:
Datum: 24. Mai 2011
Von: Richard Deiss
Endlich habe ich es geschafft, der 1000. Buchladen ist besucht, und ab jetzt werde ich mir nur noch ausgewählte Läden vornehmen und jedenfalls keinen Buchladenmarathon mehr veranstalten. Der letzte war denn auch noch ziemlich aufreibend:
Am Abend hatte ich den Flug zur Dienstreise nach Berlin verpasst und musste eine frühe Morgenmaschine nehmen. Im Flugzeug schlief ich ein und kam nicht mehr zu meinem Plan, der Stewardess eines dieser Handzählgeräte, mit welchem das Bordpersonal die Passagiere durchzählt, abzuschwatzen und zu einem Buchladometer umzuwidmen, mit dem ich dann den Besuch des 1000. Ladens feststellen wollte.
In Berlin verlor ich dann nach der Sitzung wertvolle Zeit mit der Suche eines Handzählgerätes, kein Laden hatte sowas vorrätig. Schon lange hatte ich eines im Internet bestellen wollen, dass ich das nicht getan hatte, rächte sich jetzt.
Endlich wurde ich bei Conrad Electronic fündig, der hatte zwei Handzählgeräte, aber das, welches ich dann kaufte, sollte mir viel Ärger bereiten, denn immer wieder kam man unabsichtlich auf den hervorstehenden Nullstellungsknopf, und immer wieder musste ich fast tausendmal klicken, um den richtigen Zählerstand zu generieren. Wenn man zu schnell klickte, verkanteten sich die Zahlen zwischen 1000 und 1001 und man musste wieder von vorn beginnen. Insgesamt sollte ich dann im Laufe meiner Tour fast zehnmal die fast tausend Buchläden durchgedrückt haben.
Es war bereits nach 18 Uhr, als es bei einem Zählerstand von 980 mit der Besichtigung der letzten 20 Läden losgehen konnte. Doch den Laden »Motto« in der Skalitzer Straße fand ich nicht. In der Oranienstraße konnte ich dann wenigstens noch drei Buchläden besuchen. Eigentlich wollte ich in Berlin zehn Buchläden sehen, doch bei meiner Abreise nach Dresden war der Stand erst bei 985.
Von Dresden ging es den nächsten Morgen nach Freiberg, wo ich vier Buchläden besuchte, leider hatte der fünfte ausnahmsweise bereits um 12 Uhr geschlossen, so dass ich immer noch nicht einmal bei 990 lag. In Dresden besichtigte ich dann vier weitere Läden, doch bei einem Zählerstand von 993 machten in der Neustadt schon die meisten Buchläden dicht. Ich beschloss, nach Prag zu reisen, denn dort haben manche Buchläden auch am Sonntag auf.
Nachdem ich dort ein Hotel reserviert hatte, kam ich auf dem Weg zum Bahnhof doch noch an einigen Buchläden vorbei, darunter Walther König im Residenzschloss, und die Zahl war auf 998 gestiegen, fast war die Pragreise überflüssig geworden. In Prag angekommen hatte der Globe Bookstore noch um 23 Uhr geöffnet, und beruhigenderweise war die Zahl von 999 Buchläden erreicht. Doch am nächsten Morgen waren alle Läden auf meiner Liste entweder sonntags geschlossen, hatten noch nicht auf oder existierten gar nicht mehr.
Ich beschloss, frühzeitig wieder nach Berlin zurückzureisen. Dort waren aber zwei Läden, die ich noch sehen wollte, sonntags ebenfalls nicht geöffnet, und meine letzte Hoffnung war »Berlin Story«, der Berlinbuchladen, der wegen Insolvenz von Unter den Linden in eine Parallelstraße gezogen war. Durch diesen Umzug konnte ich ihn als weiteren Buchladen rechnen, und er hat sonntags bis 19 Uhr auf.
Kurz vor sieben kam ich in der Mittelstraße an, doch ein Schild zeigte zu meinem Schrecken, dass der Buchladen an seinen Ursprungsort Unter den Linden zurückgezogen war, ich konnte ihn also nicht als neuen Buchladen ansehen. Wo sollte ich jetzt den 1000. Buchladen hernehmen? Ich beschloss, doch noch zu »25books«, der eigentlich am Sonntag zu hat, zu fahren und die Besichtigung von außen als halben besuchten Buchladen zu zählen und den veränderten »Berlin Story« als weiteren halben.
Überraschenderweise war bei »25books« die Tür auf und ich konnte hineingehen. Ich erzählte dem Inhaber von meinem Anliegen, und er war sogar bereit, mir das Wort ›Buchladometer‹ auszudrucken, damit ich es auf mein Handzählgerät aufkleben und eine entsprechende Aufnahme machen konnte. Leider war sein Pritt-Stift ausgetrocknet und der Text musste mit Spucke befestigt werden und wurde leicht wellig.
Schon wieder war der Buchladometer durch den Rückstellungsknopf auf Null, und ich musste wieder 1000 Mal drücken, bevor ich das Foto machen konnte. Ich kaufte dem Inhaber das Buch »802 Photobooks« ab, und er zeigte mir Poster, die den Inhalt verschiedener Kurzbücher (»Das kommunistische Manifest«, Homers »Ilias« etc.) in winziger Schrift auf einem einzigen Blatt abgedruckt hatten, was ja irgendwie zu eurem Projekt mit den 100-Seiten-Büchern passt. So hatte alles noch ein passendes Happy End genommen mit »25books« als 1000. Buchladen, ich konnte die Phase der Buchladenmarathons endlich abschließen und die Blasen an meinen Füßen auskurieren.
Beste Grüße,
Richard