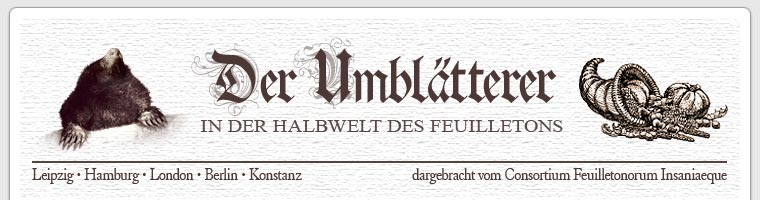Das Slawistik-Department hatte eingeladen, also nahmen wir den Direktflug von Moskau nach New York, dann das Überlandtaxi nach Princeton, zwei Stunden, und schon ist man da. New Jersey ist einfach nice, das sagten wir immer wieder, während der Taxista uns links und rechts auf landschaftliche Höhepunkte hinwies, und Princeton selbst erst!
Abends nach unserer Show wurden wir zum gemeinsamen Dinner eingeladen (ins »Mistral«), und zunächst wurden Food-Allergien diskutiert, von denen ich die meisten kannte, einige schienen mir aber neu und interessant zu sein.
TV-Serien wurden auch kurz angeschnitten, und da es ein Slawisten-Dinner war, ging es nicht um »Game of Thrones«, das sich ja gerade sang- und klanglos von den Bildschirmen verabschiedet hatte. Sondern es ging um »The Romanoffs«. Schnell jedoch war dieser Diskussionsstrang beendet, denn die Serie erschien allen als »too contrived«, und alle kündigten an, sie nie je zu Ende sehen zu wollen.
Ein weiterer Gesprächsfaden – Slawisten sind ja auch Linguisten – handelte vom englischen Verb ›to trump‹ (übertrumpfen, übertreffen). Einer der Mitspeisenden meinte beobachtet zu haben, dass einige Leute (er selbst auch) das Verbum ›to trump‹ aus Protest mittlerweile vermieden, auch in Kontexten, wo es angebracht und eigentlich unausweichlich scheint. Eine Kollegin schlug vor, dies empirisch zu überprüfen, und ein Plan war gefasst, und es war überhaupt insgesamt ein schönes Dinner, das mit vielen lauteren Wünschen ausklang.
Anderntags kamen wir am frühen Nachmittag unten vom Tenniscourt und waren guter Dinge, als uns ein unvermittelt einsetzender Platzregen ins nächstgelegene Gebäude zwang; es handelte sich zufällig um das Princeton Art Museum. Wir stellten die Blumenvasen im Self-Service-Garderobenschrank ab und …
Moment, welche Blumenvasen? Ein Sekretär, der auch für unsere Reisekostenabrechnungen zuständig war, hatte uns auf dem Weg nach oben getroffen und gebeten, zwei ellbogengroße Blumenvasen ins Department mitzunehmen. Haben wir dann sofort übernommen, da wir uns gut mit ihm stellen wollten und eh dort vorbeikommen würden.
… betraten die Museumssäle. Wir dankten dem Regen, denn ohne ihn wären wir wahrscheinlich gar nicht hier gelandet, einfach weil es so viele andere Sachen in Princeton zu machen gibt.
Eine nicht ganz fertiggestellte Replika aus Jacques-Louis Davids Studio, »Der Tod des Sokrates« (nach 1787), konnte man sich leider nicht aus der Nähe ansehen. Denn direkt davor steht eine bequeme Kunstbetrachtungscouch, in der sich ein sprichwörtlicher älterer Herr positioniert hatte und diesen Platz nicht räumte, während der gesamten zwei Stunden nicht, die wir im Museum zubrachten, und er verschmolz für uns übrige Museumsbesucher langsam mit dem Bild, vor dem er regungslos saß, was schon auch was hermachte.
Längere Zeit verbrachte ich mit einem historischen Gemälde von Angelika Kauffmann, »Plinius der Jüngere mit seiner Mutter beim Ausbruch des Vesuvs in Misenum« (1785). Das Sujet hatte mich sofort wieder gepackt und ich wanderte die Ebenen und dargestellten Figuren ab, aber irgendwas stimmte nicht, und ich wusste nicht was, bis auf einmal, hä?
Der jüngere Plinius, der in blauem Gewand und mit offenen Sandalen in der Mitte der vorderen Figurengruppe sitzt, die Beine übereinander geschlagen, hat zwei linke Füße! Ein Glitch, der einen sofort zwingt, voller Abscheu den Blick wegzuwenden, um sich dann doch ganz langsam und in verschiedenen Etappen an dieses Phänomen heranzutasten, das ja in der Kunstgeschichte kein seltenes ist, cf. Tischbein.
Der Katalog hat eine Erklärung parat:
»As was noted when the work was first exhibited at London’s Royal Academy in 1786, Pliny has two left feet. The reason for this may be that Kauffmann, then among the most popular artists in Rome, evidently relied on her less-talented husband, Antonio Zucchi, to complete many of her commissions.«
Antonio Zucchi, was hast du getan!
Mit diesem gellenden Ruf verließen wir das Museum, als es sich ausgeregnet hatte, und es war mal wieder Zeit für Dinner in Princeton.
Einige Tage später, wir waren längst wieder zu Hause, schrieb ich eine E-Mail an das Princeton Art Museum. Ich begann damit, meinem Excitement über die Sammlung Ausdruck zu geben und von den schönen Erinnerungen an unseren Besuch zu berichten. Im nächsten Absatz bat ich dann darum, doch bitte mal unverbindlich in der Garderobe nach zwei ellbogengroßen Blumenvasen Ausschau zu halten, denn die hatten wir dort einfach vergessen, und der Sekretär hatte sich tagelang nicht bei uns gemeldet wegen der Abrechnungen. Blumenvasen!