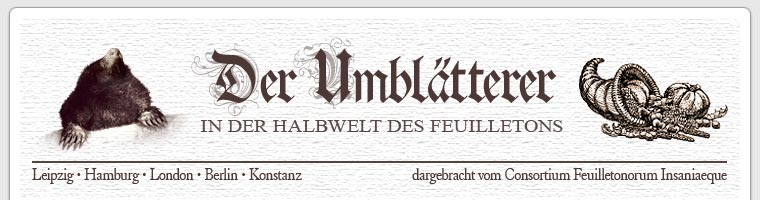Am 24. März 2017 erscheint:
»Abenteuer im Kaffeehaus«
Leipzig, 19. März 2017, 18:45 | von Paco
In ein paar Tagen erscheint als erster Band der Reihe »Schriften des Umblätterers« beim Leipziger Verlag Ille & Riemer:

André Seelmann (Dique)
Abenteuer im Kaffeehaus
Feuilletons aus dem Umblätterer
2007–2015
Mit einem Vorwort von Frank Fischer
Hrsg. von Frank Fischer, Andreas Vogel und Joseph Wälzholz
Im Anhang enthalten ist ein Briefwechsel mit David Woodard
Leipzig · Ille & Riemer · 2017
281 Seiten · 15,– €
ISBN 978-3-95420-018-4
Bestellen: Verlag | lehmanns.de | Amazon
Klappentext
Die wichtigsten Dinge der letzten zehn Jahre: »Spiegel« lesen und »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung«. In Museen gehen, amerikanische TV-Serien schauen, das Gesamtwerk von Leo Perutz überdenken. Zwischendurch immer wieder ins Kaffeehaus, um ein bisschen was davon zu besprechen. Und damit alles schön ungenau bleibt, lieber rasch einen pindarischen Sprung zum nächsten Thema.
André Seelmann, geb. 1971 in Leipzig, war zwischen 2007 und 2015 Korrespondent des Kultur- und Freizeitjournals »Der Umblätterer« und berichtete aus London, Hamburg, Barcelona und São Paulo. Der vorliegende Band »Abenteuer im Kaffeehaus«, der seine Texte aus dieser Zeit versammelt, eröffnet die Reihe »Schriften des Umblätterers«.
Niemand erzählt so vom Feuilleton dieser Jahre wie der »Umblätterer«.
— Florian Kessler
Inhalt
Vorwort: Die Ungenauigkeit von Kaffeehausgesprächen … S. 7–11
Abenteuer im Kaffeehaus … S. 13–276
Anhang: Briefwechsel mit David Woodard … S. 278–281
Leseprobe und Cover
- Leseprobe (12 Seiten; PDF; 152 kB)
enthält Titelseiten, Vorwort und den Text »Spiegel lesen in Detroit« - Umschlagseiten U1 und U4 (1 Doppelseite; PDF; 3,2 MB)
Book-Release-Lesung am 24. März 2017
Falls jemand zur Buchmesse oder einfach so in Leipzig ist und sich die Book-Release-Lesung anschauen möchte: Die findet am Freitag, 24. März, um 20:00 im schönen Kulturcafé Rumpelkammer statt (Dresdner Straße 25, 04103 Leipzig). Weitere Informationen bei Facebook und »Leipzig liest«.