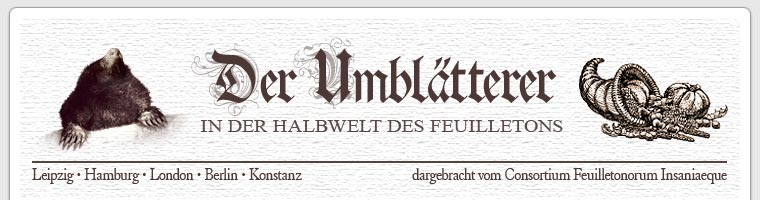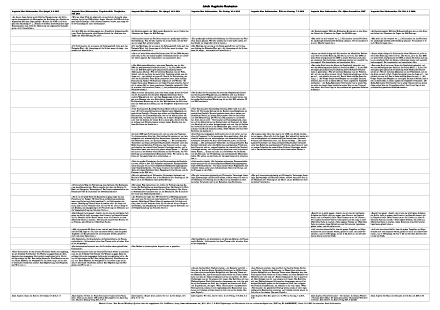Es gab in der »Zeit« mal wieder viel zu lachen, als Ijoma Mangold sich witzigerweise fragte, ob »Der Circle« ein gutes Buch sei. Da war sicherlich einiges los in den Redaktionsräumen und man rieb sich sicherlich auch vor Freude die Hände, dass diese grandiose und so grundsätzliche Frage mal wieder existenziell gestellt werden konnte, denn im Feuilleton stellt sie sich ja immer, wenn man über Romane spricht, aber selten so explizit wie hier. Was für ein Aufmacher!
Und dann natürlich auch dieser geniale Wechsel auf das Mediale, nicht das Formelle, denn ob »Der Circle« ein guter Roman ist, wen interessiert das denn schon, aber ein gutes Buch, das ist ja die Frage des materiellen Konterparts auf Datenträgerebene, das ist genau die Frage, die man an »Der Circle« stellen muss: Taugst du auch als Medium, wenn du über Medien schreibst? Und dann auch noch dieser Twist gleich im ersten Absatz, dass »Der Circle« letztlich »bilderbuchmäßig die klassischen Kriterien« erfülle, denn das Bildliche ist doch in einem Buch ohne Bilder eine mediale Kategorie, die sich so konkret selten an manch andere Bücher stellt.
Schade nur, dass Mangold dann doch so tut, als ginge es darum, ob »Der Circle« ein schlechter Roman ist, denn das Medium interessiert es eigentlich nicht, ob die Figuren platt sind oder das Weltbild manichäisch, nicht mal ein Bilderbuch würde das interessieren, denn das sind absolut keine bilderbuchmäßigen Kriterien. Es ist auch total egal, ob in dem Buch literarische oder intellektuelle Ansprüche genug erfüllt sind, das sind dann doch irgendwie Fragen, die, wie bestimmte Leute immer sagen, ziemlich »inhaltistisch« sind (tolles Wort, btw!).
Also müssen wir uns jetzt selbst die Frage beantworten, ob »Der Circle« ein gutes Buch ist. Ich selber würde sagen: Kommt drauf an. Denn erst mal ist natürlich wichtig, welche Ausgabe man hat. Ich selbst besitze die britische Ausgabe als Taschenbuch von Penguin aus dem Jahr 2014 und muss mich im Folgenden auch auf diese beziehen.
Zunächst ist das Buch sehr handlich, es macht dem Namen Taschenbuch ganz bilderbuchmäßig alle Ehre, denn es passt trotz seiner ca. 500 Seiten ziemlich gut in jede Tasche. Absoluter Pluspunkt. Das Cover ist das bekannte Motiv des Circle, silbern schimmernd aufgedruckt und haptisch abgehoben, genau wie der Buchtitel, dieser in Schwarz auf einem leuchtenden Rot. Gleiches gilt auch für den Buchrücken, den man dann doch im Regal auch eher sieht, sollte man keine Ausstellungsvitrine besitzen, was ich allerdings jedem empfehlen kann.
Der Buchdeckel fühlt sich etwas gummiartig an, was, ganz inhaltistisch, vielleicht ein Augenzwinkern in Richtung Silicon Valley ist. Manko hier: Bei zu viel Transport (ich bin mit dem Buch viel gereist) löst sich die gummiartige Beschichtung leicht ab. Da wäre mehr drin gewesen, gerade für ein Taschenbuch, das zum Transport uneingeschränkt geeignet sein sollte. »Der Circle« fasst sich also auch gut an und man schaut auch gerne länger auf diese tanzenden Farben und Formen. In dieser Hinsicht für meine Begriffe sogar eines der besten Bücher der letzten Jahre. Einziges Minus ist das doch eher dem Colourblocking verschriebene Penguin-Logo in Orange, das nicht so recht zur restlichen Farbgebung passen will.
Schlägt man das Buch auf, merkt man, dass es sich um einen guten Taschenbuchstandard handelt. Die Seiten sind etwas rau und die Tinte verwischt nicht, wie bei vielen amerikanischen Taschenbüchern, wenn man zu lange den Daumen an einer bestimmten Textstelle lässt. Das macht das Buch auch auf die Dauer für die Zukunft relevant, denn auch nachfolgende Generationen werden keine Probleme haben, den Text zu entziffern, sofern sie einigermaßen Englisch können. Und keine Probleme mit den Augen haben. Denn die Schrift ist doch etwas sehr klein geraten, ca. 10pt, schätze ich. Auch hier wäre sicherlich manches mehr drin gewesen, die gebundene Version ist beispielsweise größer gedruckt. Gerade in öffentlichen Transportmitteln ist die Bonsaischrift nicht gerade förderlich, denn hier muss in Bewegung gelesen werden, was das Einhaken in die Zeilen merklich erschwert. Punktabzug an dieser Stelle.
Das scheint den Setzern jedoch auch klar gewesen sein, denn ungewöhnlicherweise ist das Buch im Flattersatz gedruckt, was ich persönlich erst als unmöglich empfunden habe und was dazu führte, dass ich zunächst keine Lust hatte, es zu kaufen und zu lesen. Mich erinnert Flattersatz immer an diese abgerissenen Piratenflaggen und macht mich beim Draufkucken ganz nervös. Allerdings muss ich sagen, dass in der Praxis das Einhaken in die Zeilen dadurch leichter fällt und man beim Lesen selten abrutscht. Ich bin am Ende doch überzeugt, dass das, zumindest bei der gewählten Schriftgröße, doch die richtige Entscheidung war.
Das Buch selbst besteht aus drei Büchern in einem. Gerade das letzte Buch ist nur – mit Titelblatt – fünf Seiten lang, was gerade die Freunde des kurzen Buches sehr befriedigen wird. Man sollte allerdings, wieder auf der inhaltlichen Ebene, erst die anderen beiden Bücher lesen, um die Handlung von »Book III« (schön auch mit den römischen Zahlen, wobei dem Thema auch eine arabische Ziffer gut zu Gesicht gestanden hätte) nachvollziehen zu können. »Book III« hat allerdings auch die beste Handlung und das beste Ende. Kapiteleinteilungen gibt es sonst nicht, allerdings viele Absätze und einige mit Asterisken abgegrenzte Sinnabschnitte, das hält die ganze Sache übersichtlicher, als man meinen würde, und macht das Lesen auch an Tagen mit weniger Muße zu einer guten Option.
Was ich an gerade englischsprachigen Büchern schätze, ist auch die Dialogeinteilung in dramatische Absätze, wo jede Äußerung eine eigene Zeile bekommt. Das liest sich nicht nur wie ein Drehbuch (Film muss unbedingt her, am besten von Duncan Jones oder Sofia Coppola), sondern macht den Text optisch abwechslungsreich, denn gerade dialogue-heavy Texte wie dieser sehen immer eleganter aus als die geblockten Beschreibungsmonologriesen oft zentraleuropäischer Herkunft.
Unterm Strich lässt sich sagen, dass »Der Circle« ein großartiges Buch ist, das besser erscheint, als es auf den ersten Blick aussieht, sich übrigens auch in anderen Ausgaben uneingeschränkt genießen lässt (die deutsche bei KiWi ist auch wirklich toll geworden) und sich in jedem Bücherregal des 21. Jahrhunderts gut macht.