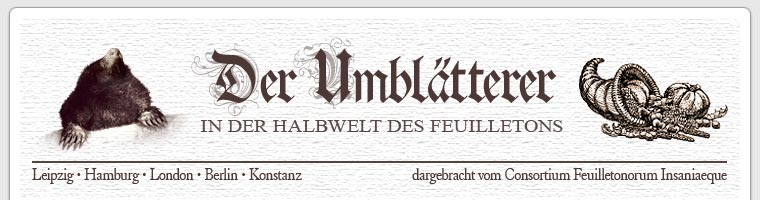Sonntagsausflug mit Vladimir Vladimirovič nach Vladimir. Kaum angekommen, suchen wir den Busbahnhof, um von dort in einem etwas klapprigen Siebzigerjahremodell zum Südrand der Stadt zu fahren. Nach knapp zehn Kilometern auf der Überlandstrasse Ausstieg beim Friedhof Bajguši. Hier liegt Vasilij Vital’evič Šul’gin begraben, der russische Nationalist aus Kiev, der 1917 in einem Eisenbahnwagen bei Pskov die Abdankung des letzten Zaren entgegengenommen hat.
Šul’gin war gut zehn Jahre in der Politik und hat danach 55 Jahre lang Memoiren geschrieben, bis er 1976 eben in dieser Provinzstadt starb, wo ihm die sowjetische Regierung nach der Entlassung aus dem Gefängnis eine Wohnung zugeteilt hatte. Von seinen Memoiren sind über 3000 Seiten publiziert – grad letztes Jahr hat ein russischer Verlag noch mal zwei Bände rausgehauen – und mindestens noch mal so viel liegt unpubliziert als Manuskript in den Archiven.
Der Eingang zum Friedhof ist nirgends zu sehen, aber zum Glück treffen wir einen fröhlichen Datschagänger, der uns durch den Tiefschnee vorausstapft und zu einer Hintertür bringt. Ausserdem hält er uns einen wolfsähnlichen Hund vom Leibe, der uns übergelaunt ankläfft. Rein also in den Friedhof, zwischen Birken und Tannen bis zur Hauptallee, ein Stück abwärts, beim Denkmal der berühmten Lokaljournalistin Inessa Sinjavina nach links und dann den Hügel hoch, wo wir das eingeschneite Marmorkreuz der Šul’gins finden. Kurz die Inschrift vom Schnee befreit, ein paar Erinnerungsfotos und schon sind wir auf dem Rückweg.
Auf dem Weg zur Bushaltestelle ist uns etwas kühl und zum Aufwärmen gebe ich ein paar Šul’gin-Anekdoten zum Besten. Etwa wie er aus dem Parlamentssaal verwiesen wurde, weil er am Rednerpult die sozialistischen Abgeordneten fragte, ob einer von ihnen eine Bombe in der Tasche trage. Oder wie er eine Affäre mit der Frau seines Bruders hatte und dann zwei Jahre später eine Beziehung mit der Frau seines anderen Bruders anfing. Oder wie er sich 1914 freiwillig zur Armee meldete, aber nach zwei Stunden an der Front verwundet wurde, sodass der Arzt ihn sofort ins Hinterland zurückschickte. Oder wie er 1926 inkognito in die Sowjetunion reiste, danach ein Buch darüber veröffentlichte und ein paar Monate später herausfand, dass die ganze Reise von der OGPU organisiert war.
Der Bus zurück nach Vladimir kommt dann bald; die Kontrolleurin ist untypisch gut gelaunt und trällert für uns ein russisches Poplied mit, das im Radio läuft. Es ist schon zwei Uhr und nach ein paar altrussischen Kirchen und Pelmeni sitzen wir am Abend wieder im Schnellzug nach Moskau.
Zwei Tage später, die Temperatur ist unterdessen auf fast minus zwanzig gefallen, treffe ich mich mit Paco im Gorki-Park zum Eislaufen. Das heisst, eigentlich kann ich das gar nicht, aber Paco besteht darauf, also rutsche ich ihm hinterher und es macht ja auch Spass. Nach ein paar Runden gehen wir, ohne die Schlittschuhe auszuziehen, in eines der Restaurants, die zu diesem Zweck vorsorglich mit Gummimatten ausgelegt wurden. Paco ist mal wieder – zweimal Suppe und Boeuf Stroganoff, bitte! – bestens informiert über russische Formalisten, aktuelle Feuilletonskandale und die Geschehnisse auf der Plattform des Kurznachrichtendienstes Twitter. Bei der Verabschiedung in der Metrostation unten lädt er mich noch zur Finissage einer Ausstellung des mir zuvor unbekannten, aber durchaus nachahmenswerten Malers Georgij Nisskij ein; dann springen wir beide in unseren jeweiligen Zug.
Am Mittwochmorgen setze ich die fizkul’tura im Bad Čajka fort, wo man auch im tiefsten Moskauer Winter unter freiem Himmel schwimmen kann. Die Sonne scheint und das Wasser dampft und die Bademeister tragen Skianzüge und überhaupt ist alles sehr gut, obwohl die kürzlich erfolgte Renovierung den 50s-Groove fast völlig beseitigt hat. In der Banja hält ein Typ, Bauchansatz und Halbglatze, einen Vortrag über Herrscherinnen in der koreanischen und russischen Geschichte und über die Schrecken des Matriarchats in manchen Kulturen. Ein anderer, klein gewachsen, ausgedünnter Pferdeschwanz, hält im Namen des Universalismus dagegen, die Probleme mit der Schwiegermutter seien doch in Moskau genau die gleichen wie in New York oder Tel Aviv. Das Ende dieser spannenden Debatte bekomme ich leider nicht mit, weil es mir bei hundertzehn Grad irgendwann doch zu warm wird.
Beim Ausgang fällt mir ein grosses Wandgemälde auf, das Ivan Turgenjev mit seinem Hund darstellt. Das erinnert einen natürlich sofort an Josiks altbekannte These, derzufolge schriftstellerisches Talent mit Hundeliebe korreliert (Koni, Kraus, Fontane и прочая и прочая), und ich mache kurz den Test für Turgenjev: Hundeliebe? Check. Superster Schriftsteller? Check.
Von Turgenjev komme ich wiederum schnell zurück auf Vasilij Šul’gin, der sich 1952 im stalinistischen Gefängnis derart langweilte, dass er zweihundert Seiten (in allerdings ziemlich grosser Handschrift) über seinen Jugendhund Mars und über andere Köter vollkritzelte. Nachzulesen ist das alles im Russländischen Staatlichen Literatur- und Kunstarchiv (RGALI) unter dem Titel »Vot gde zaryta sobaka« – »Da also liegt der Hund begraben«.
Nun hatte Vasilij Šul’gin allerdings auch eine Katze, die er (wohl nach sich selbst) Vas’ka nannte und ein Lieblingspferd, das ebenfalls Vas’ka hiess und auf dem er 1906 durch die Wälder Wolhyniens ritt, um Priester und Bauern davon zu überzeugen, bei den nächsten Wahlen doch bitte für die Monarchisten zu stimmen. Was dann auch erstaunlich gut klappte und die Basis für ebenjene politische Karriere legte, die er danach jahrzehntelang memoiristisch ausweidete.
Aber zurück zu Mars und zu Josiks These, nun auf Šul’gin angewendet. Hundeliebe? Auf jeden Fall. Superster Schriftsteller? Hm. Die Memoiren lassen sich schon ganz ordentlich weglesen, aber nach einigen tausend Seiten weiss man dann genug über seine Haustiere und Cousinen.