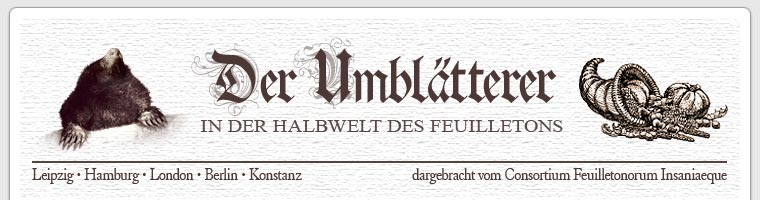100-Seiten-Bücher – Teil 137
Irène Némirovsky: »Der Ball« (1930)
München, 4. Januar 2019, 00:45 | von Josik
Irène Némirovskys extremst witzige und auch slightly melancholische Novelle »Der Ball« wurde erstmals 1930 veröffentlicht und schon 1931 verfilmt. Der Film dauert 75 Minuten, und praktisch genauso lang dauert es, das Buch zu lesen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das Buch natürlich nicht nur gelesen, sondern erstens gelesen und zweitens parallel auf dem second screen gekuckt. Wer das tun möchte, möge bitte darauf achten, die richtige Verfilmung auszuwählen, denn es gibt auch noch eine weitere Verfilmung von 1931, die nicht eineinviertel, sondern anderthalb Stunden dauert, und eine dritte Verfilmung von 1969, die nur dreißig Minuten dauert, wobei man sagen muss, dass man es kaum schaffen wird, das Buch in nur einer halben Stunde zu lesen, außerdem gibt es noch eine vierte Verfilmung von 1993, die 83 Minuten dauert, und wer weiß, ob ich nicht noch die eine oder andere Verfilmung übersehen habe. Aber gut, das alles ist jetzt grade gar nicht so wichtig, deshalb zurück zum Buch.
Über Nacht reich werden ist leicht – wer kennt es nicht! Doch über Nacht die Manieren von Reichen annehmen ist schwer. Von diesem lustigen Dilemma erzählt Irène Némirovsky in ihrem supersten Buch »Der Ball«. Viel Spaß!
Irene (ohne Accent) Nemirovsky (ohne Accent): Der Ball. Novelle. Berechtigte Übersetzung aus dem Französischen von Grit Zoller. Wien/Hamburg: Paul Zsolnay Verlag 1986. S. 5–91 (= 87 Textseiten).
(Einführung ins 100-Seiten-Projekt hier. Übersicht über alle Bände hier.)