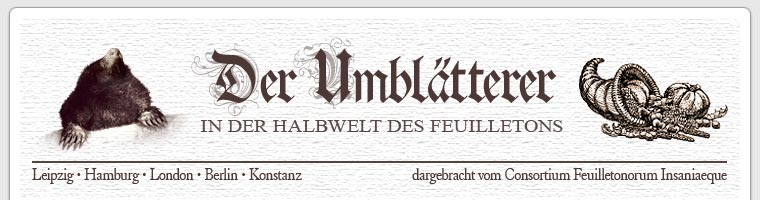Vor- und Nachruf auf Frank Schirrmacher
Berlin, 20. Juni 2014, 07:00 | von Josik
»Der Großteil der Journalisten des deutschen Gegenwartsfeuilletons hat Schirrmachers Weg gekreuzt, zum Besseren oder zum Schlechteren. Schaudernd erzählen sich noch heute die, die dabei waren, von der großen Feuilletonisten-Wanderung, die im Jahr 2001 zwischen SZ und FAZ stattfand«.
(Jakob Augstein im »Freitag« vom 16. August 2012)
»Man muss sich klarmachen, dass trotz seines jungen Alters der Großteil der Journalisten des deutschen Gegenwartsfeuilletons Schirrmachers Weg gekreuzt hat, und diese Begegnungen hatten oft Folgen, zum Besseren oder zum Schlechteren. Legendär ist ja die große Feuilletonisten-Wanderung, die im Jahr 2001 zwischen den Kulturressorts der Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen stattfand.«
(Jakob Augstein im »Spiegel« vom 16. Juni 2014, S. 115)
»Über Schirrmachers Schlüssel-Ego Christian Meier heißt es in dem Buch: ›Er führte seine Zeitung wie ein Bankier einen Hedgefonds, als spekulatives Geschäft. Dauernd passierte etwas, das zu keinem vorhersehbaren Verlauf, zu keinem Skript passte.‹ Das ist eine schöne und böse Beschreibung. Der Wille zur Denunziation ist unübersehbar. Aber, warum nicht – Schirrmacher als Themen-Kapitalist, einer, der auf die Akkumulation von Fantasie setzt, ein Spekulant der Ideen und Entwürfe, der in seiner Anlagestrategie auch mal über die Leichen der braven Kultur-Leute in den Redaktionen geht, die sich ihre Ideen mühsam vom Munde absparen müssen, dessen Rendite aber das beste Feuilleton des Landes ist.«
(Jakob Augstein im »Freitag« vom 16. August 2012)
»Über Schirrmachers Buch-Ego Christian Meier heißt es in dem Roman: ›Er führte seine Zeitung wie ein Bankier einen Hedgefonds, als spekulatives Geschäft.‹ Das war eine schöne und böse Beschreibung: Schirrmacher, der Themen-Kapitalist, der auf die Akkumulation von Fantasie setzt, ein Spekulant der Ideen, der in seiner Anlagestrategie auch über die Leichen der braven Kultur-Leute geht, die sich ihre Ideen mühsam vom Munde absparen müssen, dessen Rendite aber das beste Feuilleton des Landes ist.«
(Jakob Augstein im »Spiegel« vom 16. Juni 2014, S. 115)
»Zum Ende des vergangenen Jahrhunderts hat er sich selber und uns allen ein Programm für die kommenden Jahre geschrieben: ›Fast wöchentlich werden wir von technologischen und wissenschaftlichen Innovationen überrascht wie kaum eine Generation zuvor, und Europa schweigt. … Der amerikanische Theoretiker und Computerexperte Ray Kurzweil verkündet unter dem Beifall des amerikanischen Publikums, dass Computer noch zu unseren Lebzeiten den menschlichen Verstand übersteigen werden, und in Deutschland kennt man noch nicht einmal seinen Namen. … Europa soll nicht nur die Software von Ich-Krisen und Ich-Verlusten, von Verzweiflung und abendländischer Melancholie liefern. Wir sollten an dem Code, der hier geschrieben wird, mitschreiben.‹«
(Jakob Augstein im »Freitag« vom 16. August 2012)
»Im Jahr 2000 legte Schirrmacher sich und uns allen das Programm für die kommenden Jahre fest: ›Fast wöchentlich werden wir von technologischen und wissenschaftlichen Innovationen überrascht wie kaum eine Generation zuvor, und Europa schweigt. (…) Der amerikanische Theoretiker und Computerexperte Ray Kurzweil verkündet unter dem Beifall des amerikanischen Publikums, dass Computer noch zu unseren Lebzeiten den menschlichen Verstand übersteigen werden, und in Deutschland kennt man noch nicht einmal seinen Namen. (…) Europa soll nicht nur die Software von Ich-Krisen und Ich-Verlusten, von Verzweiflung und abendländischer Melancholie liefern. Wir sollten an dem Code, der hier geschrieben wird, mitschreiben.‹«
(Jakob Augstein im »Spiegel« vom 16. Juni 2014, S. 115)
»Schirrmacher schreibt: ›Ein Jahrzehnt enthemmter Finanzmarktökonomie entpuppt sich als das erfolgreichste Resozialisierungsprogramm linker Gesellschaftskritik.‹ Und dann schreibt Sahra Wagenknecht ihre vielleicht besten, sicher aber einflussreichsten Texte über Europa und die Finanzen in der FAZ – nicht im Neuen Deutschland und nicht auf der Netzseite der Linkspartei (und auch nicht im Freitag).«
(Jakob Augstein im »Freitag« vom 16. August 2012)
»Nach der großen Finanzkrise, die eine Vertrauenskrise des Kapitalismus war, stellte er fest: ›Ein Jahrzehnt enthemmter Finanzmarktökonomie entpuppt sich als das erfolgreichste Resozialisierungsprogramm linker Gesellschaftskritik.‹ Und dann druckte er die vielleicht besten Texte der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht über Europa und die Finanzen in der FAZ ab.«
(Jakob Augstein im »Spiegel« vom 16. Juni 2014, S. 115)
»Ein ›großartiges intellektuelles Spielzeug‹ hat Schirrmacher das Feuilleton einmal genannt. Wie sehr müssen ihn all jene dafür hassen, die das Spielen vor langer Zeit verlernt haben.«
(Jakob Augstein im »Freitag« vom 16. August 2012)
»Schirrmacher nannte das Feuilleton einmal ein ›großartiges intellektuelles Spielzeug‹. Und wie sehr hassten ihn all jene dafür, die das Spielen vor langer Zeit verlernt haben!«
(Jakob Augstein im »Spiegel« vom 16. Juni 2014, S. 115)
»Der Mächtige, der es jung an die Spitze geschafft hat und für dessen Aufstieg das Nietzsche-Wort galt: ›Ich überspringe oft die Stufen, wenn ich steige, – das verzeiht mir keine Stufe.‹«
(Jakob Augstein im »Freitag« vom 16. August 2012)
»Für den Mächtigen, der es jung an die Spitze geschafft hatte, galt das Nietzsche-Wort: ›Ich überspringe oft die Stufen, wenn ich steige – das verzeiht mir keine Stufe.‹«
(Jakob Augstein im »Spiegel« vom 16. Juni 2014, S. 115)
»Wer sich hierzulande gleichzeitig mit Philosophie, Technologie, Soziologie, Epistomologie und Heuristik befasst, arbeitet vermutlich eher in der Redaktion der Sendung mit der Maus als am Elitezentrum einer deutschen Universität oder in der Redaktion eines Feuilletons.«
(Jakob Augstein im »Freitag« vom 16. August 2012)
»Wer sich gleichzeitig mit Philosophie, Technologie, Soziologie und Heuristik befasst, arbeitet eher in der Redaktion der ›Sendung mit der Maus‹ als in der Redaktion einer großen Zeitung.«
(Jakob Augstein im »Spiegel« vom 16. Juni 2014, S. 114)