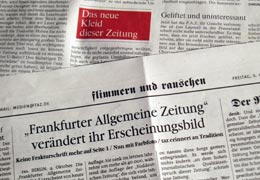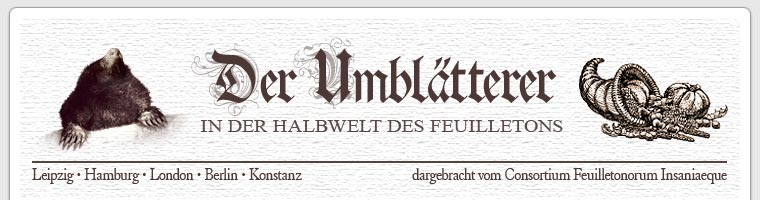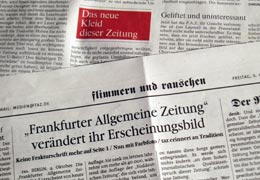[ Inhalt: Prolog – 1. Der Abbesteller – 2. Der Gratulant – 3. Der Betrogene – 4. Der Buchhalter – 5. Der Beschwerdeopportunist –
6. Der Intimitätenausplauderer – 7. Der Zurückgebliebene –
8. Der Co-Referent – 9. Der Markenleser – 10. Der Mythenfortschreiber ]
Prolog
Die einen wurden, so wie Paco & Co. in Madrid, böse überrascht. Die anderen versuchten, den Teufel noch in letzter Minute auszutreiben. Tatsächlich bedeutet so ein Relaunch wie derjenige der FAZ am 5. Oktober 2007 ja viel mehr als eine rein kosmetische Operation: Er ist der Moment der Katharsis jeder Leser-Blatt-Bindung und scheint überhaupt eines der letzten Exklusiv-Events zu sein, die das Printmedium zu bieten hat (nachdem es die Nachrichten als solche ja schon lange nicht mehr sind und echte Scoops auch nur halb so oft vorkommen wie wir Feuilletonjunkies gern behaupten).
Mediensoziologen sollten dringend mal sämtliche Leserreaktionen von allen Layoutreformen der letzten Jahre einsammeln und in einen Sammelband packen. Heraus käme ein ganz wunderbarer Reader über parasoziale Beziehungen voller Marotten und Spleens.
Das Schattenwesen ›Zeitungsleser‹: Es war nach dem Generallifting der FAZ vor einem Jahr genauso zu besichtigen wie bei der NZZ Anfang 2006 – nämlich sonderseitenweise – und hat auf jeden Fall das Zeug zur Typologie. Nirgends sonst lernt man seine Mitleser, aber womöglich auch sich selbst besser kennen wie nach Layout-Reformen seiner Zeitung.
(Alle Zitate stammen aus Leserbriefen der NZZ (26. 1. 2006), FAZ (10. und 13. 10. 2007) sowie den Kommentarsträngen zu Beiträgen des Fontblogs und des Antibuerokratieteams.)
1. Der Abbesteller
»Ich habe mein langjähriges Abonnement noch am selben Tag gekündigt.« Das ist und bleibt verdammt noch mal die aktivste Form, auf einen Relaunch zu reagieren. Deswegen ist der Abbesteller auch der eigentliche Actionheld aller Leser: wie die ganze Abbesteller-Szene längst ein Mythos, der von der Markenstrategie jeder mittelguten Zeitung denn auch ordentlich gepflegt wird. Oder wie sonst soll man es erklären, wenn Tobias Trevisan, Geschäftsführer der FAZ, von »rund 200« Abo-Kündigungen infolge der Layoutreform spricht?
Es irrt, wer glaubt, der Abbesteller kenne nur eine Handlung und Haltung. Der Abbesteller kann viel mehr als abbestellen: Er kann auch bloß vorhaben oder androhen, Abbesteller zu werden (»will ich dann nicht mehr abonnieren«) und er muss noch nicht mal Abonnent sein, um Abbesteller zu spielen:
»Ich sage es Ihnen ganz klar: Ich kaufe die F.A.Z. vorerst nicht mehr. Vielleicht hilft Ihnen mein bescheidener Protest als Korrektiv zu Ihrer zweifelhaften Umfrage, deren Ergebnisse zum ›Souverän‹ zu stilisieren Sie nicht müde werden.«
Der Abbesteller scheint stets aktiv und souverän. Dabei vergisst er, dass es ihn auch im Passiv geben kann. So ist sein natürlicher Feind der Leser, der sich im Relaunch-Graben mit der Zeitung verbündet und fordert: »Entziehen Sie den Nörglern das Abonnement!«
2. Der Gratulant
… ist mindestens so schnell aber eben nur halb so cool wie der Abbesteller. Alles Neue eines Relaunchs einfach gut finden kann auch ein FAZ-Leser. Die auffälligsten unter den Gratulanten sind die älteren Semester, die alle Neuerungen schon allein deswegen gut finden, weil sie um Himmels willen nicht als traditionalistisch und konservativ rüberkommen wollen. Besondere Kennzeichen: das explizite oder implizite »zwar … aber«:
»Gut gelungen, modern, attraktiv. Gratulation. Bin zwar schon 77 Jahre alt, aber für Neues noch immer aufgeschlossen.«
Besonders viele Gratulanten hatte übrigens die NZZ nach ihrem Relaunch vor knapp 3 Jahren. Was wir daraus für Schlüsse auf das Durchschnittsalter der Leserschaft der alten Tante schließen dürfen?
3. Der Betrogene
… definiert seine eigene Leser-Blatt-Bindung wie eine langjährige Beziehung und ist, zumindest was seinen Printmedienkonsum anbelangt (Radio, TV und Netz konsumiert man ja insgesamt promisker), streng monogam.
Umso mehr fühlt sich ein unerwarteter Relaunch seiner Zeitung für ihn ungefähr so an, als ob er seine bessere Frühstückshälfte in flagranti beim Fremdgehen erwischt: Da sieht die neue FAZ dann plötzlich so aus wie die alte FR, erinnert die Schreibung der Ressortnamen in Großbuchstaben unvermittelt an das Layout der NZZ. Kurzum: Der Betrogene erkennt sich in seiner eigenen Umblätter-Beziehung nicht mehr wieder.
Es gibt Betrogene, die versuchen, schon im Vorfeld auf den Betrug, den der Relaunch ihnen bescheren wird, vorbereitet zu sein. Sie haben extra einen Beziehungsratgeber gelesen und gelernt, auch in Extremsituationen verständnisvoll zu sein. Für sie geht die Zeitung, nur weil sie sich optisch verändert, noch lange nicht fremd.
»Als langjähriger F.A.Z.-Leser finde ich mich plötzlich in der Rolle eines treuen Ehemannes wieder, dessen Ehefrau gerade frisch vom Friseur kommt. Irritiert, und doch zugleich angenehm überrascht nehme ich Kenntnis von ihrem neuen Outfit.
Auch einen neuen Rock hat sie sich zugelegt. ›Gut siehst du aus‹, sage ich, auch um mich selbst zu überzeugen und meine zögerliche Haltung zu übertönen. Doch, doch, ich freue mich, dass sie sich schick macht. Schließlich tut sie’s ja für mich. Die Hauptsache ist freilich, dass in der Verpackung immer noch die Frau steckt, die ich kenne. Eine Ehe lebt mit wachsender Dauer davon, dass man dem, mit dem man sein Leben teilt, vertrauen kann. Aber auch von der Offenheit beider Partner, sich mit der Zeit weiterzuentwickeln und nicht ewig auf dem gleichen Punkt zu verharren. Zumindest hat das die Beziehung zwischen zwei Menschen mit der eines Lesers zu seiner Zeitung gemein.«
Eine andere Betrogene dachte eigentlich immer, sie führe eine offene Beziehung. Das Äußerliche, die visuelle Anmutung ihrer Zeitung schien ihr (gegenüber dem intellektuellen Gehalt) im Grunde gar nicht so wichtig. Bis zum Tag X: »Ich hätte selbst nicht vermutet, dass ich so emotional auf formale Aspekte reagieren würde, aber wenn man sich über viele Jahre an das Besondere (inhaltlich und eben auch gestalterisch) der F.A.Z. gewöhnt hatte, ist es ein ziemlicher Schlag.«
4. Der Buchhalter
Der Buchhalter führt genau Protokoll über alle Kränkungen, die seine Zeitung ihm und anderen Lesern zufügt. Er ist ein Pedant, der auch und gerade beim jüngsten Relaunch immer sämtliche Daten der Relaunchs aus früheren Jahren parat hat.
»Schon beim Übergang zu den Farbfotos machte sich hochqualifizierter Protest bemerkbar in den Leserbriefen vom 14. Februar 2003. Die Farbe Rot in verschiedenen Anwendungen löste dann eine weitere kritische Welle aus in den Leserbriefen vom 9. Dezember 2005 und 22. Dezember 2005. In den veröffentlichen Zuschriften ist damals mit großem Sachverstand und viel Herzblut das Nötige vorgetragen worden. Es war eine Zweidrittel- bis Dreiviertelmehrheit aller Stellungnahmen. Bewirkt hat sie nichts.«
Warum der Buchhalter all diese Zeugnisse sammelt und ob er sie eventuell noch als Zeugenaussagen braucht, weiß man nicht so genau. Entweder er plant noch ein rückwirkendes Leser-Plebiszit, oder aber er führt für die Zeit seines Ruhestands eine Sammelklage im Schilde: Rückerstattung der Abo-Gebühren oder – wenn das nichts nützt – Schmerzensgeld. Im Grunde ist der Buchhalter ein besonders armer Hund: einer, den es eigentlich volle Breitseite emotional erwischt, der aber mit seinen Emotionen trotzdem nicht umgehen kann. Selbst das Schlussmachen gerät ihm zum formal-bürokratischen Akt: Und deswegen »… beende ich die jahrzehntelange Liebe zu dieser Zeitung bereits jetzt.«
5. Der Beschwerdeopportunist
… hat sowieso schon lange »feststellen müssen, dass die Qualität nachgelassen hat«. Aber im Grunde wird er vor allem jetzt »das dumpfe Gefühl eines Qualitätsverlustes nicht los«, denn jetzt ist Beschwerdezeit. Indiskretion Ehrensache hat dieses Prinzip in seinem schönen Münsteraner Brunnengleichnis zusammengefasst: In Münster wurde ein seit Jahren friedlich plätschernder Brunnen erst in dem Moment wahrgenommen, als man eine Skulptur drumherum baute. Ähnliches gilt für die Stellvertreterkritik am Layout, die eigentlich den Inhalt meint:
»Erst durch den Relaunch scheinen sich einige Leser Gedanken über die Zeitung zu machen, die sie seit Jahren lesen.«
Ein Relaunch ist so gesehen nichts anderes als der Elternsprechtag in der Schule oder das Stadtteilgespräch mit dem OB, ein formal organisierter Anlass zur Aussprache und Beschwerde.
Mancher Beschwerdeführer läuft dabei richtig zur Hochform auf und spinnt das Szenario gleich schon mal weiter. Science-Fiction für uns Leserbriefleser sozusagen:
»In zehn Jahren wird der ›Wandel der Lesegewohnheiten‹ zur F.A.Z. im Tabloid-Format mit noch größeren Farbanteilen und hundert Seiten Umfang geführt haben.«
6. Der Intimitätenausplauderer
Ähnlich wie der Beschwerdeopportunist hat auch der Intimitätenausplauderer eigentlich nur auf die Gelegenheit gewartet, sich mal mitteilen zu können – allerdings vor allem in eigener Sache.
Der Intimitätenausplauderer kann zum neuen Layout niemals nur gratulieren, er tut dies zum Beispiel als »Ihr treuester ostdeutscher Leser (seit 17 Jahren)«. Richtig so: Da wohnt der Typ also in Leipzig und will auch einmal Anerkennung (und sei es nur Leserbrieföffentlichkeit) dafür, dass er seine innere Einheit mit seinem damals extra bestellten Abo der Zeitung für Deutschland jetzt auch schon fast zur Volljährigkeit gebracht hat.
Mitteilen kann man – bzw. frau – sich aber auch, indem man seine Lebensgeschichte erzählt …
»Ich bin eines der selten gewordenen Kinder, die tatsächlich mit der täglichen Zeitungslektüre, sowohl der eigenen als auch der der Eltern, aufgewachsen sind.«
… seine aktuelle Lebenssituation schildert …
»Ich darf Ihnen mitteilen, dass mein Freund und ich, seit wir in unsere Studentenwohnung gezogen sind, Ihre Zeitung abonniert haben. Mein Freund, der von seinen Eltern eine andere Zeitung kannte, empfindet die Lektüre der F.A.Z. mittlerweile ebenfalls als Bereicherung.«
… oder seine Lesegewohnheiten. Hier wird es schon wieder ganz interessant, vor allem da, wo es Schnittmengen zum eigenen Verhalten gibt:
»Ich lese die F.A.Z. auch an Tagen, an denen ich wenig Zeit habe. (…) Wenn mich ein Text besonders interessiert, so hebe ich ihn für das Wochenende auf.«
Die letzten drei Zitate übrigens von ein- und derselben Leserbriefschreiberin. Übel spielt das Schicksal auch jenen mit, die eine Layoutreform als erhebliche Störung ihrer rituellen Lesepraktiken empfinden:
»Jede Ausgabe wird von mir mit der großen Papierschere zerschnitten nach interessanten Beiträgen, die ich an befreundete Menschen, aber auch an meine Kinder verschicke. Die Quellenangabe F.A.Z. konnte ich mir oft sparen, denn die Empfänger erkannten schon an der Aufmachung, aus welcher Zeitung der Beitrag stammte. Das ist nun vorbei (…).«
Wer weiß, wie viele Verwandte und Freunde jetzt nur deswegen keine Post kriegen, weil der Herr keine Lust mehr hat, extra überall FAZ dazuzuschreiben. Solange die Leute noch nicht erzählen, wie der Fischhändler heißt, der seine Fische mit ihrer alten Zeitung …
7. Der Zurückgebliebene
… ist der tragischste aller Lesertypen, die sich nach einem Relaunch outen. Er kriegt wohl weiter mit, dass es mal wieder – schon wieder – Veränderungen im Blatt gab, doch in Wahrheit leckt er immer noch seine Wunden vom vorletzten und vorvorletzten Relaunch. Seine Meinung zur aktuellen Layoutreform äußert er nur, um die Erinnerung wach zu halten. »Vor einigen Jahren hatten Sie freitags die Spalte für den Philatelisten. Ich vermisse sie immer noch.«
Zum Loser in den Leserbriefspalten wird der Zurückgebliebene vor allem neben dem Gratulant, der fragt: »Wann kommt der nächste Schritt?«
8. Der Co-Referent
… scheint auf den ersten Blick emotionslos, weil er nach dem Relaunch nicht zürnt, nicht lamentiert, nicht leidet. Seine Leidenschaft gilt den überzeitlichen Dimensionen: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Nachruf auf die Fraktur?
»Am 6. Oktober 2007 endete ein halbes Jahrtausend der ›Zweischriftigkeit‹, das heißt der Konkurrenz der gebrochenen Schriften aus Mittelalter und der römischen Antiqua, welche die Humanisten zu neuem Leben erweckten. Während in den Nachbarländern die sogenannten gotischen Schreib- und Druckschriften mit ihren eckigen, spitzen, verzierten Buchstaben bald außer Brauch gerieten, blieben sie im deutschen Sprachgebiet für alle deutschen Texte bewahrt, die Antiqua war lateinischen und anderen fremdsprachigen Texten vorbehalten und kurioserweise allen Fremdwörtern, die auf diese Weise – mitten im Fraktur-Fließtext – als Ausländer markiert würden.«
Wer sich für den ganzen Vortrag interessiert – in dem es u. a. noch um Friedrich den Großen, der »als frankophoner Literat die Antiqua bevorzugte«, eine Reichstagsdebatte 1911 und den Führererlass zur Fraktur 1941 geht – sollte bei eBay dringend eine FAZ vom 13. Oktober ersteigern oder sich direkt an Prof. Dr. Horst Haider Munske aus Erlangen wenden.
9. Der Markenleser
Der Markenleser schätzt seine Zeitung wie den Manufactum-Katalog. Es gibt sie noch, die gute alte Fraktur, die Titelseite ohne Bild, die Linien zwischen den Spalten. Der Markenleser ist also ein Leser, der sich ganz bewusst entschieden hat. Er ist bzw. war stolz, »eine Zeitung zu lesen, die es nicht mit den Boulevardzeitungen hielt, nämlich eine Verkaufsaufmache für Analphabeten zu gestalten«.
Vom Relaunch wird er aufgescheucht wie ein Stück Wild. Es gefällt ihm ganz und gar nicht, »im Einerlei des Blätterwaldes keine Zuflucht mehr zu haben«, und er wünscht sich nichts sehnlicher zurück als seine alte Schutzzone: »Warum muss die F.A.Z. die Leser mit Bildern auf der Titelseite behelligen, wo wir doch Tausende Bilder täglich auf uns einwirken sehen?«
Als aufgeklärter Leser hat natürlich auch der Markenleser verstanden, dass Relaunchs heute zur Marketingstrategie dazugehören. Also versucht er, auf dieser Ebene zu argumentieren:
»Ich wünsche mir sehr, dass Sie zu Ihrem bisherigen Layout zurückkehren, ich betrachte es nicht zuletzt auch als einen betriebswirtschaftlichen Wert, eine Unique Selling Proposition.«
Aber im Grunde seines Herzens überwiegt die Enttäuschung:
»Es bleibt mir auf der ganzen Linie unerklärlich, wie eine Zeitung wie die Ihrige auf die Idee verfallen kann, ein weltweit einzigartiges Markenzeichen – Titelseite ohne Foto – (…) einfach aus der Hand zu geben.«
Vielleicht muss sich aber mal wieder ein Christian Kracht für ein neues Bilderverbot stark machen, um die Leser-Blatt-Bindung zu reaktivieren?
10. Der Mythenfortschreiber
Was den Mythenfortschreiber von allen anderen Leserreaktionen abhebt, ist sein Gespür für das, was geht und kommt und bleibt. Schon im Vorfeld kann er den Relaunch, so wie Kommentator Bernie, kaum erwarten:
»Als Abonnent freue ich mich schon seit Tagen darauf! Die Leserbriefspalten waren zuletzt so lustig, als sie die neue Rechtschreibung eingeführt haben. Erst in den FAZ-Leserbriefen erfährt man, was das Abendland wirklich ausmacht (und wie bald es untergehen wird).«
Der Mythenfortschreiber tut so, als ob er klein-klein über Typo-Fragen fachsimpelt, so wie die Jungs vom Antibuerokratieteam oder die Fontblogger. In Wahrheit schreibt er die alten großen Erzählungen unserer Feuilletonväter fort: Dinge wie die »Prantelei« der S-Zeitung oder die Farbenlehre der »Zeitung für Deutschland«. Schwarz die Politik, rot das Feuilleton, gold (gelb) der Wirtschaftsteil. Es gibt Hunderte solcher Geschichten, bei Relaunch-Gelegenheiten kommen sie bevorzugt ans Licht.
Ganz großes Kino ist natürlich auch der taz-Genosse, der sich in der FAZ vom 13. 10. 2007 als Abbesteller outete: Vielleicht zeigt gerade sein Statement, was taz und FAZ zu den besten Verbündeten innerhalb der Halbwelt des Feuilletons macht:
»In Wahrheit war die F.A.Z. – mit ihrer anarchistischen Frakturschrift, der ästhetisch schwarz-weißen Titelseite inmitten der allgegenwärtigen Bilderflut, der David-gegen-Goliath-Standhaftigkeit gegen die unsinnige Rechtschreibreform, dem unabhängigen, exzentrischen Feuilleton (die besten Artikel über Reggae-Platten und Pop-Konzerte), dem Pfund guerrillahaft-unabhängiger Medienberichterstattung, den anachronistischen Konservativ-Kommentaren und vor allem dem altmodischen Mut zur Ernsthaftigkeit – die radikale Tageszeitung Deutschland.«
Eine schönere Liebeserklärung hat man jedenfalls lange nicht gelesen. Ob der schwer verliebte taz-Genosse sich am Tag X auch so sehr in diese Seite seiner taz verknallt hat?