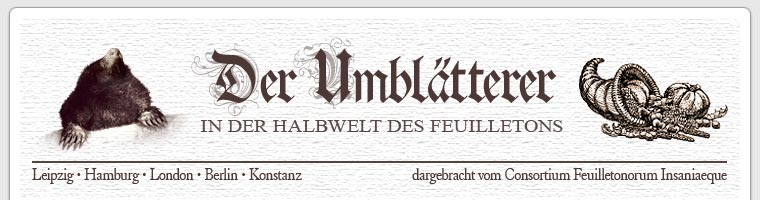Graw-tsee-yeah!
Rom, 13. Juni 2008, 16:40 | von Paco
Von unserer Erasmus-WG in Parioli ist es nicht weit bis zur Villa Borghese. Nach einem Zwischenstopp bei Il Cigno gehen wir direkt zur Galleria Borghese, wo im Moment eine Correggio-Ausstellung läuft, das dritte der Dekadenprojekte der Galerie nach Raffael und Canova – es folgen u. a. 2009 Bacon & Caravaggio, 2011 Tizian, 2012 Cranach.
Eine Correggio-Einzelausstellung war längst mal fällig, allerdings wird man von der unerwarteten Phylle halb erschlagen. Außerdem befinden sich im Präsenzbestand der Galleria natürlich auch noch die Wahnsinnsstatuen von Bernini und Canova, dazu noch 6 Bilder von Caravaggio, mehr als irgendwo sonst, Raffaels »Kreuzabnahme« und Correggios »Danae«.
Davon muss man sich erst mal mit ein paar Nebenwerken erholen: Ein Sassoferrato hängt überraschenderweise im selben Raum wie ein de Hooch. Das glaubt man immer gar nicht, dass das Zeitgenossen waren. Von Sasso hängt hier die übliche wächserne und superschöne Madonna, von de Hooch das Flötistenbild, das inklusive offenem Fenster wieder voller lüsterner Anspielungen ist.
Wir kommen dann irgendwann wieder auf das Veronese-Mocking und die Leonardo-Relativierung von Sébastien2000 zu sprechen und das Alan-Bennett-Interview neulich in »La Repubblica« (28. 5., S. 53, Aufmacher von »R2 Cultura«). »Leonardo? Non mi piace« war die Überschrift. Das ist wie wenn Umberto Eco in der SZ zitiert wird mit »Goethe? Find ich echt scheiße«.
Der Interviewer (Enrico Franceschini) hatte dann nachgefragt, was seine beleidigten Landsleute mit so einer Aussage bitteschön machen sollen. Bennett erwiderte, dass er Leonardo als Meister der Renaissance natürlich schon irgendwie anerkenne, dass seine Werke aber nicht seine Interessenssphäre berührten. Ob er nicht mal die »Mona Lisa« gut finde? Nun ja, er habe sich das Bild nie angesehen, da er stets von dem Massenauflauf davor abgeschreckt worden war.
Der Anlass für die Intervista war übrigens das Erscheinen der italienischen Übersetzung seines Buches über die Londoner National Gallery bei Adelphi. Er macht in dem Gespräch auch wieder Stimmung für den unvoreingenommenen Blick auf Kunstwerke. Das ist subtextuell natürlich auch ein Diss gegen die Audio-Guide-Kultur. Außerdem zeigt sich Bennett belustigt darüber, dass alle immer mit diesem Pathos ins Museum gehen und dadurch jedes dort ausgestellte Ding automatisch als anerkannt gut empfinden.
Nach 2 Stunden wird man bekanntlich aus der Galleria Borghese geschmissen, wir legen ein paar alte SZs und FAZs auf eine Villa-Wiese und machen Siesta. Noch im Halbschlaf kriege ich nach einer Weile mit, wie Dique einem Amerikaner mit »Lone Star State«-T-Shirt den Weg zur Piazza del Popolo beschreibt.
Der gut ausgestattete Touri hält Dique dann wegen seines blauen Hemds eventuell für einen Italiener und bedankt sich mit einem kräftigen: »Graw-tsee-yeah!« So ungefähr dürfte die »Grazie«-Ausspracheanweisung im Lonely Planet lauten. Diese herrlichen Amerikaner!
Auf einmal ist alles graw-tsee-yeah, wir schießen auch noch mal Richtung Piazza del Popolo, noch mal wegen ein paar Lieblingsdetails in die Caravaggio-Kirche rein, und danach mache ich ziemlich in der Mitte des Platzes noch dieses Bild, ich, Dique, Millek, Sébastien2000 (hat heute frei), San Andreas: