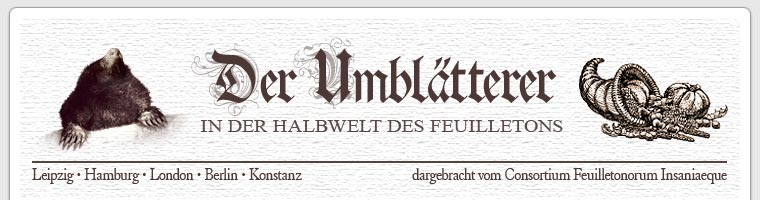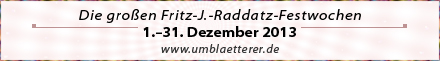O.S. (für Oberschlesien) muss mal eine gängige deutsche Abkürzung gewesen sein, so geläufig wie heute NRW. »O.S.« als Roman von Arnolt Bronnen kennen wohl die wenigsten, und da hat man natürlich im Prinzip auch nichts verpasst.
Das Buch spielt vor dem Hintergrund der deutsch-polnischen Unruhen in Oberschlesien 1921 und erschien 1929, und dass der Ernst Jünger der Zwischenkriegszeit es lobte und mochte, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Argument, hehe.
Nun ja, ein im Handgepäck nach Polen eingeschleuster FAZ-Artikel brachte mich dazu, Bronnen doch mal zu lesen. Hubert Spiegel hatte auf der »Geisteswissenschaften« vom 18. April die »Oeuvres et correspondances. Dialogues d’Ernst Jünger« besprochen. Es ging um den Briefwechsel zwischen Ernst Jünger und Ernst von Salomon.
Salomon hat übrigens einen ähnlich gelagerten Roman geschrieben, »Die Geächteten«, der ein paar Monate nach Bronnens Buch erschien und auch ein Kapitel namens »O.S.« enthält. Salomon hat dann später in seinem Bestseller »Der Fragebogen« (1951) gemeint, dass dieser Roman sein schlechtestes Buch aller Zeiten gewesen sei, aber eben leider auch sein bis dahin mit Abstand erfolgreichstes.
Aber zurück zum FAZ-Artikel, in dem es auch darum ging, dass sich Jünger gleich mehrfach zu »O.S.« geäußert habe.
Was Jünger an »O.S.« gefällt …
… ist »die Traditionslosigkeit, der völlige Mangel an ethischen Wertungen, die absolute Respektlosigkeit«:
»Denn der Gang der Dinge ist folgender. Zunächst hat man das Kriegserlebnis ignoriert. Als es sich dann stärker und unabweisbarer ins Bewußtsein schob, versuchte man es einzufangen und das Elementare an ihm zu lähmen, indem man es mit zivilisatorischen Mitteln behandelte.«
Doch Krieg, so Jünger, könne man nun mal »auf die Dauer nicht mit jenen Mitteln behandeln, die seinem Wesen entgegengesetzt sind«. Und deswegen sei »O.S.« als Roman, der vom Untergrundkampf im völkerrechtlich neutralisierten Oberschlesien handelt, ein Werk, »das auch dem, der es noch nicht wußte, deutlich macht, daß im Zivilisatorischen das Barbarische als eine notwendige Konsequenz enthalten ist«. (Ernst Jünger: Wandlung im Kriegsbuch. A. Bronnens Roman ›O.S.‹. In: Der Tag, 23. Mai 1929.)
Ein ziemlich tendenziöser Zeitroman …
… ist »O.S.« natürlich trotzdem. Proletarisch, polenfeindlich, deutschnational-chauvinistisch. Grundgedanke des Buchs ist, dass die lasche Politik in Berlin, die den Versailler Vertrag ernst nimmt, nichts bringt und man selbst für die Sache kämpfen muss – notfalls auch »gegen die Republik, gegen Demokratie und Parlamentarismus, gegen Pazifismus und Liberalismus, gegen ›Politik‹ ganz allgemein«. (Ursula Münch: Weg und Werk Arnolt Bronnens. Wandlungen seines Denkens. Bern etc.: Peter Lang 1985, S. 131f.) Für Carl von Ossietzky war »O.S.« denn auch: »ein Attentat auf den Völkerfrieden«.
Andere Zeitgenossen finden, dass Bronnen eher exemplarisch mit Oberschlesien dealt. Mit dem realen Oberschlesien, so die Lesart von Karl Heinz Ruppel, habe Bronnen eigentlich wenig am Hut: »Ihn lockten der Krach, die Zerstörung, die Ansätze zur Anarchie, die in den oberschlesischen Notjahren auftauchten.« (zit. nach Ursula Münch, S. 139) Das wäre dann wieder Jüngers Idee vom Elementaren. Oder eben, mit Kurt Tucholsky, doch nur »Blut, Vagina und Nationalflagge«.
Der Plot von »O.S.« …
… ist tatsächlich ziemlich abstrus, teilweise auch schlicht willkürlich und deswegen kaum nachzuerzählen. Ungefähr passiert folgendes:
Ein Berliner BEWAG-Monteur, gerade an einer Straßenlaterne beschäftigt, wird von einem Taxi angefahren. Weil er deswegen seinen Zug nach Oberschlesien verpasst, rastet der Taxipassagier aus. Haut dem Taxifahrer eins über und lässt sich kurzerhand vom Monteur mit dem geklauten Taxi nach Oberschlesien chauffieren.
Und so beginnt eine Roadnovel: Rein ins Ruhrgebiet des Ostens, das zu der Zeit offiziell unter alliierter Kontrolle steht, aber inoffiziell von allen möglichen Gruppen terrorisiert wird: Es gibt aufständische polnische Arbeitnehmer, deutsche Kommunisten und nationalrevolutionäre Zirkel, die schon vor der Volksabstimmung Fakten schaffen wollen und sich mit rivalisierenden polnischen Freischärlern paramilitärische Scharmützel liefern. Daneben großbürgerliche (deutsche) Arbeitgeber, die das Industrierevier und seine Bodenschätze auf jeden Fall ›halten‹ wollen. Waffenschmuggler, ein französischer General und eine Einheimische, die man vielleicht »fickrig« nennen würde, sind mit von der Partie. Das Mädel wird prompt schwanger, die Abtreibung (vorgenommen von einem Medizinstudent) geht krass schief. Und es kommen noch mehr Leute ziemlich splattermoviehaft zu Tode. Kurzum:
Das Blutige, das Trashig-Gewaltorgiastische, …
… überhaupt die ganzen Anarcho-Elemente und der Genreverschnitt – das hätte ein Tarantino-Drehbuch auch nicht besser hingekriegt. Im Übrigen taugt Bronnen als Zeitansage: Massenhaft beginnen Szenen so, dass es irgendwo gerade »punkt elf«, »zwölf Minuten nach« oder »eine Minute vor viertel Zwölf« (hä?) ist. Also sehr livestreamig, aber eben, das muss auch Jünger zugeben: schon »mehr gestanzt als gefeilt«.
»›O.S.‹ ist ein mehrschichtiges Gangster-Stück Bronnens«, schreibt Friedbert Aspetsberger in seiner Bronnen-XXL-Monografie. Wer sich literaturwissenschaftlich einlesen will: Das Ganze gipfelt in der Pointe, dass Bronnen ein Westernheld ist und O.S. eigentlich für Old Shatterhand steht …
P.S. für alle Leipziger
Völlig unwichtiger Aha-Effekt bei der »O.S.«-Lektüre, der mir aber trotzdem nicht mehr aus dem Kopf geht: Europas größter Kopfbahnhof hatte schon in den Zwanzigern nur ein Gleis für den Fernverkehr, nämlich das einschlägige. Es geht auch damals schon »zum 10. Bahnsteig, wo hinter weißen Wolken frischen Dampfes die schwarzen, feuchten Wagen des München-Breslauer D Zuges lagen«.