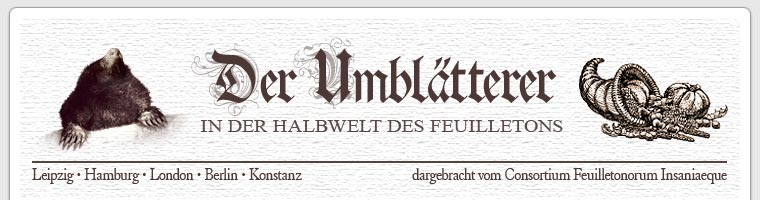Betriebsjubiläum:
Vor 30 Jahren begann die Feuilletonmanie von Rainald Goetz
St. Petersburg, 29. August 2011, 00:50 | von Paco
Er ist promovierter Historiker und Mediziner und arbeitet nun schon seit drei Jahrzehnten an einem ordentlich durchnummerierten literarischen Œuvre. Den größeren Teil seines erwachsenen Lebens dürfte Rainald Goetz aber mit etwas anderem zugebracht haben. Er dürfte irgendwo herumgesessen, herumgelegen oder herumgestanden haben mit einem aufgeschlagenen Feuilleton vor der Nase.
Teleologisch schien dieses Zeitungsleserleben auf den Auftritt in der Harald-Schmidt-Show am 8. April 2010 gerichtet zu sein, als Goetz vor einem Millionenpublikum triumphal die erste Seite des aktuellen FAZ-Feuilletons vorführte und auf sympathische Weise feierte und lobpreiste. Angefangen hat diese manische Auseinandersetzung mit dem Kulturressort der deutschsprachigen Zeitungen aber vor genau 30 Jahren. Damals erschien unter dem Titel »Reise durch das deutsche Feuilleton« einer der ersten Goetz-Texte überhaupt. Er fand sich in der von Hans Magnus Enzensberger und Gaston Salvatore gegründeten Zeitschrift »TransAtlantik«, in der Ausgabe vom August 1981.
Dieses einige Jahre später eingestellte Monatsmagazin wollte sich nach dem Vorbild des »New Yorker« auf große Reportagen spezialisieren, entlang der von Enzensberger ausgegebenen Parole von der »Untersuchung der Wirklichkeit mit literarischen Mitteln«. Der 27-jährige Rainald Goetz ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht der ewige Suhrkamp-Autor, er ist noch erkennbar auf der Suche nach seiner Sprache und den vom Herausgeber angekündigten »literarischen Mitteln«.
Heiliger Bezirk
Der Münchner Medizinstudent, der gerade in der Psychiatrie arbeitet, nutzt für seine geplante Reportage drei Wochen Ferien, um einige der von ihm »bewunderten Herren des Feuilletons« aufzusuchen und persönlich kennenzulernen, als erklärter Fan. Als Zeitungsleser ist man ja sowieso auch erst satisfaktionsfähig, wenn einem die Namen der Journalisten mindestens genauso wichtig sind wie deren jeweilige Themen, wenn nicht wichtiger. Und so schnappt er sich seinen Kassettenrekorder und macht sich auf den Weg zu Wolfram Schütte (»Frankfurter Rundschau«), Wolfgang Ignée (»Stuttgarter Zeitung«), einem ungenannten »Spiegel«-Redakteur, Fritz J. Raddatz (»Die Zeit«), Marcel Reich-Ranicki (FAZ) sowie Joachim Kaiser (SZ).
Die kurzen Ausflüge führen ihn nach Frankfurt, Stuttgart, Hamburg und in den Münchner Norden. Berlin, heute unangefochten die Stadt mit dem höchsten Feuilletonistenaufkommen pro km², ist noch geteilt und weit ab vom Schuss, für ein Porträt des bundesrepublikanischen Kulturjournalismus entbehrlich. Das Feuilleton ist damals auch noch nicht zur diskursiven Allzweckwaffe umgebaut, und so begegnet Goetz vor allem Rezensenten alter Schule, inklusive »Großkritiker« und »Literaturpapst«. Seine Feuilletonhelden haben ihm mit ihren Kritiken vor allem eingeimpft, »dass die Literatur ein heiliger Bezirk ist«.
Und so klingt die Reportage ab und zu noch wunderbar gestelzt, Goetz redet von sich in der dritten Person und tritt stets als »der Besucher« auf. Als solcher lässt er sich von seinen Idolen des Kulturbetriebs begierig die Biografien heruntererzählen, denn eines scheint ihn vor allem zu interessieren: Wie wird man Feuilletonist? Als ihm Reich-Ranicki seinen Tagesablauf schildert, sinniert Goetz: »Von einer solchen Existenzweise, meint der Besucher, kann man nur träumen.«
Zweifel und Dissen
Dabei haben ihn die Besuche bei Schütte (»verquälte Selbstzweifel«) und Ignée (»forcierte Bescheidenheit«) sowie der Klatsch und Tratsch auf seiner ersten Buchmesse erst mal desillusioniert. Begeistert ist er über das Frankfurter Gelände gestapft und hat freudig Hellmuth Karasek und Reinhard Baumgart an sich vorüberhuschen sehen. Aber dann muss er erschrocken in einen Abgrund blicken: »Menschenverachtung beherrscht diesen Betrieb, Neid, Verlogenheit, Größenwahn, Ungerechtigkeit, Anmaßung.« Erst Raddatz wird ihn wieder beruhigen. Das sei doch alles ganz normal. Und am Ende reden sie noch über stilvolle Selbstmorde und alles ist wieder gut.
Auch die Jovialität von Reich-Ranicki und Kaiser holen ihn zurück in die Welt seiner Feuilletonfantasien. Dabei hat er schon noch das Gefühl, abgefertigt zu werden. Kaiser scheint durch ihn hindurchzublicken, und von Reich-Ranicki muss er sich dessen Buch »Zur Literatur der DDR« signieren und schenken lassen. Aber Goetz will kritisch sein, wie man das eben sein muss, und stellt dabei gelungene Coming-of-Age-Fragen: »Aus welchem Impuls heraus schreiben Sie?« Und zwischendurch wendet er ab und zu ordnungsgemäß die Kassetten im Rekorder.
So begann also vor 30 Jahren seine Tätigkeit im feuilletonverarbeitenden Gewerbe. Die Manie ist schon da (wer sonst besucht freiwillig sechs Literaturredakteure?), aber noch will Goetz etwas angestrengt an allem zweifeln, um seine Begeisterung ansatzweise zu relativieren. Trotzdem schimmert hier schon die unbedingte Totalaffirmation des deutschsprachigen Feuilletons durch, die sich später etwa an den täglichen Eintragungen in »Abfall für alle« ablesen lässt, wenn er längst Zweifel durch Dissen ersetzt hat. Für den Autor Goetz ist die intensive Feuilletonlektüre nachgerade überlebensnotwendig geworden. Ohne sie würde er wahrscheinlich seine Bücher auch gar nicht mehr vollkriegen, hehe.
(Dass Goetz beim Bücherschreiben und nicht beim Feuilleton selbst gelandet ist, hat übrigens auch mit dieser frühen Reportage und einem kleinen Disput mit Enzensberger zu tun, siehe R. G., »Kronos«, Suhrkamp 1993, S. 259f.; dazu vielleicht später mehr.)