Gaston Gallimard et la « traumdenfung »
Paris, 6. April 2011, 13:52 | von Niwoabyl

Ce dimanche, nous sommes allés tôt le matin au Louvre. Nous nous rendions à l’exposition Messerschmidt, non point pour y contempler des débris d’avions à réaction, mais les « têtes de caractère » du célèbre sculpteur bavarois. On pourrait dire de cette petite cinquantaine de bustes qu’elle fut luxueusement sculptée dans toutes les règles de l’art, si les visages y étaient idéalisés ; mais ceux-ci s’y présentent comme défigurés par les grimaces les plus aberrantes.
Sur les raisons qui poussèrent Franz Xaver Messerschmidt (1736–1783) à commettre cet acte unique dans les annales de la sculpture courent d’aventureuses théories, et ce n’est qu’après la mort de l’artiste que les bustes reçurent leurs bien arbitraires désignations. Aux rangs de celles-ci « l’homme constipé », « l’homme qui pleure comme un enfant » ou encore « le bassoniste incapable » sont sans doute les plus belles et les plus surprenantes.
Une bonne demi-heure plus tard, nous étions de retour dans le métro, en route pour la Bibliothèque Nationale où, ainsi que nous l’avions appris quelques jours auparavant par la Gazette de Francfort, se tenait une exposition en l’honneur de la maison Gallimard. Y étaient présentés entre autres choses : ouvert dans une vitrine, le manuscrit original des « Bienveillantes » de Jonathan Littell, porteur d’annotation d’une impeccable propreté ; et, accrochée sur l’une des cloisons, la lettre écrite le 11 juillet 1921 à Sigmund Freud par Gaston Gallimard, dans laquelle il le prie de bien vouloir donner son accord à la publication française de la « TRAUMDENFUNG » (« celui de vos ouvrages que vous estimez le plus important, n’est-ce pas »).
Ce titre fautif reçut trente ans plus tard sa juste récompense, dans la lettre de William Faulkner à Gaston Gallimard du 14 juin 1951. Le romancier américain y a comme une prescience du style bien particulier de Google Traduction : « Mon excuse [à l’envoi tardif de cette lettre] c’est seulment que j’etais engage completer un roman lequel sera digne, on espois sincerement, de la generosite de votre pardon. » (Rendue en allemand, cette phrase pourrait sonner à peu près ainsi : « Meine Entschuldigung ist bloss dass ich beschaftigt war einen Roman vervollstandigen welcher, man hofft aufrichtig, sich als wurdig erweisen wird der Grosszugigkeit ihres Verzeihens. »)
Ce ton joyeux et bon-enfant est celui de toute l’exposition, qui n’est pas bien grande ; on peut la traverser vite et sans effort, comme déjà Messerschmidt au Louvre. Puis nous sommes partis à la gare Saint-Lazare acheter la Sonntagszeitung, et ensuite au café Rosa Bonheur des Buttes-Chaumont, où nous avions rendez-vous. Et « en fait, c’est tout », comme l’écrivait Daniil Harms.
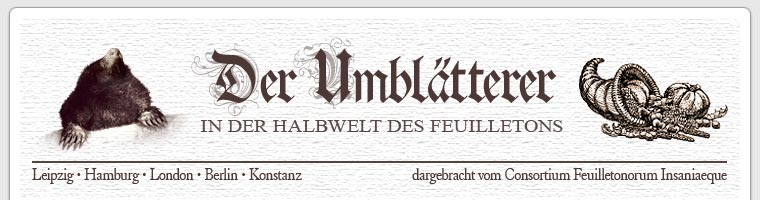


 In wenigen Stunden, am Dienstagmorgen, 11. Januar 2011, kürt
In wenigen Stunden, am Dienstagmorgen, 11. Januar 2011, kürt 