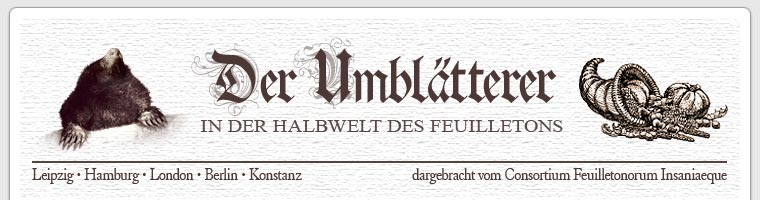Das »Stuttgart 21« des 19. Jahrhunderts?
Baumschützer gegen Bahn —
Eine kleine Kulturgeschichte
Konstanz, 12. Februar 2011, 08:02 | von Marcuccio
Das beste Argument gegen »Stuttgart 21«? Ein Baum, sagen die Schlossgarten-Beschützer von Stuttgart. Und deswegen ja auch gestern wieder, wie jeden Freitag, Baum-Qi-Gong! Heute Abend dann übrigens Premiere des ersten S21-Theaterstücks: »Antigone 21«.
Das untrüglich Bildungsbürgerliche von Anti-S21 ist die andauernde kulturhistorische Selbstveredlung, ebenso wie die schamlose Beschlagwortung der eigenen Protest-Aktivitäten. Das Vokabular reicht vom »Platz des himmlischen Friedens« bis zur »Klagemauer«, von der »Montagsdemo« bis zum Transparent »Von Tunis lernen«.
Keine Frage: Wutbürger sind vor allem Bildungsbürger, und sie haben verstanden, dass man die richtigen Keywords liefern muss, um die eigenen Belange kultur- und zeitgeschichtlich aufzuwerten.
Serpentara statt »Stuttgart 21«
Wenn’s aber wirklich bildungsbürgerlich zugehen soll, könnte man auch mal an die eisenbahnhistorischen Vorläufer von S21 erinnern. Baumschützer gegen Bahnprojekt, das hat deutsche Tradition. Wer wissen will wo, sollte mal nach Olevano Romano fahren, »das kaputte Bergnest« (Rolf Dieter Brinkmann, hehe) bei Rom. Gerade im Vorfrühling kann es dort schon sehr schön mild sein. Und wahrscheinlich genau deswegen hat die deutschrömische Künstlerkolonie früh Gefallen an dem Ort gefunden.
Besonders ein immergrünes Eichenwäldchen namens La Serpentara, zu deutsch Schlangenhain, hatte es den Landschaftsmalern der Romantik angetan. Ihre ästhetische Landnahme ging sogar so weit, dass sie sich dieses beliebte Motiv nicht abholzen lassen wollten, denn eigentlich stand dieses Eichenwäldchen kurz vor der Rodung: Aus dem Holz sollten Gleisschwellen für die Italienische Eisenbahn enstehen.
Edmund Kanoldt setzte sich 1873 erfolgreich an die Spitze der Bewegung gegen Serpentara 21. Die Abholzung konnte nicht nur verhindert, sondern das Waldstück durch Spenden der deutschen Künstlerschaft sogar gekauft werden. (Die Villa Massimo dankt es bis heute mit dem Villa-Serpentara-Stipendium.) Lebendiger Beleg für den Erfolg der Rettungsaktion ist eine Kanoldt-Zeichnung, die die Kunsthalle Karlsruhe erst letztes Jahr frisch erworben hat. Sie zeigt das Waldstück in einer mehr als geschickten Komposition:

»Die Lenkung des Blicks auf die gerettete Serpentara wird durch eine Eintönigkeit in der Wiedergabe des Berghangs gegeben, wo Kanoldt in ruhigen Parallellinien die Modulierung des Geländes als lichtüberflutete Fläche darstellt – ein Hinweis auf landschaftliche Ödnis, die aus der Abholzung des Waldes resultieren würde?«
… fragt Regine Hess im Katalog der Karlsruher Ausstellung »Viaggio in Italia« (S. 248). Und noch ein Beweis, warum sich Katalogkäufe lohnen: Angeblich wurde die Kanoldt-Zeichnung für Max Jordan angefertigt, den damaligen Direktor der Berliner Nationalgalerie. Ob der in seinen Leipziger Italien-Vorlesungen noch zu letzten Spenden aufgerufen hat?
Irgendwann hat er »La Serpentara di Olevano« wahrscheinlich einfach mal grinsend auf den Overhead-Projektor gelegt, die Wald-Trophäe mit der triumphalen Bildinschrift: »Eigenthum der deutschen Künstler« steht da tatsächlich reingeschrieben, und wie zum Beweis sieht man ein kleines Männchen (mit Malerhut und Zeichenmappe?) auf dem Weg zum nächsten Motiv.
Alle Macht geht vom Künstlervolke aus, würden jetzt wohl auch die Parkschützer von Stuttgart skandieren. Und wenn der Stuttgarter Bauzaun (vulgo Klagemauer) soeben als »soziale Skulptur« ins baden-württembergische Haus der Geschichte aufgenommen wurde, dann ist der gerettete Eichen(!!!)hain von Serpentara ja wohl allemal ein Beuys-Ding. Nur eben knapp hundert Jahre avant la lettre.
(Bild: zeno.org)