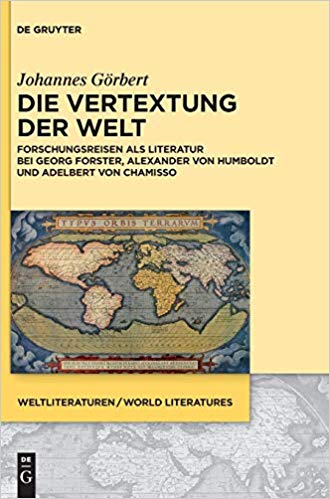Forschungsreiseberichte als Literatur
Johannes Görbert legt eine anregende Analyse von Forster, Humboldt und Chamisso vor
Von Sandra Vlasta
Die literaturwissenschaftliche Erforschung von Reiseberichten und Reiseliteratur, im englischen Sprachraum als Travel Writing Studies bekannt, erfährt in den letzten dreißig Jahren eine erfreuliche Konjunktur. Das trifft sowohl auf die Forschung in verschiedenen Sprachräumen als auch in verschiedenen Disziplinen wie der Germanistik, Anglistik, Romanistik und der Komparatistik zu. Im Kontext dieser Forschung legt Johannes Görbert eine Studie vor, die sich explizit Berichten von Forschungsreisen widmet, und zwar von drei Schwergewichten in diesem Bereich, nämlich Georg Forster, Alexander von Humboldt und Adelbert von Chamisso.
In seiner 2013 an der Freien Universität Berlin als Dissertationsschrift angenommenen und in der Schriftenreihe Weltliteraturen/World Literatures der Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien publizierten Arbeit interessiert sich Görbert dafür, wie Wirklichkeitserfahrungen „vertextet“ werden, das heißt konkret, wie die während der Forschungsreisen gemachten Erfahrungen in Textform gebracht werden, sowie dafür, wie sich die Autoren durch die Texte inszenieren – sowohl in Form einer solipsistischen Selbstinszenierung als auch in Form einer Positionierung im Feld der Forschungsreisenden und der darüber Bericht erstattenden. Görbert analysiert damit zwei typische Ebenen der Gattung Reisebericht, die Carl Thompson in seiner Einführung zum Genre als „reporting the world“ beziehungsweise „revealing the self“ bezeichnet hat.
Der im Titel des Buches angesprochenen „Vertextung der Welt“ nähert sich Görbert in zwei Schritten an, nämlich erstens in Form eines Blicks auf die Makrostrukturen und, zweitens, in Form eines Blicks auf die Mikrostrukturen. Im Abschnitt zu den Makrostrukturen werden vor allem die Paratexte der Reiseberichte unter die Lupe genommen, also im Sinne Gérard Genettes all jene Texte, die nicht eigentlicher Bestandteil des Textes sind, sondern zu dessen Beiwerk (bzw. bei Genette: seuils) zu zählen sind. Görbert analysiert hier besonders zwei Arten des Paratextes, nämlich einerseits Material, das die drei Autoren „im thematischen Umkreis der Reisetexte“ selbst verfasst haben, d.h. vor allem Briefe, sowie andererseits die Vorworte zu den Reiseberichten. Letztere sind in Reiseberichten, zumal in zeitgenössischen, allerdings so häufig, dass sich die Frage stellt, inwieweit sie als „Paratext“ verstanden werden können oder nicht vielmehr als integraler Bestandteil der Texte zu sehen sind.
In seinen Analysen des relevanten Korpus, bei denen es Görbert gelingt, viel Hintergrund- und Kontextinformation zu den Reisen und den Berichten darüber zu geben, zeigt er, wie die ähnlichen Makrostrukturen der Texte für verschiedene Funktionen genutzt werden, was zum Teil mit dem unterschiedlichen Zielpublikum zu tun hat: So verändern sich Textgestaltung und Inhalt bei Forster und Humboldt in den jeweils englisch-, französisch- oder deutschsprachigen Versionen ihrer Texte. Alle drei Autoren präsentieren sich als „ernstzunehmende Naturwissenschaftler“, Humboldt ist es zudem daran gelegen, sein Reiseziel Amerika zu legitimieren. Darüber hinaus zeigt Görbert in diesem Teil verschiedene Widersprüche zwischen der in den Vorworten beschriebenen Programmatik und deren Umsetzung im Text auf, zum Beispiel jenen der angekündigten Neuheit und Einmaligkeit von Forsters Bericht und der relativen Konventionalität im folgenden Text.
Im Abschnitt zu den Mikrostrukturen wendet sich Görbert konkreten Phänomenen auf der Textebene zu: den Klassikerzitaten bei Forster, dem Konzept des Naturgemäldes bei Humboldt und den Reisegedichten bei Chamisso. Diese drei Aspekte haben individuelle Funktionen, die allerdings als Versuche zusammengefasst werden können, die außergewöhnlichen Erfahrungen der Forschungsexpeditionen, die durch große Vielfalt sowie zum Teil extreme, auch lebensbedrohliche Situationen gekennzeichnet sind, zu „vertexten“ und einem europäischen Lesepublikum nahezubringen. Mit der Analyse dieser heterogenen Elemente bespricht der Autor gleichzeitig ein Gattungsmerkmal des Reiseberichts, nämlich seine Hybridität. Diese macht ihn zu einem offenen, integrativen Genre, das eine große Bandbreite formaler und stilistischer Elemente vereinen kann, was Görbert als besonders faszinierend empfindet.
Der zweite große Teil des Buches ist der Selbstinszenierung sowie -positionierung der Autoren gewidmet. Görbert interessiert hier die innere Reise zu sich selbst, die in der einschlägigen Forschung immer auch als Teil des Reiseberichts gesehen wird und die es ermöglicht, das Genre als eine Form des life writing zu sehen. In diesem Sinne können Reiseberichte im Fall von Schriftstellerinnen und Schriftstellern zum Teil durchaus auch zu poetologischen Texten werden. Neben den Bildern, welche die drei Autoren von sich selbst in ihren Texten konstruieren – Forster im Sinne der zeitgenössisch aktuellen Strömung der Empfindsamkeit als sentimentaler Naturforscher, Humboldt als universalgelehrter Meister der Konversationskunst und Chamisso schließlich in kontinuierlicher Beziehung mit der von ihm geschaffenen fiktiven Figur Peter Schlemihls – analysiert Görbert ihre Positionierung im literarischen Feld mit dem von Wolfgang G. Müller eingeführten Begriff der „Interfiguralität“. Alle drei Autoren versuchen demnach, „ihre eigene Position im ‚Feld‘ durch Allianzbildungen bzw. Absetzbewegungen zu schriftstellerischen Konkurrenten [‚Figuren‘] zu befestigen“ und dabei ihren eigenen Habitus zu kultivieren.
In diesem Sinne setzt sich Georg Forster (besonders in seinem Essay Cook, der Entdecker) in Beziehung zu James Cook, als dessen „potenzieller Nachlassverwalter“ er sich darstellt, und versucht auf diese Weise, seine eigene Position zu stärken. Humboldt hingegen bezieht sich auf Forster und versucht, dessen Prestige als Reiseschriftsteller und Entdeckungsreisender für sich selbst zu nutzen. Chamisso schließlich kann als Beispiel für eine andere Form der Bezugnahme dienen, da er sich, zumal in seinem zweiten, später verfassten Bericht (Tagebuch) der Weltreise mit Kapitän Otto von Kotzebue stark von diesem distanziert bzw. dessen Darlegungen kritisiert. Er versucht auf diese Weise, eine singuläre Position im literarischen Feld durch demonstrative Abgrenzung von einer anderen prominenten Figur zu erreichen. Görbert mutmaßt, dass Autoren von Reiseberichten „verstärkt zu schriftstellerischen Positionsbestimmungen“ tendieren. Dabei ist fraglich, inwiefern das nicht jeweils im Kontext konkreter historischer Situationen zu sehen ist, wie auch Görbert andeutet: Alle drei von ihm behandelten Autoren stehen unter großem Konkurrenzdruck und müssen sich zum Teil von zeitgleich erscheinenden Publikationen (und deren Autoren) über dieselbe Reise abgrenzen bzw. zumindest dazu in Beziehung setzen (wie Forster zu Cook).
Görberts Arbeit ist vergleichend angelegt, blickt er doch auf die drei Autoren und deren Berichte von Forschungsreisen. Immer wieder wird die Tatsache erwähnt, dass die drei üblicherweise als Deutsche behandelten Naturforscher und Autoren die fraglichen Texte zumindest in der ersten Version in verschiedenen Sprachen verfasst haben (Forster: Englisch, Humboldt: Französisch, Chamisso: Deutsch). Eine eingehendere Berücksichtigung dieser Konstellation könnte eine solche Untersuchung noch genuin komparatistischer machen und helfen, die besonderen Produktions- und Rezeptionssituationen im Vergleich zu beleuchten – Görbert bietet in kurzen Abschnitten zu den verschiedensprachigen Fassungen von Forsters und Humboldts Berichten einen Vorgeschmack davon.
Obwohl sich Görbert drei bereits intensiv beforschte Texte vornimmt, gelingt es ihm in seiner sehr gut lesbaren und klar strukturierten Studie, neue Aspekte anzusprechen bzw. im vergleichenden Blick auf die drei (mehr oder weniger) zeitgenössischen Texte neue Perspektiven zu eröffnen. Dabei knüpft er einerseits immer wieder an die internationale (vor allem deutsch- und englischsprachige) literaturwissenschaftliche Reiseberichtsforschung an, andererseits führt er diese erfolgreich mit anderen literaturwissenschaftlichen Modellen eng, wie Gérard Genettes Paratext oder Pierre Bourdieus literarischem Feld. Ein anregender Band, der viele Anknüpfungspunkte für weitere Arbeiten im Feld der Reiseberichtsforschung bietet.
Ein Beitrag aus der Komparatistik-Redaktion der Universität Mainz
|
||