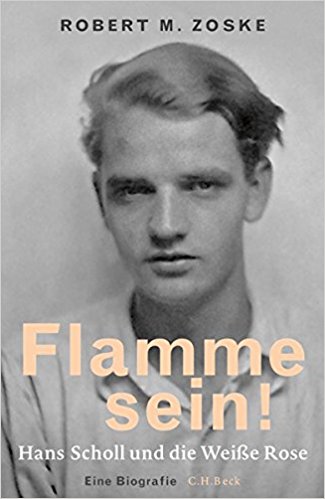Schonungslose Recherchen zur NS-Vergangenheit einer legendären Regisseurin
Nachwort zur neuen Studie von Nina Gladitz über Leni Riefenstahl
Von Albrecht Götz von Olenhusen
Vorbemerkung der Redaktion: In ihrem vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) im September 1982 gesendeten Film „Zeit des Schweigens und der Dunkelheit“ hatte sich die Autorin und Dokumentarfilmerin Nina Gladitz kritisch mit der Entstehungsgeschichte des Spielfilms „Tiefland“ von Leni Riefenstahl auseinandergesetzt. Riefenstahl hatte ihn während des Krieges gedreht und war dabei von Hitler mit mehreren Millionen Reichsmark finanziell unterstützt worden. Der Film wurde aber erst 1953 fertiggestellt. Gladitz fand Zeugen dafür, dass Riefenstahl rund hundert Sinti und Roma aus Internierungslagern als Komparsen ohne Entlohnung für die Dreharbeiten zwangsverpflichtet hatte, die später zum größten Teil nach Auschwitz abtransportiert und ermordet wurden. Leni Riefenstahl klagte gegen den Film von Gladitz, um mehrere Streichungen von Filmpassagen durchzusetzen. Das Oberlandesgericht Karlsruhe wies nach einem Aufsehen erregenden, vier Jahre andauernden Rechtsstreit die Klage zwar weitgehend, aber nicht gänzlich ab. Die Behauptung, Leni Riefenstahl hab damals gewusst habe, dass ihre Komparsen später deportiert und ermordet werden sollten, ihnen falsche Hoffnung gemacht und zynisch versprochen, sie davor zu bewahren, sollte aus dem Film herausgeschnitten werden. Der Film von Gladitz wurde danach nicht mehr öffentlich gezeigt.
Jetzt hat Nina Gladitz in ihrem am 23. Oktober 2020 erschienenen Buch „Leni Riefenstahl. Die Karriere einer Täterin“ ihre Vorwürfe gegenüber der 2003 im Alter von 101 Jahren gestorbenen Regisseurin, die zu den umstrittensten Persönlichkeiten der Filmgeschichte gehört, erweitert und damit sogleich großes Aufsehen in den Medien hervorgerufen – zusammen mit Michael Klofts von Arte gesendetem (und dort in der Mediathek bis zum 19.1.2021 zugänglichem) Film „Leni Riefenstahl – Das Ende eines Mythos“, der weitgehend auf den Recherchen von Gladitz und auf Gesprächen mit ihr basiert. Schon am 17. Oktober erschien im „Spiegel“ ein ausführlicher Artikel von Martin Doerry dazu, am 22. im „Stern“ ein Beitrag von Jochen Siemens, am 23. in der F.A.Z. eine Rezension von Bert Rebhandl. In dem Prozess der achtziger Jahre war Albrecht Götz von Olenhusen der Anwalt von Nina Gladitz (links ein Foto von ihr und ihm aus dieser Zeit; Quelle: Staatsarchiv Freiburg; Foto: Marlis Decker, Freiburg). Zu ihrem neuen Buch hat er ein Nachwort verfasst. Dem Honorarprofessor für Medienrecht an der Universität Düsseldorf und Autor etlicher Beiträge auch in „literaturkritik.de“ danken wir für seine Genehmigung, das Nachwort auch hier zu veröffentlichen. Dem Orell Füssli Verlag, in dem das Buch von Gladitz erschienen ist, danken wir ebenfalls dafür.
In dem Prozess der achtziger Jahre war Albrecht Götz von Olenhusen der Anwalt von Nina Gladitz (links ein Foto von ihr und ihm aus dieser Zeit; Quelle: Staatsarchiv Freiburg; Foto: Marlis Decker, Freiburg). Zu ihrem neuen Buch hat er ein Nachwort verfasst. Dem Honorarprofessor für Medienrecht an der Universität Düsseldorf und Autor etlicher Beiträge auch in „literaturkritik.de“ danken wir für seine Genehmigung, das Nachwort auch hier zu veröffentlichen. Dem Orell Füssli Verlag, in dem das Buch von Gladitz erschienen ist, danken wir ebenfalls dafür.
Thomas Anz
vom Gestrüpp des Wahns und des Mythos gereinigt werden.
Walter Benjamin, Das Passagen-Werk
Eine Fotografie, von der ich nicht mehr weiß, welchem exzellenten Fotografen sie bei Beginn des Prozesses Leni Riefenstahl gegen Nina Gladitz 1984 gelang, zeigt in meiner Erinnerung zwei Personen, die sich gegenüberstehen: die Klägerin Leni Riefenstahl auf der einen, den Zeugen Josef Reinhardt auf der anderen Seite – beide im Profil, sich gegenseitig anblickend: Sie, so scheint es, betrachtet ihr Gegenüber starr, kalt, mit unbewegter Miene, maskenhaft, ohne eine Spur von Lächeln oder einer sonstigen Regung, und wenn sie wie ungerührt in die Augen des Mannes blickte, der Jahrzehnte früher zu den jungen Kinder-Komparsen zählte, die sie aus dem KZ Maxglan bei Salzburg für Filmaufnahmen für Tiefland persönlich rekrutiert hatte, vermochte man nicht die Spur eines Gefühls zu entdecken. Reinhardt wiederum schaut: gelassen, selbstbewusst, wie in sich ruhend, direkt und ohne Scheu, nicht mehr wie der armselige Bittsteller von damals, der sie anflehte, sie, die allmächtige Filmerin, die Freundin des Diktators, seine Familie und ihn selbst vor der sicheren Vernichtung in einem der Todeslager zu retten, sondern jetzt als einer der wenigen Überlebenden, der ihr nach so vielen Jahren erstmals wieder begegnet, souverän und, so meine ich, fast mit einem Anflug von Neugier ins Gesicht sehend. Klägerin und Zeuge – zwei Antipoden am Beginn eines für einige Zeit großes Aufsehen erregenden Verfahrens, in welchem Josef, genannt „Seppl“, wie im vom WDR 1982 ausgestrahlten Dokumentar-Film von Nina Gladitz Zeit des Schweigens und der Dunkelheit als Hauptfigur seine Lebens-Stationen im KZ und bei den Filmaufnahmen in Krün sich erinnernd abschreitet.
Wenn Nina Gladitz in ihrer bedeutenden filmwissenschaftlichen kritischen biografischen Studie über die gnadenlose Täterin, die lebenslange Künstlerin im Kern-Fach Weißwäscherei, berichtet, dass Leni Riefenstahl Josef Reinhardt fragte: „Warum tun Sie mir das an?“, dann wird allein in dieser Frage einmal mehr ihre zeitlebens ausgeübte schamlose Befähigung zur diametralen Umkehrung der Rollen sichtbar: Sie, nur sie ist auch jetzt nur eines – Opfer.
In ihrem Film um das Schicksal der Sinti und Roma im Dritten Reich hatte Nina Gladitz damals zu Recht die scharfe Frage gestellt: „Ist es legitim, um der Kunst willen die Schlachthäuser eines barbarischen Systems zu künstlerischen Zwecken zu benützen?“
Was in den 1980er Jahren auf Grund intensivster Spurensuche gegen enorme Hindernisse und begrenztem Zugang zu historischem Material möglich war, hat Gladitz aufgrund jahrzehntelanger Forschung heute zu einer grandiosen zeit- und filmhistorischen Studie weitergeführt. Sie stellt so gut wie alle Biografien in den Schatten, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Rolle und der Filmarbeit Leni Riefenstahls befassten und vielfach bestenfalls ein ambivalentes Portrait vorführten, meist gepaart mit allenfalls einigen, wegen der unübersehbaren „Nähe“ zum NS-Regime eingeschränkten Vorbehalten. Letztlich blieb jedoch – mit wenigen Ausnahmen – der Mythos einer trotz der zahlreichen NS-Propagandafilme filmkünstlerisch zu feiernden, bedeutenden, eher gänzlich unpolitischen, gar naiven, innerhalb des Systems selbst um Anerkennung und gegen krasse Widerstände von Nazi-Bonzen kämpfenden, unendlich tapferen Frau und scheinbar kompetenten Dokumentarfilmerin als dominante Vision übrig.
Sie ist nunmehr – auch durch die solche Ammenmärchen mit einer systematisch-kritischen Analyse von Riefenstahls Memoiren und sonstigen Zurichtungen biografischer und allgemeiner Historie – nicht mehr haltbar.
Wenn Margarete Mitscherlich pointiert noch formulieren zu können meinte: „Es gelang ihr bis heute, ohne Ahnung von dem zu bleiben, wovon sie keine Ahnung haben wollte“, so klingt die Annahme oder Unterstellung von bewusster oder unbewusster Flucht vor den Realitäten des Dritten Reiches wie ein großzügiges Konstrukt eines überdimensionalen, innerlich wie äußerlich wirksamen Verdrängungssystems. Nach Gladitz’ Werk vermag eine solche fast apologetisch anmutende Pathologisierung einer mit krimineller Energie und selbst in konkreten Krisenzeiten mit ausgepichtester Raffinesse und strategischem Kalkül wirkenden Mit-Täterin nicht weiterzuhelfen.
Mitscherlich hätte besser daran getan, sich an Sigmund Freud zu halten: „Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den Fingerspitzen; aus allen Poren dringt ihm der Verrat.“ Wie diese an entscheidenden Momenten kontrafaktisch dreist pro domo hingebogenen Memoiren in und zwischen den gefinkelten Zeilen zu lesen und wie verräterisch sie zugleich sind, zeigt Gladitz selbst den gläubigsten Feuilletons und Filmhistorikern auf.
Aufgrund einer weit und tief greifenden Arbeit wird mit kühlem Verstand, gleichwohl mit emotionaler Beteiligung, jedoch ohne Ressentiment und mit dem scharfsinnigen, gerade auch filmtechnisch und ästhetisch sachkundigen Blick auf Bilder, Texte, Archivalien und zeitgenössische sowie spätere Berichte das bisher überwiegend als gültig geltende, immer noch positiv grundierte Portrait der Leni Riefenstahl luzide entlarvt: Von allem, was sie zeitlebens bis in ihre selten fundamental kritisierten NS-Propagandafilme und bis hin zur rassistischen, heimlich-metaphorischen Hommage als Kanzelschwalbe des Diktators für dessen End-Sieg – und zugleich primär für sich selbst – sich „geleistet“ hat.
Gladitz filmt, forscht und schreibt seit ihren Anfängen als inhaltlich radikale wie kompetente, an transparent-aufklärerischer Richtung orientierte Dokumentarfilmerin und mit unbeugsam kritischem Geist. Von herrschender Meinung oder Meinung der Herrschenden zu Riefenstahl hat sie sich ebensowenig beeindrucken, geschweige denn jemals einschüchtern lassen. Vielmehr hat sie ihre bahnbrechenden Ergebnisse und Erkenntnisse mit dem Einsatz ihrer ganzen Existenz und den damit verbundenen Verlusten gegen alle Widerstände und mit nie erlahmendem Mut in ihren Filmen, mit dem über Riefenstahl zumal, im Prozess und in ihren Forschungen bis hin zu diesem epochalen Buch – historischwissenschaftlich-literarische Reflektion, „mit einem Schmerz zu sprechen“ (Wilhelm Genazino) – ohne Irrewerden durchgesetzt, mit einem Wort: das bewiesen, was am einfachsten und besten mit einem Begriff zu benennen ist: Haltung.
Ich hege keinen Zweifel, dass die meisten bisherigen Biografien neu zu schreiben, von Grund auf zu revidieren sind; jede neue Darstellung über Filmgeschichte und Riefenstahl vor und nach 1933 wird an diesem opus magnum und seinem fundiertem Ertrag nicht vorüber oder zum business as usual übergehen können. Statt vieler Beispiele mag eine jüngere Biografie dienen, welche sich einmal mehr auf die so beliebte wie beliebige griffige Formel von der „Gratwanderung“ zwischen bemerkenwerter Künstlerin und willfähriger Opportunistin kapriziert, mit einem dubiosen Sammelsurium positiver prominenter Stimmen und schräger bis schriller Tonlagen als willkommene, so illustrativ wie suggestiv fungierende Zugaben aufwartet und die sogar entgegen gerichtlichen Feststellungen von 1985-1987 zur höchstpersönlich ausagierten Zwangs-Rekrutierung der Sinti aus zwei KZs, von Riefenstahl selbst in zweiter Instanz sogar nolens volens akzeptiert, wundersamer Weise auf die Repetition von Lügen in den Memoiren rekurriert. (Mario Leis: Leni Riefenstahl. Reinbek: Rowohlt 2009, S. 90 u. Fn.)
So präzise, plausibel und historisch-dokumentarisch belegt sind die Erkenntnisse über das reale, die wahre Vita einer Lebenslügnerin par excellence in Permanenz, über ihre eine herausragende Fähigkeit neben der zur gerissenen Täuschung, zu Verdeckung und perfider Intrige: sie bestand darin, durchgehend und mit enormer Energie alle sich bietenden Chancen zur egozentrischen Ausnutzung von meist weit begabteren Männern und Frauen und der jeweiligen Strukturen und Zeitläufte mit ungehemmter vitaler Skrupellosigkeit zu nutzen und für sich persönlich auszumünzen. Dabei scheint sie ihre spätere vorbehaltlose begeisterte Identität mit faschistisch-rassistischer Ideologie, nicht Parteimitglied, sondern weit mehr: fanatische Parteigängerin, jedenfalls während der Weimarer Republik noch nicht oder jedenfalls nicht öffentlich umstandslos sichtbar entwickelt oder andeutungsweise ausgelebt zu haben.
Eine ungemein dichte Erzählung im besten Sinne wird uns präsentiert, in kompakter Gesamtheit eine ungeheuer spannende, fast zu lesen wie eine Kriminalgeschichte, die den Leser auch an den mikroskopischen Methoden, den Möglichkeiten zur meisterhaften investigativen Recherche unmittelbar teilnehmen lässt und die ihm womöglich in manchen Abschnitten oder Aspekten auf Anhieb erst scheinbar irreal oder als Fragmente eines irrwitzigen Pandämoniums erscheinen könnten, wären da nicht die durch zuverlässige Beweise, durch klare Indizien und durch ausgedehnte, zuverlässige Auskunftspersonen, Zeugen und angesehene Forscherin mühsamer Kleinarbeit herangezogenen soliden Grundlagen für eine dringend notwendige Korrektur eines biografisch basierten Geschichtsbildes.
Was im legendären, bis heute nicht wieder sichtbaren WDR-Film von 1982 zwangsläufig noch als eine einzelne filmästhetisch und persönlich tingierte Spurensuche sich darstellte, erweist sich in dieser auf mehrere komplexe miteinander verwobene Handlungs- und Forschungsstränge ausgeweiteten, literarisch zudem äußerst eleganten, den Leser sogartig in die Abläufe hineinziehenden biografischen Gesamtdarstellung, als Produkt einer schonungslos radikalen Recherche – mit einem durch einen speziellen, auch stilistisch brillanten dynamischen „Sound“ und eindringlichen Sinn für die bildhaft- filmischen Momente des Metiers, seine subtilen Tücken und Tricks. Nina Gladitz hat ein untrügliches Gespür für jeden falschen Ton, jeden falschen Schnitt, einen glasklaren Durchblick im punkto Produktion von trügerischen Bildern und verqueren Selbstdarstellungen bis hin zu den abgründigsten Beziehungen zum primitiven Antisemiten Julius Streicher. Und sie wird niemals müde, wenn es darum geht, dass in den vielfältigen konfabulierten Schönfärbereien ein bezeichnendes Detail, eine historische Darstellung oder eine symptomatische Abfolge einfach nicht stimmen konnte oder kann.
Wäre Nina Gladitz nicht eine so eminente Dokumentarfilmerin geworden, hätte sie sich gewiss auch als veritable Kriminalistin einen Namen gemacht. Wie sie das krude Kaleidoskop aus zahllosen, manchmal ganz winzigen Beobachtungen und sprechenden Details in der Art eines riesenhaften Puzzles zusammenfügt, hält jeden Vergleich aus. Der rote Faden einer variabel falschen Existenz, der sich durch dieses unsägliche Leben einer noch heute allenthalben verehrten und als hoch bedeutende Film- und Fotokünstlerin eingeschätzten Dokumentarfilmerin zieht, beginnt mit den Verfälschungen der Familienhistorie, setzt sich fort mit den später in Teilen verschwiegenen Anfängen einer Karriere als vergleichsweise unbegabte Tänzerin und Schauspielerin, die zu je passender Zeit jüdische Freunde, Mitarbeiter, Kollegen und Finanziers ungescheut verleugnet, die jede und jeden ihres Fortkommens wegen brutal ausnutzt, grenzenlos ausbeutet und sich deren schöpferische Leistungen aneignet, dabei alsbald deren Namen und Leistungen, vor allem dann die „nichtarischen“, bewusst unterdrückt, um unversehens als alleinige Filmregisseurin und schöpferisches Universal-Genie sich zu gerieren. Es geht weiter mit früher politischer Anbiederung und Wendigkeit, für die, polemisch formuliert, nur ein anderer Buchstabe ausreicht, um die Grenzen zur Windigkeit rücksichts- und bedenkenlos zu überqueren. In jener unseligen ewigen Mischung, die sich vielleicht am simpelsten, aber womöglich zutreffendsten mit der Überschrift „Libido & Macht“ ansatzweise charakterisieren lässt, wird die Riefenstahl, die sich schon früh mit leidenschaftlicher Penetranz an prominente Persönlichkeiten mit für sie profitablem Potenzial wie süchtig heranzumachen pflegte, den aufsteigenden „Star“ Adolf Hitler eingeschlossen und vermutlich schon sehr viel früher mit ihm zugange als bisher bekannt, in dieser damals eher für wenige Insider sichtbaren oder zu erahnenden Mixtur von Ranküne, rabiater Egomanie, unbändigem Ehrgeiz auf Kosten anderer und durch nachhaltige Drogensucht fatal entfesselten und verstärkten negativen Charakterzügen wird sie sich allzeit exzessiv ausleben.
Nina Gladitz hat, wie schon in den Werken ihres Filmschaffens, eine Art siebten Sinn für verborgene Quellen, für die story hinter der story. Jedenfalls hat sie jegliche der Lebenslüge oder Verfälschungen verdächtige Episode der fast unangefochten protegierten NS-Karriere untersucht und dabei die gegenüber den eitlen und betrügerischen Selbstdarstellungen Riefenstahls plausiblen Wahrheiten endlich ans Licht gebracht. Die Geschichte von Tiefland, die eigentümliche Genese und unaufhaltsame Produktions-Geschichte dieses Filmprojektes, das wohl schon weitaus früher durch die Zwangsverpflichtung von KZ-Sklaven begann, als man bisher wusste, und in viel engerem Kontext mit der Karriere Riefenstahls und den ihr durchaus geläufigen, bewussten Zielsetzungen und Praktiken antisemitischer und rassistischer Verfolgung und Vernichtung stand, wird von Grund auf und ganz neu nachgezeichnet. Hier geht die Studie viel tiefer und umfänglicher über den Stand dessen hinaus, was in den Prozessjahren von 1984 bis 1987 ermittelt werden konnte und bekannt wurde. Und so gesehen mag sich mancher, wie der Autor dieses Nachworts, an das vielsagende Wort von Ernst Bloch vom „Fall ins Jetzt“ erinnert fühlen – als ein groteskes Echo auf die schier unglaublichen, die dreisten Wiederholungen Riefenstahls seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, sie habe alle Sinti und Roma-Komparsen von Tiefland nach dem Kriege persönlich wiedergesehen, niemandem sei je ein Leid geschehen, keiner und keine jemals in ein KZ verlegt und dort ermordet worden.
An diesem Punkt erscheint es fairerweise als unumgänglich, meine eigene Rolle als teilnehmender Beobachter und beobachtender Teilnehmer der Arbeit von Nina Gladitz zu skizzieren. Seit Anfang der 1980er Jahre in die Vorarbeiten zum Film, dann in das Prozessgeschehen involviert, durfte ich einige Zeit lang die aufreibende umfängliche Entstehungsgeschichte dieser Studie miterleben. In der seit jeher fragwürdigen Funktion eines Zeitzeugen muss ich daher meine Qualifikation und Unbefangenheit für ein Nachwort von vornherein selbst gründlich in Frage stellen.
Mit der neu erzählten Geschichte um Tiefland, unangefochten und entgegen allen Geschichtsklitterungen Riefenstahls ein von Hitler, Goebbels und der NSDAP den Krieg hindurch mit Millionen finanziertes Projekt, verknüpft sich die Geschichte von Willy Zielke. Sie war und ist in diesem Zusammenhang völlig unbekannt. Der geniale Dokumentarfilmer, von Riefenstahl als gefährlicher Konkurrent ausgemacht, wird, wie Gladitz überzeugend rekonstruiert, mit abgefeimtester Perfidie ausgeschaltet, dann schamlos benutzt, psychisch demoralisiert und demontiert, als „unheilbarer Geisteskranker“ zwangssterilisiert und – jahrelang immer den Tod vor Augen – in einer Psychiatrie belassen, um ihn schließlich, als er für Tiefland zwingend benötigt wird, unter dem Anschein rührender Fürsorge und Nächstenliebe wieder zu „befreien“, und das heißt: ihn sich neuerlich unentrinnbar als unentbehrlichen Arbeitssklaven für die Endfassung von Tiefland bis 1945 dienstbar zu halten. Widerlegt ist damit zugleich z. B. Volker Schlöndorffs waghalsiges kontra-faktisches Votum, für Riefenstahl spreche sehr, „dass sie ab 1939 keine Filme mehr für die nationalsozialistische Partei gedreht hat“. Sie tat es sehr wohl und bis zum Ende des „Dritten Reiches“. Solches Faktum ist essentiell.
Wahrscheinlich, wenn auch derzeit nicht eindeutig beweisbar, ist, dass zu den von ihr kurz vor dem Einmarsch alliierter Truppen eilends und in großen Mengen verbrannten Zelluloidstreifen ein eigens für Himmler, Goebbels und Hitler in einem Ghetto gedrehter Film zählte. Mit solchen künftig zu lösenden Rätseln verknüpft sich die gleichermaßen sensationell brisante Frage, aus welcher Quelle und vor allem wofür denn eigentlich die in der Schweiz damals, 1944, für sie deponierten drei Millionen Schweizer Franken, ein ungeheurer Betrag, im Gegenwert etwa 40 Millionen Reichsmark (!), ihr zugedacht und zugeflossen sein mögen.
So wie in den Anfängen der 1920er Jahre die bloße Mitarbeiterin oder Schauspielerin plötzlich zur alleinigen Filmemacherin und Regisseurin von eigenen Gnaden mutiert, so vermochte sie nicht nur, von den großen Leistungen zahlreicher begabter Kameraleute in der Diktatur zu profitieren, sondern zudem den genialsten deutschen Dokumentarfilmer, Zielkes Leistungen und Werkschaffen sich anzueignen, und ihn selbst zugleich aus den Annalen deutschen Filmgeschichte zu tilgen. Damit wird nicht nur eine dramatische, erschütternde und zutiefst tragische Lebensgeschichte vorgelegt, sondern es ist im Zusammenhang mit Tiefland ein unter dem Deckmantel kollegialer humaner Hilfe in vielfältiger Weise ausgeübter menschlich-moralischer Missbrauch zu konstatieren. Er wird in den Memoiren als pures Rührstück figurieren. Wie die nach seiner rassistischen Funktion und Gestaltung vor Kriegsende fertiggestellte ursprüngliche Endfassung Tieflands von Riefenstahl in den 1950er Jahren verändert, verfälscht, akünstlerisch passend zugerichtet und wie durch die Beseitigung der Sinti- und Roma-Statisten für die neu angepeilte Filmkarriere und Reputation gefährliche Belastungs-Zeugen aus dem Film schritt- und schnittweise beseitigt wurden, ist hier filmhistorisch aufgearbeitet. Als angeblich schlagender Beweis für die doch so ganz unpolitische Riefenstahl vermag die sonst vernachlässigte Produktionsgeschichte dieses Films und seiner Ur-Fassung nach allem, was Gladitz wider ein bislang undurchdringliches Gestrüpp des Wahns und des Mythos vorlegt, nun nicht mehr zu dienen. Es fällt leicht sich vorzustellen, dass den bisherigen Biografen dieses so gar nicht in das bislang stilisierte Psychogramm Passende wenig gefallen wird. Die identifikatorisch übernommenen tröstlichen Geschichtslegenden gerinnen bislang zumeist zu Reinszenierungen durch eine „von Diktatur, Krieg und NS-Weltanschauung versehrte Generation“ (Helmut Dahmer). Zum „judophoben, xenophoben, rassistisch-antisemitischen Dispositiv“ – gerichtet gegen Juden, Zigeuner und andere Migranten – wird es Dahmer zufolge weiter das „Bedürfnis nach realer oder imaginärer Privilegierung und sein Komplement, das Bedürfnis nach sozialer Exklusion, geben…“ – „das judo-alterophobe Dispositiv … wie eine Droge“, kritisch nur aufzulösen durch die Rekonstruktion seiner Genealogie. (Dahmer: Zum Verständnis des Antisemitismus. In: Rassismus, Antisemitismus, politische Gewalt und Verfolgung. Hg. EMG, Lübeck 2017, 46–58, 54,56).
Coda
Wenn das bekannte Wort zutrifft, dass sich die Geschichte immer zweimal ereignet – das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce –, dann liefert das Schicksal von Nina Gladitz’ Film Zeit des Schweigens und der Dunkelheit ein fast einzigartig bizarres Exempel. Er wurde vom WDR gesendet und angesichts der Klage Leni Riefenstahls dann auf der Stelle bis heute gesperrt. Die zweite Tragödie traf Nina Gladitz; sie berichtet, dass sie von ihrem Haussender von Stund an ebenfalls gesperrt wurde. Dass der Sender seiner anerkannten Filmemacherin stattdessen beigesprungen wäre, entsprechend dem, was sonst in der ARD wenigstens als nobile officium galt oder hätte gelten sollen, einen Film und seine Autorin gegen Angriffe einer notorischen Anhängerin eines Diktators und Massenmörders zu verteidigen und nach Möglichkeit im Prozess öffentlich, moralisch und finanziell zu unterstützen, fiel den damaligen Verantwortlichen nicht ein. In diesen Jahren muss sich eine Art Virus auf Gehirne und Gedächtnisse ausgewirkt haben. Dieser hatte ja schon die ausschließlich proziganistischen Erinnerungen Leni Riefenstahls partiell arg in Mitleidenschaft gezogen. Da halfen, so schien es jedenfalls, weder unanfechtbare Dokumente der SS-Lagerleitungen noch die so peinlichen wie bezeichnenden Korrespondenzen Riefenstahls mit den Konzentrationslagern Maxglan und Marzahn. Die grassierenden Amnesien besserten sich selbst dann nicht, als das Endurteil des OLG Karlsruhe von 1987 mir aufzeigte, dass der Film vom WDR mit einer minimalen Schnittveränderung und Auslassung einer einzigen Wortpassage hätte wieder gesendet werden können und dürfen. Stattdessen verschwand er seitdem, wie wenn es ihn nie gegeben hätte, vergleichbar mit den in Tiefland verschwundenen Sinti, in den Untiefen des Archivs des Kölner Senders. Manche Beobachter der Medien hielten es schon in den 1980er Jahren des 20. Jahrhunderts dennoch für ziemlich ausgeschlossen, dass der WDR implizit für die ja bekanntlich als geläutert empfundene Riefenstahl in anständiger und nobler Weise habe Partei ergreifen wollen. Andere hielten mit der Vermutung dagegen, dass just im Jahre 1987 durch die vom Spiegel groß aufgegriffene Affäre um den prominenten Journalisten, Moderator und WDR-Fernsehdirektor i.R. Werner Höfer und seine flotten Feuilletons, vor allem die Laudatio auf eine Hinrichtung eines Künstlers aus dem Jahre 1943 (Tod eines Pianisten, Spiegel 51 / 1987) die Anstalt durch unerfreuliche Unruhe, lästige Nachfragen und nicht enden wollende Diskussionen ein wenig in denkbar unnötige Rückschau und allzu überbelastet gewesen sei.
So ist der Stand: Dem WDR ist bis heute nicht in den Sinn gekommen, den inkriminierten Film zu senden oder der Autorin eine Kopie zu überlassen. Wie vor einiger Zeit zu hören war – und damit gelangen wir zu einer weiteren Farce, welches liebliche Genre sich im Verlauf moderner Mediengeschichte entgegen dem zitierten Diktum gern fortzupflanzen scheint –, soll sich der Sender und sein feinsinniges Justiziariat darauf berufen haben, man sei als gesetzestreuer Wahrer öffentlichen Rechts streng an die Rechtskraft des Verbots-Urteils von 1987 gebunden. Einige Juristen, sine obligo befragt, erwogen, eine seit Jahren verstorbene Person, und sei sie noch so prominent, verehrungswirksam oder auch abscheulich, ekelhaft und niederträchtig gewesen, habe nach ziemlich zuverlässiger Kunde aus dem Wunderwald der Rechtsgelehrsamkeit a priori gar kein tangibles Persönlichkeitsrecht mehr. Einer der ungenannt verbleiben wollenden Experten, öfters vor den Toren der Gerichte gesichtet, verwies auf den denkbaren überraschenden Umstand, dass die Vollstreckbarkeit von Urteilen nach dreißig Jahren absolut ende… Noch offene Fragen, wie man sieht.
|
||