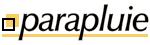
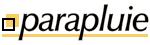 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 26: visuelle kultur
|
Sag es mit BildernZum Arbeiten mit fotografischem Material bei Thomas Mann und Arno Schmidt |
||
von Ina Cappelmann |
|
Die Einflüsse der visuellen Medien auf die Literatur lassen sich auf unterschiedliche Weise erfassen. Eine Möglichkeit stellt die Lektüre literarischer Texte im Hinblick auf expliziten und impliziten Medienbezug der Autoren dar. Der Blick auf Fotografie und fotografische Technik verspricht neben einer neuen Perspektive auf bekannte Werke zudem, die Entwicklung, Verbreitung und Rezeption des Mediums innerhalb der Gesellschaft auf literarhistorischer Ebene nachvollziehen zu können. Beispiele finden sich bei Thomas Mann und Arno Schmidt. |
||||
Die Entwicklung immer neuer bildgebender Verfahren in den wissenschaftlichen Disziplinen prägt im wahrsten Sinne des Wortes unser 'Bild von der Welt'. Die Visualisierung von Nachrichten, Sachverhalten und Forschungsergebnissen ist mit dem Zeitalter medialer Bildgebungs- und Reproduktionsverfahren selbstverständlich geworden. |
||||
In den Geisteswissenschaften sind insbesondere die Auseinandersetzung mit den menschlichen Sehgewohnheiten und ihre Beeinflussung durch technische Innovationen der Bilderzeugung von Interesse. In der Neueren Deutschen Literaturwissenschaft steht hier die Untersuchung von expliziten und impliziten Bildbezügen in den Romanen und Novellen des 19. und 20. Jahrhunderts im Vordergrund. Die Analyse dieser medienvisuellen Einflüsse ist dabei nicht nur relevant für das Verständnis einzelner Werke, sondern gibt zudem auch Auskunft über die jeweilige zeitgenössische Medienrezeption. |
||||
Expose yourself: Thomas Mann und sein Idealbild eines Künstlers | ||||
Das Verhältnis von Literatur und Fotografie ist in sich weit verzweigt: Fotografische Bilder regen zur Textproduktion und -modulation an, stehen Pate für Figuren, finden in versprachlichter wie in bildlicher Form Eingang ins Werk und werden zum Motiv oder Thema einer Erzählung. |
||||
Der Rückgriff auf Fotografien als motivische Vorlagen findet sich häufig in der neueren deutschen Literatur. Als Beispiel aus dem beginnenden 20. Jahrhundert ist hier vor allem Thomas Mann zu nennen, der das älteste der neuen Medien in vielfacher Weise für sich und für seine literarischen Arbeiten nutzte. Die Differenzierung zwischen dem Einsatz der Fotografie zur Befriedigung der eigenen narzißtischen Bedürfnisse und der Verwendung von fotografischem Bildmaterial als Inspiration und Quelle für das literarische Werk ist insofern interesssant, als daß sich hier verschiedene Verständnisformen und Akzeptanzgrade des neuen Mediums bei Mann herauslesen lassen. |
||||
Obwohl Mann selbst keinen Fotoapparat besaß und der Technik und ihren neuen Errungenschaften eher skeptisch gegenüberstand, umgab er sich mit Fotografien von seiner Frau und seinen Kindern. Auch legte Thomas Mann großen Wert auf den Austausch von Aufnahmen unter Freuden und verstand das Versenden von fotografischen Bildern als Vertrauenszeichen und Freundschaftsbeweis, wie in Eva-Monika Turcks Buch Thomas Mann. Fotografie wird Literatur nachzulesen ist: |
||||
"Auf jedem Fall freut sich Thomas Mann über Fotografien, spricht von 'freudiger Rührung' oder 'herzlichem Vergnügen' [...]. Er selbst besorgt die Silberrahmen für die Fotografien seiner Liebsten, die er auf seinen Schreibtisch stellt. Fotos werden an Freunde verschickt, sogar mit Widmung, sind Zeichen von teilnehmender Verbundenheit, auf deren Ausbleiben Thomas Mann empfindlich reagiert. [...] Fotografien von Freunden wie Hermann Hesse oder Mrs. Agnes E. Meyer hütet er sorgfältig. [...] Thomas Mann schätzt Fotografien als zweite Natur, als zuverlässige Wirklichkeitsabbildung. [...] In der Überzeugung, daß die Fotografie das Original authentisch wiedergibt, verlangt der Briefeschreiber Thomas Mann eine Bestätigung seiner literarischen Imagination." |
||||
Fotografien werden von Thomas Mann jedoch nicht nur als Freundschaftsbeweis und als Abbild des Äußeren eines Menschen verstanden, sondern auch zur Konstituierung des eigenen Bildes eingesetzt. Das Foto dient von Anbeginn an auch der Erinnerungskonstruktion: Mann weiß um die Wirkungsmacht der fotografischen Bilder und setzt sich gezielt vor der Kamera in Szene, um der Nachwelt das Bild von sich zu hinterlassen, das er schon zu Lebzeiten von sich entworfen hat und welches er überliefert wissen wollte: |
||||
"'Ich werde mich fotografieren lassen, die Rechte in der Frackweste und die Linke auf die drei Bände [die erste Ausgabe der Buddenbrooks, Anm. I. C.] gestützt; dann kann ich eigentlich getrost in die Grube fahren', schreibt der 24jäihrige ironisch [...] an seinen Bruder Heinrich 1901. [...] Den Willen Thomas Manns, der Nachwelt sein 'wahres' Bild als Künstler zu überliefern, dokumentieren alle fünfzig Fotografien, die heute das Zürcher Thomas Mann Archiv verwahrt. Berühmte Fotografen wie Man Ray, Lotte Jacobi, Erich Salomon [...] haben Thomas Mann porträtiert. [...] Auch wenn er sich nicht gern fotografieren ließ, so sollte doch das Lichtbild dem Dichter-Schriftsteller ein Denkmal setzen [...]." |
||||
Turck geht aber nicht nur auf den Aspekt der Selbstinszenierung Thomas Manns ein, sondern legt vor allem auch dessen Rückgriff auf fotografisches Material in seinem Werk dar. Ähnlich wie Degas, der für seine Gemälde der Ballettelevinnen auf Fotos zurückgriff, die die Einzelbewegungen deutlicher zeigen, als das menschliche Auge sie wahrzunehmen vermag, verwendete auch Mann fotografische Aufnahmen, um sie in das von ihm präferierte Medium Literatur zu 'übersetzen'. Vor allem seine Figurenbeschreibungen, seine Einführungen einzelner Personen in Roman oder Novelle über das Aussehen lesen sich zum Teil wie Bildbeschreibungen im Sinne einer Werkanalyse: Die Gesamterscheinung wird erfaßt, besonders auffällige physiognomische Merkmale (wie zum Beispiel Körpergröße oder Haarfarbe) werden herausgestellt, um dann, nach Eingehen auf Details wie Kleidungsstil oder -- im folgenden Textausschnitt -- Form und Farbe des Brillengestells, von der Analyse überzugehen in die zweite Stufe einer 'klassischen' Bildbetrachtung, die der Interpretation. So, wie Thomas Mann ein Bild von 'dem Schriftsteller' vor Augen hatte, dem er selbst vor der Kamera zu entsprechen suchte, so wird jeder Mensch in seinen literarischen Werken mit bestimmten optischen Merkmalen ausgestattet, die Hinweise auf das Wesen der jeweiligen Figur geben sollen. Gustav von Aschenbach, die Hauptfigur seiner Novelle Der Tod in Venedig, stellt etwa den Idealtypus eines Schriftstellers für Thomas Mann dar, wie in Verbindung mit dessen äußerlicher Beschreibung zu lesen ist: |
||||
"Gustav von Aschenbach war etwas unter Mittelgröße, brünett, rasiert. Sein Kopf erschien ein wenig zu groß im Verhältnis zu der fast zierlichen Gestalt. Sein rückwärts gebürstetes Haar, am Scheitel gelichtet, an den Schläfen sehr voll und stark ergraut, umrahmte eine hohe, zerklüftete und gleichsam narbige Stirn. Der Bügel einer Goldbrille mit randlosen Gläsern schnitt in die Wurzel der gedrungenen, edel gebogenen Nase ein. [...] Bedeutende Schicksale schienen über dies meist leidend seitwärts geneigte Haupt hinweggegangen zu sein, und doch war die Kunst es gewesen, die hier jene physiognomische Durchbildung übernommen hatte, welche sonst das Werk eines schweren, bewegten Lebens ist. [...]." |
||||
Die ausführliche Beschreibung Gustav von Aschenbachs liest sich wie die Wiedergabe eines Fotos im Medium der Sprache im Sinne der sich vom Allgemeinen über Detail und Gesamtkomposition hin zur Interpretation entwickelnden Bildanalyse, wie sie in den Kunstwissenschaften vorgenommen wird. Manns optische Beschreibungen seiner Romanfiguren sind nicht nur sehr genau, sondern auch 'vollständig' im Sinne von umfassend: Einmal eingeführt, sind kaum Hinzufügungen im weiteren Text zu Aussehen und Erscheinung seiner Protagonisten notwendig. Hieraus läßt sich schließen, daß Mann entweder selbst im Vorfeld des Schreibens am jeweiligen Roman genaue Personenskizzen angelegt, oder aber fotografische Vorlagen verwendet und lediglich um die eigenen Assoziationen zu Wesen und Charakter ergänzt hat. "Auch wenn Thomas Mann im Detail bewusst vom fotografischen 'Original' abweichen mag, es ist die Methode, die fotografische Präzision der Beschreibung, die er [...] zu seinem Erzählprinzip erhoben hat", heißt es hierzu bestätigend bei Eva-Monika Turck. |
||||
Die These der bildhaften Vorlage läßt sich durch erhaltene Briefe Manns festigen: Als Vorlage für die Figur des Schriftstellers dienten Thomas Mann Fotografien des Komponisten Gustav Mahler, von dem er neben dem äußeren Erscheinungsbild auch den Vornamen übernahm. Mann war mit physiognomischen Studien vertraut und wußte auch um die eigene Wirkungsmacht im Einsatz der Bilder, deren Interpretation er an seine Leser weitergab. Die Fotografien Gustav Mahlers setzte er rund 20 Jahre später erneut ein, um der Hauptfigur seines Doktor Faustus Aussehen und Wesen zu verleihen. |
||||
Ähnlich verfuhr Mann in vielen anderen Erzählungen im Hinblick auf die optische Konzeption seiner literarischen Figuren. Insbesondere in seinem oft als Gegenstück zur Novelle Der Tod in Venedig gelesenen Roman Der Zauberberg finden sich Rückgriffe auf fotografische Porträtaufnahmen: Castorps Mentor Settembrini etwa ähnelt in seinem Äußeren deutlich erkennbar dem italienischen Komponisten Ruggiero Leoncavallo, und der Leiter des Sanatoriums, in dem der Roman spielt, ist in seiner äußerlichen Gestalt wie in seinem Wesen angelehnt an den Arzt, der Manns Frau Katia während ihres Klinikaufenthaltes behandelte. |
||||
Bitte recht freundlich: Fotografie und Fotoapparat als Motive in Thomas Manns Erzählungen | ||||
Zu Lebzeiten Thomas Manns war das Medium Fotografie in der Bevölkerung noch nicht sehr verbreitet und seine Bedienung alles andere als einfach, weshalb der Fotograf von Mann eher als Techniker denn als Künstler wahrgenommen wurde. So kann man verstehen, warum der Fotograf in den Werken von Mann, deren Mittelpunkt oft das Verhältnis des Künstlers beziehungsweise des Intellektuellen zum Bürgertum bildet, kaum eine Rolle spielt. |
||||
So sehr Mann auch die Fotografien als 'Abbilder der Wirklichkeit' schätzte und sowohl für sein eigenes Arbeiten als auch zur Gestaltung des eigenen Bildes in der Öffentlichkeit nutzte, so skeptisch stand er dennoch dem Beruf des Fotografen gegenüber. |
||||
"Thomas Mann hat sein Schreibzeug wohl selten eingetauscht gegen den Fotoapparat. [...] 'Vielleicht hat er gelegentlich geknipst, wenn ein anderer ihm das Licht und die Entfernung eingestellt hatte, sein Verhältnis zu Maschinen ganz gleich welcher Art war nun einmal nicht das beste!'", |
||||
zitiert Eva-Monika Turck aus einem Brief von Manns Tochter Elisabeth. Es waren wohl in erster Linie die Schnappschüsse der Fotojournalisten, die Mann verärgerten, da sie der von ihm angestrebten fotografischen Inszenierung zuwiderliefen und Momente zeigten, die er nicht im Bilde festgehalten sehen wollte. |
||||
Die distanzierte Haltung gegenüber dem Berufsfotografen spiegelt sich nicht nur auf persönlicher Ebene wider, sondern findet auch Niederschlag im Werk Thomas Manns, wie Turck herausarbeitet: Der einzige Fotograf taucht in der Novelle Bajazzo von 1897 auf; er wird beschrieben als "Sprachunkundiger", der sich als 'Ersatz' für den verbalen Austausch dem Medium Fotografie zuwendet, wodurch Mann die Sprache in ihrer Universalität über die des Bildes setzt. |
||||
Zeige mir dein Bild, und ich sag' dir, wer du bist | ||||
Das fotografisch reproduzierbare Bild, Medium seiner Zeit und als solches umstritten wie mit Begeisterung aufgenommen, setzt Mann in unterschiedlichen Kontexten ein. Manns Verhältnis zur Fotografie entspricht dabei der zeitgenössischen Bildrezeption zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der der Wahrheitsgehalt des fotografischen Bildes noch wenig in Frage gestellt und das Foto als Beleg und Beweis verstanden wird, das den 'direkten' Blick auf etwas oder jemanden überflüssig macht. So wird Tony in Manns Gesellschaftsroman Buddenbrooks allein aufgrund ihres eingereichten Foto-Porträts nicht als Gesellschaftsdame eingestellt: "Sie sind zu hübsch, ein erwachsener Sohn lebt im Hause!" |
||||
Im Zauberberg setzt Hans Castorp das Röntgenbild seiner Lunge als 'Passbild' ein; der Blick ins Innere eines Menschen steht hier stellvertretend für dessen Individualität und Einzigartigkeit, welche durch das fotografische Abbild fixiert werden. Das Foto, so die Aussage, zeigt mehr als das bloße Auge zu sehen vermag. Die Faszination der Mehrinformation, die das technisch erzeugte Bild bietet, zieht sich durch den Fotodiskurs vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart: während zu Lebzeiten Thomas Manns Muybridges Bewegungsstudien und erste Röntgenaufnahmen ein Möglichkeitsspektrum visuellen Wahrnehmens boten, das ohne das neue Medium nicht hätte erschlossen werden können, so revolutioniert heute die visuelle Darstellung menschlicher Gene oder eine Fotografie vom Mars die menschliche Wahrnehmung. Die Veränderungen unseres Weltbildes -- der Blick in biologische Mikrostrukturen ebenso wie der in den Makrokosmos des Weltalls -- werden durch Bildaufnahmen repräsentiert. "Es sind nicht Texte, sondern Bilder, die die Wende zum 21. Jahrhundert markieren und sich in unsere Köpfe eingebrannt haben", so Hubert Burda im Vorwort zum Sammelband Iconic Turn. |
||||
Bildrezeption nach 1945: Kritische Blicke | ||||
Der Blick in die deutschsprachige Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verdeutlicht nicht nur die fotografischen Einflüsse in Literatur und Wissenschaft, sondern bestätigt zudem auch die These, daß sich die zu dieser Zeit bereits zum Mediendiskurs ausgeweitete Diskussion um Macht und Wirkungsweise der Bilder in der erzählenden Literatur widerspiegelt. |
||||
Die zunehmende Kritik, die sich am Verständnis vom Foto als die Wirklichkeit objektiv wiedergebendes Medium entzündet hatte, hat nach 1945 deutlich zugenommen. Die ersten 'gefälschten', offensichtlich gestellten Aufnahmen aus dem spanischen Bürgerkrieg und dem Zweiten Weltkrieg sensibilisierten die Menschen dafür, Fotografien als einen stets subjektiv gewählten, zum Teil sogar inszenierten Ausschnitt einer Handlung zu lesen. Der Betrachter ist im Bild ist Titel einer 1985 von Wolfgang Kemp herausgegebenen Schrift zum Verhältnis von Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik; er ließe sich auch zur Beschreibung der veränderten Foto-Rezeption verwenden: Das Foto als Momentaufnahme impliziert immer auch die Augenblicke vor und nach der Entstehung des Bildes. Der Eindruck von einer Objektivität der Fotografie entsteht durch ihren Abbildcharakter; die Bildinhalte aber sind individuell ausgewählt und festgelegt. Die Rolle des Fotografen, zuvor kaum berücksichtigt, gerät in den 1960er-Jahren zunehmend ins Zentrum des Interesses. |
||||
Arno Schmidt: Das Bild im Text | ||||
Ein Beispiel für die bestehenbleibende Faszination des Mediums Fotografie und die gleichzeitig zunehmende Skepsis ob des Wahrheitsgehaltes der visuellen Aussagen findet sich in der deutschen Literatur nach 1945 bei Arno Schmidt. |
||||
Arno Schmidt arbeitete bei der Figurengestaltung ebenfalls mit fotografischen Vorlagen; anders als Thomas Mann aber fügte er das Bildmaterial, bei dem es sich oft um Aufnahmen handelte, die er aus Zeitschriften und Modekatalogen ausgeschnitten hatte, auch direkt in seine Texte ein. Hierzu heißt es im Katalog Arno Schmidt? -- Allerdings!, den die Arno Schmidt-Stiftung 2006 anläßlich einer Ausstellung zu Schmidt herausgegeben hat: |
||||
"Schon aus den 1940er Jahren ist Bildmaterial erhalten. Schmidt scheint dieses jedoch weniger einer Eigenlogik des Materials folgend genutzt zu haben denn schlicht als Fundus für Beschreibungen [...]. Beginnend mit Zettels Traum verändert sich allerdings die Bedeutung der Vorlagen für den Schreibprozess. Erstens findet von nun an zunehmend Bildmaterial den Weg ins gedruckte Werk, Schmidt montiert es direkt in die Manuskripte. [...] Thematischen Eingang ins Werk findet nun zweitens die Frage der Arbeit von Autoren mit Bildvorlagen." |
||||
Arno Schmidt baute insbesondere seine späteren Arbeiten auf dem von ihm gesammelten Bildmaterial auf: Beginnend mit dem Werk Zettels Traum legte Schmidt für seine ab den 1960er-Jahren erschienenen Werke Sammelmappen an, in denen er Fotografien und Zeitungsausschnitte für ein bewußt bildgestütztes literarisches Arbeiten sammelte. |
||||
"Die Integration von Bildmaterial führt [...] zu einer gezielten, wenn auch eigenwilligen Organisation des Sammelns und Anordnens, die man vielleicht als Privatarchivierung bezeichnen könnte. Davon zeugen vier Mappen, die im Schreibprozess für die letzten vier Werke entstehen. Was sich dort findet, sind in erster Linie Ausschnitte einer medial verfassten Wirklichkeit, vornehmlich Bilder [...]." |
||||
Schmidts experimentelles Arbeiten mit Fotografien wurde zu einer Konstanten des Spätwerkes; das visuelle Material begeisterte und fesselte ihn, zog ihn jedoch auch zunehmend dergestalt in seinen Bann, daß Schmidt, umgeben von medial erzeugten Bildern, um die Bilder der eigenen Phantasie zu fürchten begann. |
||||
Foto-Fetisch und Medienkritik: Arno Schmidts Arbeiten mit Bildmaterial | ||||
Schmidt selbst bezeichnete das von den Bildern In-den-Bann-gezogen-Werden als "Rückkoppelungseffekt": Die Wirkung, die für Schmidt von einem bestimmten Bild ausging, machte er fruchtbar für sein Arbeiten und brachte die mit dem Bild verknüpften Assoziationen in den jeweiligen Text ein. Zugleich jedoch nahm die Begeisterung für das gesammelte Bildmaterial so u, daß Arno Schmidt um die Gedankenbilder der eigenen Phantasie fürchtete, weil das gesammelte visuelle Material diese zu überdecken und zu ersetzen begann. |
||||
Erstmals bewußt wahr nahm Schmidt den Einfluß der Bilder auf sein Schreiben während der Arbeit an Zettels Traum und durch die Bildvorlage für die Figur der Franziska. Im Ausstellungskatalog Arno Schmidt? -- Allerdings! wird aufgezeigt, wie das Foto als versprachlichtes Bild im Opus Magnum Schmidts eine Sonderstellung einnimmt und zum Foto-Fetisch wird: |
||||
"Abgebildet ist ein blondes Mädchen im roten Badeanzug mit weißer Bademütze. Der Ausschnitt ist mit Plastikfolie überzogen und befindet sich in einem Briefumschlag, der von Schmidt mehrfach und unterschiedlich datiert mit 'meine Franziska' beschriftet ist. Es handelt sich um die Bildvorlage zu Franziska Jacobi, der zweiten Hauptfigur in Zettels Traum [...]. Wie Wolfgang Martynkewicz gezeigt hat, wird Franziska zwar (natürlich) nicht durchgehend in der vom Bild festgehaltenen Pose und Kleidung beschrieben, wohl aber erscheint sie parallel zum wachsenden Begehren des Protagonisten Pagenstecher zunehmend in Übereinstimmung mit dem Katalogbild, allein der rote Badeanzug spielt mehr als 40mal eine Rolle." |
||||
Schmidt wußte um die Bedeutung der fotografischen Arbeiten für sein Werk. Der sicherlich nicht ohne eine gewisse Ironie von Schmidt geäußerte und durchaus wertvolle Hinweis, über die Analyse der Bildbezüge einen Zugang zu seinen Arbeiten zu finden, macht Schmidts eigene Verstrickung in die Text-Bilder deutlich. |
||||
Medienreflektion im Medium: Schmidts Protagonisten in Wort und Tat | ||||
Wer Schmidts literarische Texte verstehen will, muß sich mit den darin explizit und implizit enthaltenen Bildern auseinandersetzen -- und wird über die Lektüre an das generelle Bild-Text-Verhältnis in der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur herangeführt. Dies spiegelt sich vor allem in Arno Schmidts Spätwerk wider, in dem er als einer der ersten deutsche Literaten beginnt, die Rolle der Medien von seinen Figuren thematisieren zu lassen. In Zettels Traum beispielsweise sinniert der Schriftsteller Pagenstecher über den Umgang mit den Medien; das Katalog- oder Zeitschriftenbild wird nicht nur als "kulltourhistorisches Dockumänt" eingestuft und als solches archiviert, sondern gleichzeitig auch skeptisch betrachtet im Hinblick auf seinen Einfluß auf die Gesellschaft und auf das eigene Schaffen: |
||||
"'Du verkennst=Wilma, daß sich der Einfluß von Bildern & Bild=Ähnlichem, Dia-positiv beweisen läßt.' (Du bißt bestimmt auch anfällig für Unterwäsche-Kataloge ! -- 'Kino=Theater=Illustrierte' frönen der (anschein'd immer=mächtiger zunehmenden) Schau=Lust : das Netz der Voyeur=Möglichkeiten ist phil= & eng=matschig genug gewordn, um Jedermann=jederzeit irgendeine Möglichkeit darzubietn. Der Einfluß von Bildern auf Kunstwerke -- (wenn du willst : auf unser minütliches Handeln!) -- ist ein weitweiteres und unbearbeiteteres Feld, als Du=Dir träumen läßt, (oder gestehen möchtest!: Wie=oft werdn nicht Dichter (auch Maler meinethalbm) angeregt worden sein durch Pfootos... [...]" |
||||
Diese Äußerungen der Figur Daniel Pagenstecher entsprechen Schmidts eigenen Ansichten, spiegeln seine ambivalente Haltung dem von ihm gesammelten und verwendeten Bildmaterial gegenüber wider. Wolfgang Martynkewicz hat die medialen Einflüsse auf und in Arno Schmidts Werk untersucht und die Parallelen zwischen Schmidt und seinem Alter Ego Pagenstecher herausgestellt. Ebenso, wie Schmidt Buch darüber führte, welche Sendungen er sich im Fernsehen angeschaut hat, läßt er auch Pagenstecher dessen Medienkonsum dokumentieren, um, wie in Zettels Traum formuliert, "ein eventuelles Abfärbm auf meine Arbeiten verfolgn zu können." |
||||
Auch die Figur des Dichters Cosmos Schweighäuser in der Schule der Atheisten (1972) setzt, ganz ähnlich wie Schmidt selbst, das mediale Bild für sein schriftstellerisches Arbeiten ein, bedient sich der Anregungen, die es bietet und fürchtet zugleich den Kontrollverlust, das Untergehen in der Bilderflut. Schweighäuser versucht, dieser Angst durch eine objektiv-wissenschaftliche Betrachtung des eigenen Handelns zu begegnen: |
||||
"Das allerbedeutndste, [...] würde natürlich die Untersuchung werdn: 'Warum &/ ab wann beginnt ein Dichter, Bilder als Vorlagen zu verwendn?'; (anstatt auf 'wirkliche Erlebnisse' zurückzugreifn) -- ist das eine reine AltersFrage?; oder aber eine von Temperament?/ Constitution?; (dh 'ist' Einer so, oder 'wird' Jeder so?)." |
||||
Die Auseinandersetzung mit den omnipräsenten optischen Reizen durch Foto, Film, Fernsehen und Reklame ist zentrales Moment im Leben und Arbeiten Arno Schmidts. Martynkewicz verweist neben den motivischen und inhaltlichen Bezugnahmen auf Bildmaterial auch auf die medialen Einflüsse in der Sprache des Autors und somit auf eine weitere Form intermedialen Arbeitens. Arno Schmidt arbeitete in seinen Texten mit Licht- und Beleuchtungsverhältnissen, leuchtete Szenen aus oder betonte 'schattige' Sequenzen, um so Dinge zu gewichten und atmosphärisch zu gestalten. Auch den Blick durch die Kamera, die ausschnitthafte Wahrnehmung und Fokussierung der Welt setzte er sprachlich um und als Gestaltungsmittel in seinen Texten ein. |
||||
Das Fenster als Tor zum Bild | ||||
Besonders deutlich wird dies, wenn man sich die Szenen in Schmidts Spätwerk anschaut, in denen Türöffnungen, vor allem aber Fenster, mit ihrer Möglichkeit zum Blick nach draußen eine Rolle als Erweiterung des jeweiligen Handlungsortes spielen. |
||||
"Das Loch bei der Camera Obscura, das mit seiner Linse eine Art Schnittpunkt und Regulator ist, taucht bei Schmidt zumeist als Fenster auf. Diese Fenster sind Öffnungen zur Welt [...]. Sie projizieren dann die äußere Wirklichkeit in das dunkle Innere", |
||||
heißt es in Wolfgang Martynkewiczs Bilder und EinBILDungen. In Abend mit Goldrand zeigt der Blick aus dem Fenster oft einen Ausschnitt der Wirklichkeit, der innerhalb des Romans bildhaft -- zweidimensional und auf die optische Erscheinung der meist weiblichen, vor den Fenstern vorbeigehenden Figuren beschränkt -- wiedergegeben wird. Dies gilt insbesondere für die Figur der An'Ev'; eine Textpassage hierzu lautet: |
||||
"Die Mädchen, Hand in Hand, an der SW=Ecke des Hauses, vor A&O's Fenstern. AE mit schwarzem (schattijem) Gesicht; nur d linke Schulter schön blaßgemalt vom Mond. Sie hat d Linke ins lange Haar u über's Schlüsselbein gehakt." |
||||
Haltung und Pose An'Ev's erinnern an Bilder in Modemagazinen, wie sie Arno Schmidt als Vorlagen für seine Figuren verwendet hat. Neben der Körperhaltung selbst ist es vor allem die Beschreibung, die Reminiszenzen zu fotografischen Bildern aufweist: Das Licht-und-Schatten-Verhältnis, das von Schmidt in diesem kurzen Abschnitt besonders betont wird, gleicht einer Übertragung der Bildwirkung in sprachlich gestaltete Atmosphäre -- nicht ohne Bezugnahme auf die bildliche Modulation von Hell-Dunkel-Kontrasten, wie die vom Mond "blaßgemalte" Schulter verdeutlicht. Das Motiv des Fensters taucht gleich zweimal auf: Zum einen dient es zum Blick aus dem begrenzten Innenraum hinaus in eine durch die Größe und Lage des Fensters begrenzte Wirklichkeit. Zum anderen fungiert es als Hintergrund; es betont und rahmt ein, was vom Betrachter fokussiert wird: An'Ev's Oberkörper, wie er sich ihm vor dem Fensterglas und im Mondlicht präsentiert. |
||||
Der medial geprägte Blick auf die Wirklichkeit: Die neue Macht der Bilder | ||||
Die fotografisch anmutenden Beschreibungen und Stilelemente bei Schmidt sind nicht (nur) als individuelle Spielart des Autors zu lesen, sondern vielmehr als Ausdruck der bildgeleiteten Wahrnehmung des Menschen, die -- "im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit" (Walter Benjamin) nicht nur von Kunstwerken -- unsere Gesellschaft maßgeblich beeinflußt und konstituiert. |
||||
Umgeben von Bildmedien, so ließe sich mit Martynkewicz aus Schmidts sprachlicher Ausdrucksweise und stilistischer Gestaltung seiner Werke schließen, adaptiert die natürliche Wahrnehmung des Menschen die technischen Verfahren und schafft ein neues Verständnis von Welt und Wirklichkeit: |
||||
"In der Literatur Arno Schmidts bewegen sich die Protagonisten nicht in Bildräumen, sie empfangen Bilder über eine Vielzahl von optischen Geräten, für die alle Figuren -- und auch Schmidt selbst -- ein ausgesprochen starkes Interesse an den Tag legen. An kaum einer Stelle gibt es einen direkten Blick auf die Wirklichkeit; wo sie erscheint, ist sie schon bildhaft, weil sie in den Augen Schmidts gar nicht anders existiert." |
||||
Das kulturelle Gedächtnis, so Horst Bredekamp, konstituiert sich aus Bildern -- in zunehmendem Maße. Die Entwicklung von Reproduktionsverfahren hat wesentliche Anteile an den in nahezu allen Bereichen des zeitgenössischen westlichen Lebens beobachtbaren Visualisierungsprozessen. Auch die Literatur bedient sich der Bildmedien und gibt zuweilen Anregungen zur Rezeption, die erhellend sein können für die Analyse der eigenen Gegenstände unter neuen Gesichtspunkten, die aber auch kunst- und kulturhistorische Überlegungen vorantreiben. |
||||
Die Fotografie bildet lediglich den Ausgangspunkt für Untersuchungen der Text-Bild-Relationen im sogenannten 'Medienzeitalter': ihre verhältnismäßig lange Geschichte macht es möglich, von Entwicklungsprozessen zu reden, die durch die Digitalisierung weiter vorangetrieben und sich auch auf die allgemeine Rezeption von Bildern auswirken werden. |
||||
|
autoreninfo

Ina Cappelmann, geboren 1981, studierte Germanistik und Kunstgeschichte/Visuelle Medien an der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg. Seit 2008 arbeitet sie als Stipendiatin der Studienstiftung an ihrer Promotion zum Thema Literatur und Fotografie. Zur Bedeutung fototechnischer Arbeiten und Arbeitsweisen in der deutschsprachigen Literatur des 20. und des beginnenden 21. Jahrhunderts. Lehrbeauftragte an der Oldenburger Carl von Ossietzky-Universität im Bereich Neuere deutsche Literaturwissenschaft seit Sommersemester 2010.
|
||||
|
|