- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Museen, Festivals & Reisen
- Preise, Projekte, Archive, Tagungen, Akademien
- LiteraturhГӨuser
- Partner



FÖRDERGEBER

PARTNER/INNEN

Anna Rottensteiner: Nur ein Wimpernschlag.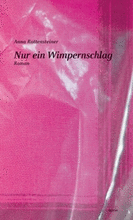 Roman. Nur ein Wimpernschlag ist Anna Rottensteiners zweiter Roman und verhandelt wie der erste, Lithops. Lebende Steine (2013), ReibeflГӨchen zwischen dem eigenen Sein und dem politischen Geschehen. In Lithops wird rГјckblickend Гјber ein Paar erzГӨhlt, das sich im Zweiten Weltkrieg an verschiedenen Fronten befindet. Sie ist Mussolini-AnhГӨngerin, er Mitglied der deutschen Spionageabwehr. Nur ein Wimpernschlag verbindet ebenfalls verschiedene Zeitebenen, und greift dabei ein Thema auf, das von besonderer zeitgenГ¶ssischer (und zeitloser) Bedeutung ist, nГӨmlich jenes der Flucht und damit auch der Suche nach Heimat. Marina Rauchenbacher Originalbeitrag. FГјr die Rezensionen sind die jeweiligen VerfasserInnen verantwortlich. Sie geben nicht notwendig die Meinung der Redaktion wieder.
|
| Veranstaltungen |
|
Sehr geehrte Veranstaltungsbesucher
/innen ! Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Sommer und freuen uns, wenn wir Sie im September... |
| Ausstellung |
|
Christine Lavant вҖ“ "Ich bin wie eine Verdammte die von Engeln weiГҹ"
09.05. bis 25.09.2019 Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihrem Werk und die...
"Der erste Satz вҖ“ Das ganze Buch"
вҖ“ Sechzig erste SГӨtze вҖ“ Ein Projekt von Margit Schreiner 24.06.2019 bis 28.05.2020 Nach Margret Kreidl konnte die Autorin Margit Schreiner als... |
| Tipp |
|
OUT NOW - flugschrift Nr. 27 von Marianne Jungmaier
Eine Collage generiert aus Schlaf und flankiert von weiteren auf der RГјckseite angeordneten... |
|
Literaturfestivals in Г–sterreich
Bachmannpreis in Klagenfurt, Tauriska am GroГҹvenediger, Г–-Tone und Summerstage in Wien вҖ“ der... |