- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen

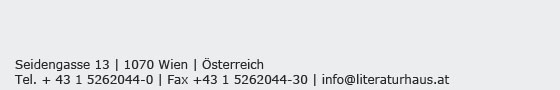
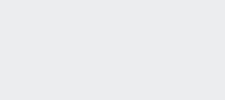


FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Birgit Birnbacher: Wir ohne Wal. 8. Zweihundert Meter (Antonia Grader) Wenn ich die Brücke erreiche, darf mich nichts mehr stören. Auch dieser Mann mit der Umhängetasche nicht, den ich aus dem Augenwinkel stehen bleiben, wie in einer Vorahnung die Hand ausstrecken sehe. Jetzt stehe ich noch hier, aber gleich werde ich losgerannt sein. Es sind nur zweihundert Meter, nicht mehr. Noch halte ich das dicke Seil in der Hand und spüre es, grob wie ein Tau, aber gleich werde ich es losgelassen haben und einfach davongelaufen sein. Vor diesem Wal und diesem Ort hier, der mir noch einmal klar gemacht hat, Marika ist erwachsen, Theresa ist es umso mehr. An dem Seil zu ziehen ist schwer, und wenn ich es tue, bewegt sich der Wal erst nach Sekunden, behäbig. Sein Weiß sticht in den Augen, aber ich blinzle nicht und schaue lange hin. Mir ist, als würde mir dieser Wal in seiner schwebenden Masse jetzt auf den letzten Metern noch etwas zuflüstern. Hätte ich einen Stift bei der Hand, ich würde vielleicht einen Gruß auf die Plane schreiben, den kurzen Gruß einer Mutter, einen Gedanken, meinen Stolz in zwei, drei Zeilen, nicht mehr. Wäre ich jetzt im Stande nachzudenken, ich würde das Tier mit einem kräftigen Ruck zu mir herunterholen, mit den Zähnen einen Edding aufmachen, die Hand ausstrecken und diese Zeilen schreiben für sie. Aber ich kann nicht mehr nachdenken, eine klare Überlegung ist auch nichts, was mir jetzt noch hilft. Ich kann die Gedanken nur nehmen, wie sie kommen, ohne zu vergessen, endlich das Seil loszulassen, loszulaufen. Und tatsächlich, es funktioniert. Eben habe ich ihn beschworen, diesen Gedanken, und jetzt ist er da. Eben habe ich mir noch gewünscht zu denken, lauf los, jetzt laufe ich schon. Ich laufe, und ich denke, aber das Denken ist kein Nachdenken mehr, eher ein Strom über mir. Aus diesem Strom heraus denke ich, es ist wahr, wenn ich sage, alles, was ich über Schuld weiß, habe ich vergessen. Wäre ich noch bei klarem Verstand, ich wüsste genau um das Gefühl, schuld zu sein. Ich bin so lange schuld gewesen und werde es danach noch sein, selbst dann und immerzu werde ich schuld sein. Aber ich werde es nicht mehr spüren so wie jetzt. (S.120f) © 2016 Jung und Jung, Salzburg
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt - online
Mi, 13.01.2021, 18.00–20.00 Uhr online-Schreibwerkstatt für 14- bis 20-Jährige Du schreibst und...
Grenzenlos? (Literaturedition Niederösterreich, 2020) - online
Do, 14.01.2021, 19.00 Uhr Buchpräsentation mit Lesungen Die Veranstaltung kann über den Live... |
| Ausstellung |
|
Claudia Bitter – Die Sprache der Dinge
14.09.2020 bis 25.02.2021 Seit rund 15 Jahren ist die Autorin Claudia Bitter auch bildnerisch... |
| Tipp |
|
LITERATUR FINDET STATT
Eigentlich hätte der jährlich erscheinende Katalog "DIE LITERATUR der österreichischen Kunst-,... |
|
OUT NOW flugschrift Nr. 33 von GERHARD RĂśHM
Die neue Ausgabe der flugschrift des in Wien geborenen Schriftstellers, Komponisten und bildenden... |